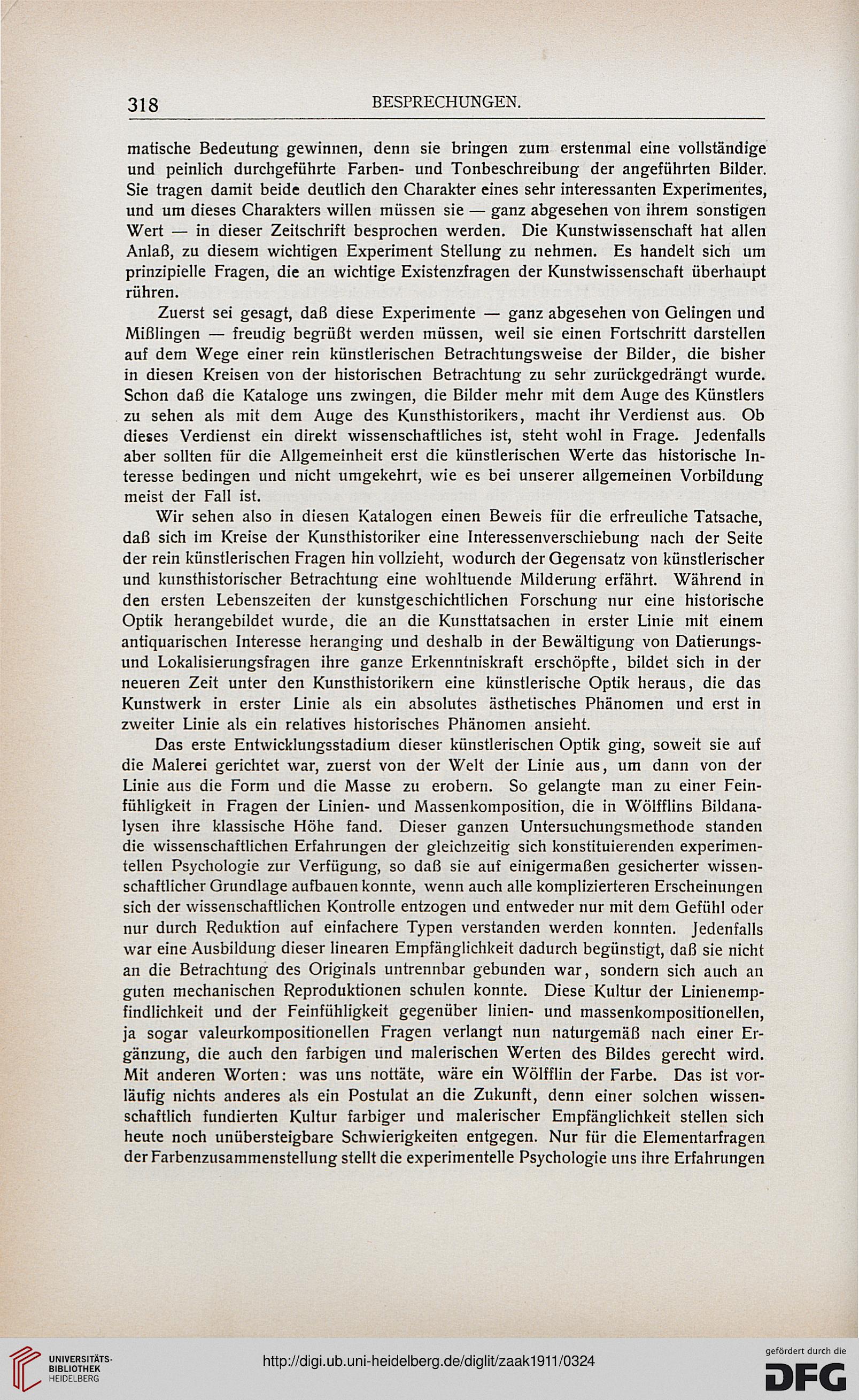318 BESPRECHUNGEN.
matische Bedeutung gewinnen, denn sie bringen zum erstenmal eine vollständige
und peinlich durchgeführte Farben- und Tonbeschreibung der angeführten Bilder.
Sie tragen damit beide deutlich den Charakter eines sehr interessanten Experimentes,
und um dieses Charakters willen müssen sie — ganz abgesehen von ihrem sonstigen
Wert — in dieser Zeitschrift besprochen werden. Die Kunstwissenschaft hat allen
Anlaß, zu diesem wichtigen Experiment Stellung zu nehmen. Es handelt sich um
prinzipielle Fragen, die an wichtige Existenzfragen der Kunstwissenschaft überhaupt
rühren.
Zuerst sei gesagt, daß diese Experimente — ganz abgesehen von Gelingen und
Mißlingen — freudig begrüßt werden müssen, weil sie einen Fortschritt darstellen
auf dem Wege einer rein künstlerischen Betrachtungsweise der Bilder, die bisher
in diesen Kreisen von der historischen Betrachtung zu sehr zurückgedrängt wurde.
Schon daß die Kataloge uns zwingen, die Bilder mehr mit dem Auge des Künstlers
zu sehen als mit dem Auge des Kunsthistorikers, macht ihr Verdienst aus. Ob
dieses Verdienst ein direkt wissenschaftliches ist, steht wohl in Frage. Jedenfalls
aber sollten für die Allgemeinheit erst die künstlerischen Werte das historische In-
teresse bedingen und nicht umgekehrt, wie es bei unserer allgemeinen Vorbildung
meist der Fall ist.
Wir sehen also in diesen Katalogen einen Beweis für die erfreuliche Tatsache,
daß sich im Kreise der Kunsthistoriker eine Interessenverschiebung nach der Seite
der rein künstlerischen Fragen hin vollzieht, wodurch der Gegensatz von künstlerischer
und kunsthistorischer Betrachtung eine wohltuende Milderung erfährt. Während in
den ersten Lebenszeiten der kunstgeschichtlichen Forschung nur eine historische
Optik herangebildet wurde, die an die Kunsttatsachen in erster Linie mit einem
antiquarischen Interesse heranging und deshalb in der Bewältigung von Datierungs-
und Lokalisierungsfragen ihre ganze Erkenntniskraft erschöpfte, bildet sich in der
neueren Zeit unter den Kunsthistorikern eine künstlerische Optik heraus, die das
Kunstwerk in erster Linie als ein absolutes ästhetisches Phänomen und erst in
zweiter Linie als ein relatives historisches Phänomen ansieht.
Das erste Entwicklungsstadium dieser künstlerischen Optik ging, soweit sie auf
die Malerei gerichtet war, zuerst von der Welt der Linie aus, um dann von der
Linie aus die Form und die Masse zu erobern. So gelangte man zu einer Fein-
fühligkeit in Fragen der Linien- und Massenkomposition, die in Wölfflins Biklana-
lysen ihre klassische Höhe fand. Dieser ganzen Untersuchungsmethode standen
die wissenschaftlichen Erfahrungen der gleichzeitig sich konstituierenden experimen-
tellen Psychologie zur Verfügung, so daß sie auf einigermaßen gesicherter wissen-
schaftlicher Grundlage aufbauen konnte, wenn auch alle komplizierteren Erscheinungen
sich der wissenschaftlichen Kontrolle entzogen und entweder nur mit dem Gefühl oder
nur durch Reduktion auf einfachere Typen verstanden werden konnten. Jedenfalls
war eine Ausbildung dieser linearen Empfänglichkeit dadurch begünstigt, daß sie nicht
an die Betrachtung des Originals untrennbar gebunden war, sondern sich auch an
guten mechanischen Reproduktionen schulen konnte. Diese Kultur der Linienemp-
findlichkeit und der Feinfühligkeit gegenüber Iinien- und massenkompositionellen,
ja sogar valeurkompositionellen Fragen verlangt nun naturgemäß nach einer Er-
gänzung, die auch den farbigen und malerischen Werten des Bildes gerecht wird.
Mit anderen Worten: was uns nottäte, wäre ein Wölfflin der Farbe. Das ist vor-
läufig nichts anderes als ein Postulat an die Zukunft, denn einer solchen wissen-
schaftlich fundierten Kultur farbiger und malerischer Empfänglichkeit stellen sich
heute noch unübersteigbare Schwierigkeiten entgegen. Nur für die Elementarfragen
der Farbenzusammenstellung stellt die experimentelle Psychologie uns ihre Erfahrungen
matische Bedeutung gewinnen, denn sie bringen zum erstenmal eine vollständige
und peinlich durchgeführte Farben- und Tonbeschreibung der angeführten Bilder.
Sie tragen damit beide deutlich den Charakter eines sehr interessanten Experimentes,
und um dieses Charakters willen müssen sie — ganz abgesehen von ihrem sonstigen
Wert — in dieser Zeitschrift besprochen werden. Die Kunstwissenschaft hat allen
Anlaß, zu diesem wichtigen Experiment Stellung zu nehmen. Es handelt sich um
prinzipielle Fragen, die an wichtige Existenzfragen der Kunstwissenschaft überhaupt
rühren.
Zuerst sei gesagt, daß diese Experimente — ganz abgesehen von Gelingen und
Mißlingen — freudig begrüßt werden müssen, weil sie einen Fortschritt darstellen
auf dem Wege einer rein künstlerischen Betrachtungsweise der Bilder, die bisher
in diesen Kreisen von der historischen Betrachtung zu sehr zurückgedrängt wurde.
Schon daß die Kataloge uns zwingen, die Bilder mehr mit dem Auge des Künstlers
zu sehen als mit dem Auge des Kunsthistorikers, macht ihr Verdienst aus. Ob
dieses Verdienst ein direkt wissenschaftliches ist, steht wohl in Frage. Jedenfalls
aber sollten für die Allgemeinheit erst die künstlerischen Werte das historische In-
teresse bedingen und nicht umgekehrt, wie es bei unserer allgemeinen Vorbildung
meist der Fall ist.
Wir sehen also in diesen Katalogen einen Beweis für die erfreuliche Tatsache,
daß sich im Kreise der Kunsthistoriker eine Interessenverschiebung nach der Seite
der rein künstlerischen Fragen hin vollzieht, wodurch der Gegensatz von künstlerischer
und kunsthistorischer Betrachtung eine wohltuende Milderung erfährt. Während in
den ersten Lebenszeiten der kunstgeschichtlichen Forschung nur eine historische
Optik herangebildet wurde, die an die Kunsttatsachen in erster Linie mit einem
antiquarischen Interesse heranging und deshalb in der Bewältigung von Datierungs-
und Lokalisierungsfragen ihre ganze Erkenntniskraft erschöpfte, bildet sich in der
neueren Zeit unter den Kunsthistorikern eine künstlerische Optik heraus, die das
Kunstwerk in erster Linie als ein absolutes ästhetisches Phänomen und erst in
zweiter Linie als ein relatives historisches Phänomen ansieht.
Das erste Entwicklungsstadium dieser künstlerischen Optik ging, soweit sie auf
die Malerei gerichtet war, zuerst von der Welt der Linie aus, um dann von der
Linie aus die Form und die Masse zu erobern. So gelangte man zu einer Fein-
fühligkeit in Fragen der Linien- und Massenkomposition, die in Wölfflins Biklana-
lysen ihre klassische Höhe fand. Dieser ganzen Untersuchungsmethode standen
die wissenschaftlichen Erfahrungen der gleichzeitig sich konstituierenden experimen-
tellen Psychologie zur Verfügung, so daß sie auf einigermaßen gesicherter wissen-
schaftlicher Grundlage aufbauen konnte, wenn auch alle komplizierteren Erscheinungen
sich der wissenschaftlichen Kontrolle entzogen und entweder nur mit dem Gefühl oder
nur durch Reduktion auf einfachere Typen verstanden werden konnten. Jedenfalls
war eine Ausbildung dieser linearen Empfänglichkeit dadurch begünstigt, daß sie nicht
an die Betrachtung des Originals untrennbar gebunden war, sondern sich auch an
guten mechanischen Reproduktionen schulen konnte. Diese Kultur der Linienemp-
findlichkeit und der Feinfühligkeit gegenüber Iinien- und massenkompositionellen,
ja sogar valeurkompositionellen Fragen verlangt nun naturgemäß nach einer Er-
gänzung, die auch den farbigen und malerischen Werten des Bildes gerecht wird.
Mit anderen Worten: was uns nottäte, wäre ein Wölfflin der Farbe. Das ist vor-
läufig nichts anderes als ein Postulat an die Zukunft, denn einer solchen wissen-
schaftlich fundierten Kultur farbiger und malerischer Empfänglichkeit stellen sich
heute noch unübersteigbare Schwierigkeiten entgegen. Nur für die Elementarfragen
der Farbenzusammenstellung stellt die experimentelle Psychologie uns ihre Erfahrungen