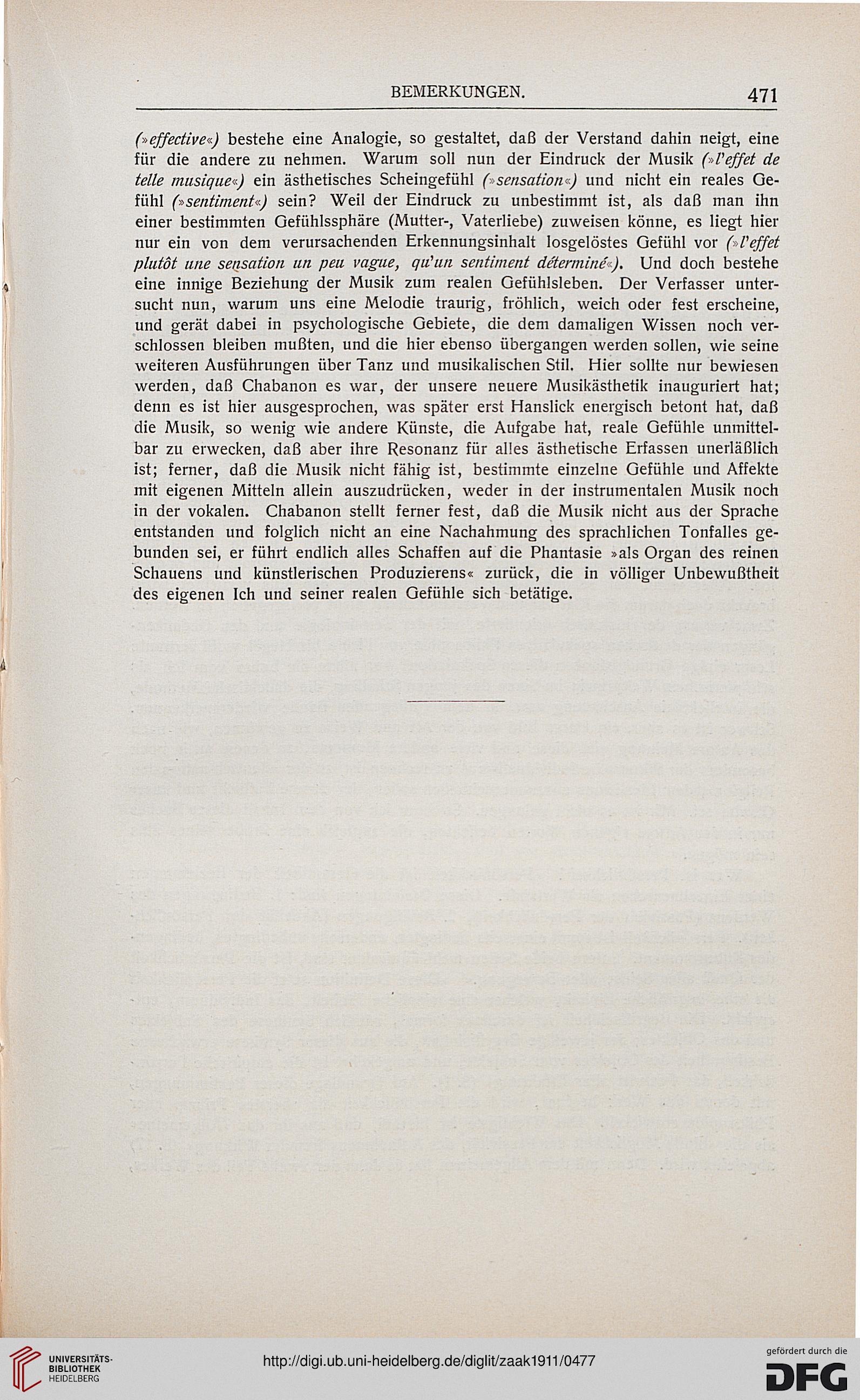BEMERKUNGEN. 471
(»effecHve*) bestehe eine Analogie, so gestaltet, daß der Verstand dahin neigt, eine
für die andere zu nehmen. Warum soll nun der Eindruck der Musik (»reffet de
teile musique*) ein ästhetisches Scheingefühl (sensatioiuj und nicht ein reales Ge-
fühl (»sentiment«) sein? Weil der Eindruck zu unbestimmt ist, als daß man ihn
einer bestimmten Gefühlssphäre (Mutter-, Vaterliebe) zuweisen könne, es liegt hier
nur ein von dem verursachenden Erkennungsinhalt losgelöstes Gefühl vor (»Veffet
plutöt une Sensation un peu vague, qu'un scntiment detennine). Und doch bestehe
eine innige Beziehung der Musik zum realen Gefühlsleben. Der Verfasser unter-
sucht nun, warum uns eine Melodie traurig, fröhlich, weich oder fest erscheine,
und gerät dabei in psychologische Gebiete, die dem damaligen Wissen noch ver-
schlossen bleiben mußten, und die hier ebenso übergangen werden sollen, wie seine
weiteren Ausführungen über Tanz und musikalischen Stil. Hier sollte nur bewiesen
werden, daß Chabanon es war, der unsere neuere Musikästhetik inauguriert hat;
denn es ist hier ausgesprochen, was später erst Hanslick energisch betont hat, daß
die Musik, so wenig wie andere Künste, die Aufgabe hat, reale Gefühle unmittel-
bar zu erwecken, daß aber ihre Resonanz für alles ästhetische Erfassen unerläßlich
ist; ferner, daß die Musik nicht fähig ist, bestimmte einzelne Gefühle und Affekte
mit eigenen Mitteln allein auszudrücken, weder in der instrumentalen Musik noch
in der vokalen. Chabanon stellt ferner fest, daß die Musik nicht aus der Sprache
entstanden und folglich nicht an eine Nachahmung des sprachlichen Tonfalles ge-
bunden sei, er führt endlich alles Schaffen auf die Phantasie »als Organ des reinen
Schauens und künstlerischen Produzierens« zurück, die in völliger Unbewußtheit
des eigenen Ich und seiner realen Gefühle sich betätige.
(»effecHve*) bestehe eine Analogie, so gestaltet, daß der Verstand dahin neigt, eine
für die andere zu nehmen. Warum soll nun der Eindruck der Musik (»reffet de
teile musique*) ein ästhetisches Scheingefühl (sensatioiuj und nicht ein reales Ge-
fühl (»sentiment«) sein? Weil der Eindruck zu unbestimmt ist, als daß man ihn
einer bestimmten Gefühlssphäre (Mutter-, Vaterliebe) zuweisen könne, es liegt hier
nur ein von dem verursachenden Erkennungsinhalt losgelöstes Gefühl vor (»Veffet
plutöt une Sensation un peu vague, qu'un scntiment detennine). Und doch bestehe
eine innige Beziehung der Musik zum realen Gefühlsleben. Der Verfasser unter-
sucht nun, warum uns eine Melodie traurig, fröhlich, weich oder fest erscheine,
und gerät dabei in psychologische Gebiete, die dem damaligen Wissen noch ver-
schlossen bleiben mußten, und die hier ebenso übergangen werden sollen, wie seine
weiteren Ausführungen über Tanz und musikalischen Stil. Hier sollte nur bewiesen
werden, daß Chabanon es war, der unsere neuere Musikästhetik inauguriert hat;
denn es ist hier ausgesprochen, was später erst Hanslick energisch betont hat, daß
die Musik, so wenig wie andere Künste, die Aufgabe hat, reale Gefühle unmittel-
bar zu erwecken, daß aber ihre Resonanz für alles ästhetische Erfassen unerläßlich
ist; ferner, daß die Musik nicht fähig ist, bestimmte einzelne Gefühle und Affekte
mit eigenen Mitteln allein auszudrücken, weder in der instrumentalen Musik noch
in der vokalen. Chabanon stellt ferner fest, daß die Musik nicht aus der Sprache
entstanden und folglich nicht an eine Nachahmung des sprachlichen Tonfalles ge-
bunden sei, er führt endlich alles Schaffen auf die Phantasie »als Organ des reinen
Schauens und künstlerischen Produzierens« zurück, die in völliger Unbewußtheit
des eigenen Ich und seiner realen Gefühle sich betätige.