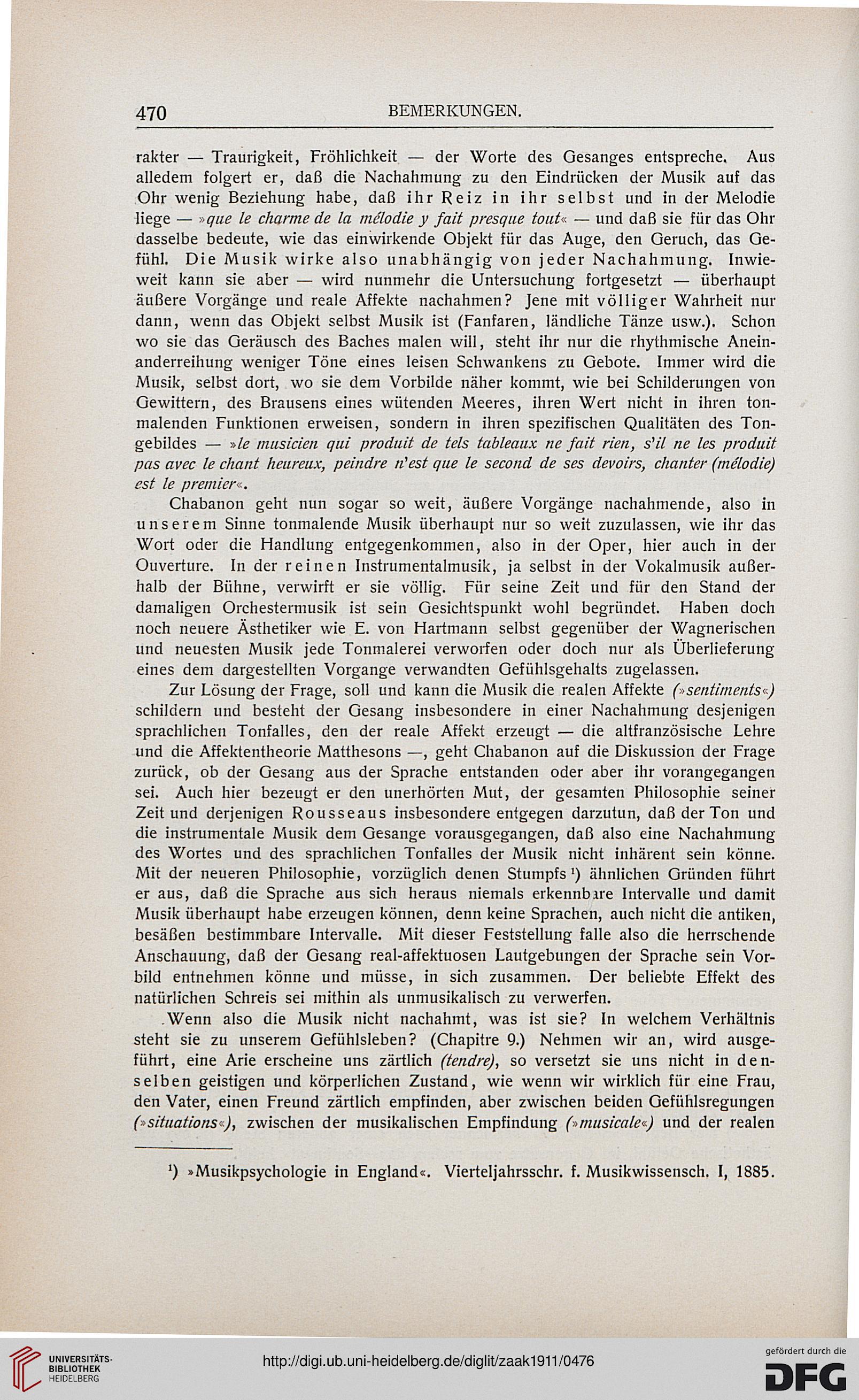470 BEMERKUNGEN.
rakter — Traurigkeit, Fröhlichkeit — der Worte des Gesanges entspreche. Aus
alledem folgert er, daß die Nachahmung zu den Eindrücken der Musik auf das
Ohr wenig Beziehung habe, daß ihr Reiz in ihr selbst und in der Melodie
liege — »que le charme de la melodie y fait presque tout«. — und daß sie für das Ohr
dasselbe bedeute, wie das einwirkende Objekt für das Auge, den Geruch, das Ge-
fühl. Die Musik wirke also unabhängig von jeder Nachahmung. Inwie-
weit kann sie aber — wird nunmehr die Untersuchung fortgesetzt — überhaupt
äußere Vorgänge und reale Affekte nachahmen? Jene mit völliger Wahrheit nur
dann, wenn das Objekt selbst Musik ist (Fanfaren, ländliche Tänze usw.). Schon
wo sie das Geräusch des Baches malen will, steht ihr nur die rhythmische Anein-
anderreihung weniger Töne eines leisen Schwankens zu Gebote. Immer wird die
Musik, selbst dort, wo sie dem Vorbilde näher kommt, wie bei Schilderungen von
Gewittern, des Brausens eines wütenden Meeres, ihren Wert nicht in ihren ton-
malenden Funktionen erweisen, sondern in ihren spezifischen Qualitäten des Ton-
gebildes — T>le musicien qui produit de tels tableaux ne fait rien, s'il ne les produit
pas avec le chant heureux, peindre n'est que le second de ses devoirs, chanter (melodie)
est le premier*.
Chabanon geht nun sogar so weit, äußere Vorgänge nachahmende, also in
unserem Sinne tonmalende Musik überhaupt nur so weit zuzulassen, wie ihr das
Wort oder die Handlung entgegenkommen, also in der Oper, hier auch in der
Ouvertüre. In der reinen Instrumentalmusik, ja selbst in der Vokalmusik außer-
halb der Bühne, verwirft er sie völlig. Für seine Zeit und für den Stand der
damaligen Orchestermusik ist sein Gesichtspunkt wohl begründet. Haben doch
noch neuere Ästhetiker wie E. von Hartmann selbst gegenüber der Wagnerischen
und neuesten Musik jede Tonmalerei verworfen oder doch nur als Überlieferung
eines dem dargestellten Vorgange verwandten Gefühlsgehalts zugelassen.
Zur Lösung der Frage, soll und kann die Musik die realen Affekte (»sentiments*)
schildern und besteht der Gesang insbesondere in einer Nachahmung desjenigen
sprachlichen Tonfalles, den der reale Affekt erzeugt — die altfranzösische Lehre
und die Affektentheorie Matthesons —, geht Chabanon auf die Diskussion der Frage
zurück, ob der Gesang aus der Sprache entstanden oder aber ihr vorangegangen
sei. Auch hier bezeugt er den unerhörten Mut, der gesamten Philosophie seiner
Zeit und derjenigen Rousseaus insbesondere entgegen darzutun, daß der Ton und
die instrumentale Musik dem Gesänge vorausgegangen, daß also eine Nachahmung
des Wortes und des sprachlichen Tonfalles der Musik nicht inhärent sein könne.
Mit der neueren Philosophie, vorzüglich denen Stumpfs1) ähnlichen Gründen führt
er aus, daß die Sprache aus sich heraus niemals erkennbire Intervalle und damit
Musik überhaupt habe erzeugen können, denn keine Sprachen, auch nicht die antiken,
besäßen bestimmbare Intervalle. Mit dieser Feststellung falle also die herrschende
Anschauung, daß der Gesang real-affektuosen Lautgebungen der Sprache sein Vor-
bild entnehmen könne und müsse, in sich zusammen. Der beliebte Effekt des
natürlichen Schreis sei mithin als unmusikalisch zu verwerfen.
Wenn also die Musik nicht nachahmt, was ist sie? In welchem Verhältnis
steht sie zu unserem Gefühlsleben? (Chapitre 9.) Nehmen wir an, wird ausge-
führt, eine Arie erscheine uns zärtlich ftendre), so versetzt sie uns nicht in den-
selben geistigen und körperlichen Zustand, wie wenn wir wirklich für eine Frau,
den Vater, einen Freund zärtlich empfinden, aber zwischen beiden Gefühlsregungen
(*situations<), zwischen der musikalischen Empfindung (»musicale«-) und der realen
') »Musikpsychologie in England«. Vierteljahrsschr. f. Musikwissensch. I, 1885.
rakter — Traurigkeit, Fröhlichkeit — der Worte des Gesanges entspreche. Aus
alledem folgert er, daß die Nachahmung zu den Eindrücken der Musik auf das
Ohr wenig Beziehung habe, daß ihr Reiz in ihr selbst und in der Melodie
liege — »que le charme de la melodie y fait presque tout«. — und daß sie für das Ohr
dasselbe bedeute, wie das einwirkende Objekt für das Auge, den Geruch, das Ge-
fühl. Die Musik wirke also unabhängig von jeder Nachahmung. Inwie-
weit kann sie aber — wird nunmehr die Untersuchung fortgesetzt — überhaupt
äußere Vorgänge und reale Affekte nachahmen? Jene mit völliger Wahrheit nur
dann, wenn das Objekt selbst Musik ist (Fanfaren, ländliche Tänze usw.). Schon
wo sie das Geräusch des Baches malen will, steht ihr nur die rhythmische Anein-
anderreihung weniger Töne eines leisen Schwankens zu Gebote. Immer wird die
Musik, selbst dort, wo sie dem Vorbilde näher kommt, wie bei Schilderungen von
Gewittern, des Brausens eines wütenden Meeres, ihren Wert nicht in ihren ton-
malenden Funktionen erweisen, sondern in ihren spezifischen Qualitäten des Ton-
gebildes — T>le musicien qui produit de tels tableaux ne fait rien, s'il ne les produit
pas avec le chant heureux, peindre n'est que le second de ses devoirs, chanter (melodie)
est le premier*.
Chabanon geht nun sogar so weit, äußere Vorgänge nachahmende, also in
unserem Sinne tonmalende Musik überhaupt nur so weit zuzulassen, wie ihr das
Wort oder die Handlung entgegenkommen, also in der Oper, hier auch in der
Ouvertüre. In der reinen Instrumentalmusik, ja selbst in der Vokalmusik außer-
halb der Bühne, verwirft er sie völlig. Für seine Zeit und für den Stand der
damaligen Orchestermusik ist sein Gesichtspunkt wohl begründet. Haben doch
noch neuere Ästhetiker wie E. von Hartmann selbst gegenüber der Wagnerischen
und neuesten Musik jede Tonmalerei verworfen oder doch nur als Überlieferung
eines dem dargestellten Vorgange verwandten Gefühlsgehalts zugelassen.
Zur Lösung der Frage, soll und kann die Musik die realen Affekte (»sentiments*)
schildern und besteht der Gesang insbesondere in einer Nachahmung desjenigen
sprachlichen Tonfalles, den der reale Affekt erzeugt — die altfranzösische Lehre
und die Affektentheorie Matthesons —, geht Chabanon auf die Diskussion der Frage
zurück, ob der Gesang aus der Sprache entstanden oder aber ihr vorangegangen
sei. Auch hier bezeugt er den unerhörten Mut, der gesamten Philosophie seiner
Zeit und derjenigen Rousseaus insbesondere entgegen darzutun, daß der Ton und
die instrumentale Musik dem Gesänge vorausgegangen, daß also eine Nachahmung
des Wortes und des sprachlichen Tonfalles der Musik nicht inhärent sein könne.
Mit der neueren Philosophie, vorzüglich denen Stumpfs1) ähnlichen Gründen führt
er aus, daß die Sprache aus sich heraus niemals erkennbire Intervalle und damit
Musik überhaupt habe erzeugen können, denn keine Sprachen, auch nicht die antiken,
besäßen bestimmbare Intervalle. Mit dieser Feststellung falle also die herrschende
Anschauung, daß der Gesang real-affektuosen Lautgebungen der Sprache sein Vor-
bild entnehmen könne und müsse, in sich zusammen. Der beliebte Effekt des
natürlichen Schreis sei mithin als unmusikalisch zu verwerfen.
Wenn also die Musik nicht nachahmt, was ist sie? In welchem Verhältnis
steht sie zu unserem Gefühlsleben? (Chapitre 9.) Nehmen wir an, wird ausge-
führt, eine Arie erscheine uns zärtlich ftendre), so versetzt sie uns nicht in den-
selben geistigen und körperlichen Zustand, wie wenn wir wirklich für eine Frau,
den Vater, einen Freund zärtlich empfinden, aber zwischen beiden Gefühlsregungen
(*situations<), zwischen der musikalischen Empfindung (»musicale«-) und der realen
') »Musikpsychologie in England«. Vierteljahrsschr. f. Musikwissensch. I, 1885.