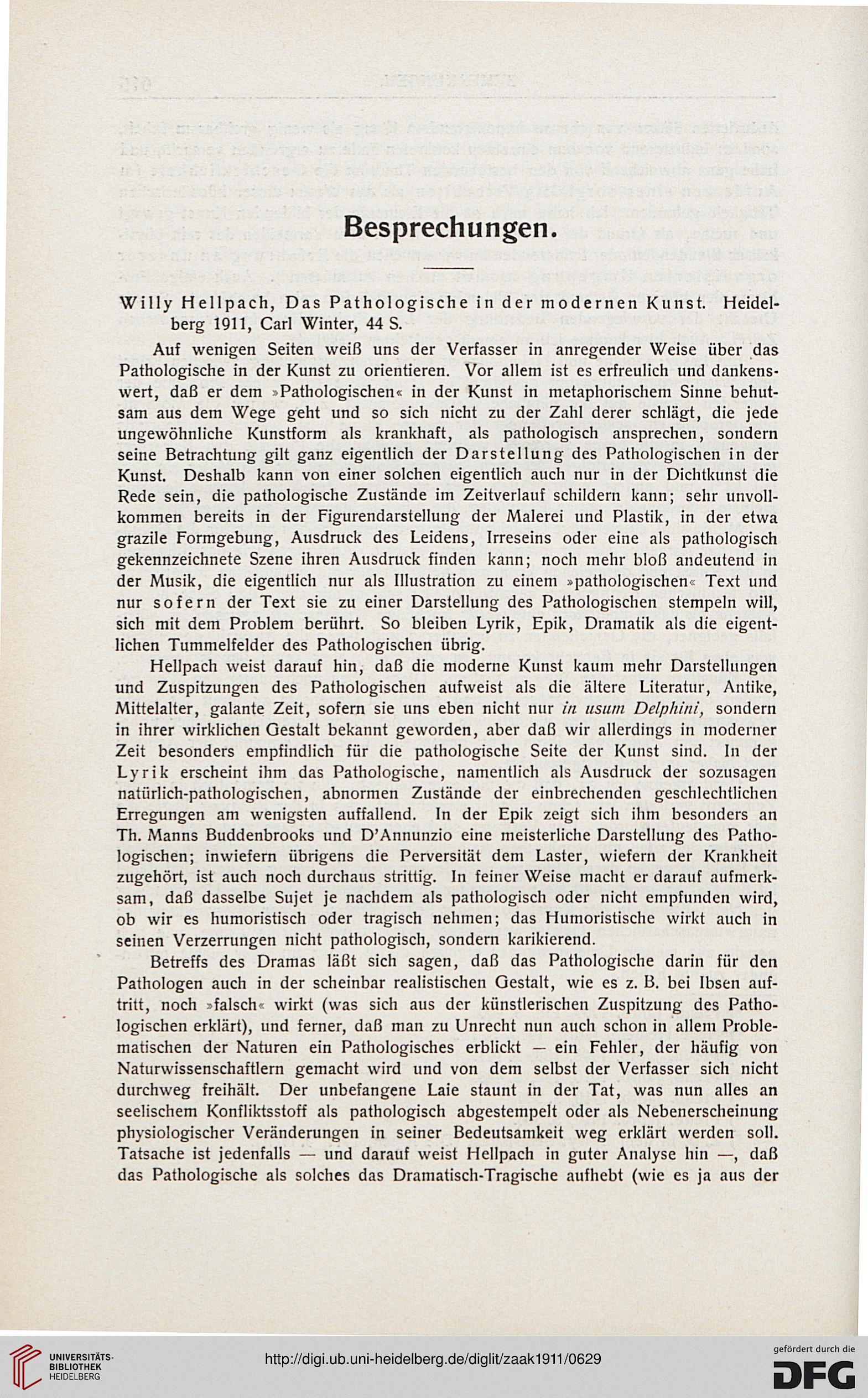Besprechungen.
Willy Hellpach, Das Pathologische in der modernen Kunst. Heidel-
berg 1911, Carl Winter, 44 S.
Auf wenigen Seiten weiß uns der Verfasser in anregender Weise über das
Pathologische in der Kunst zu orientieren. Vor allem ist es erfreulich und dankens-
wert, daß er dem »Pathologischen« in der Kunst in metaphorischem Sinne behut-
sam aus dem Wege geht und so sich nicht zu der Zahl derer schlägt, die jede
ungewöhnliche Kunstform als krankhaft, als pathologisch ansprechen, sondern
seine Betrachtung gilt ganz eigentlich der Darstellung des Pathologischen in der
Kunst. Deshalb kann von einer solchen eigentlich auch nur in der Dichtkunst die
Rede sein, die pathologische Zustände im Zeitverlauf schildern kann; sehr unvoll-
kommen bereits in der Figurendarstellung der Malerei und Plastik, in der etwa
grazile Formgebung, Ausdruck des Leidens, Irreseins oder eine als pathologisch
gekennzeichnete Szene ihren Ausdruck finden kann; noch mehr bloß andeutend in
der Musik, die eigentlich nur als Illustration zu einem »pathologischen Text und
nur sofern der Text sie zu einer Darstellung des Pathologischen stempeln will,
sich mit dem Problem berührt. So bleiben Lyrik, Epik, Dramatik als die eigent-
lichen Tummelfelder des Pathologischen übrig.
Hellpach weist darauf hin, daß die moderne Kunst kaum mehr Darstellungen
und Zuspitzungen des Pathologischen aufweist als die ältere Literatur, Antike,
Mittelalter, galante Zeit, sofern sie uns eben nicht nur in usum Delphini, sondern
in ihrer wirklichen Gestalt bekannt geworden, aber daß wir allerdings in moderner
Zeit besonders empfindlich für die pathologische Seite der Kunst sind. In der
Lyrik erscheint ihm das Pathologische, namentlich als Ausdruck der sozusagen
natürlich-pathologischen, abnormen Zustände der einbrechenden geschlechtlichen
Erregungen am wenigsten auffallend. In der Epik zeigt sich ihm besonders an
Th. Manns Buddenbrooks und D'Annunzio eine meisterliche Darstellung des Patho-
logischen; inwiefern übrigens die Perversität dem Laster, wiefern der Krankheit
zugehört, ist auch noch durchaus strittig. In feiner Weise macht er darauf aufmerk-
sam, daß dasselbe Sujet je nachdem als pathologisch oder nicht empfunden wird,
ob wir es humoristisch oder tragisch nehmen; das Humoristische wirkt auch in
seinen Verzerrungen nicht pathologisch, sondern karikierend.
Betreffs des Dramas läßt sich sagen, daß das Pathologische darin für den
Pathologen auch in der scheinbar realistischen Gestalt, wie es z. B. bei Ibsen auf-
tritt, noch ^falsch« wirkt (was sich aus der künstlerischen Zuspitzung des Patho-
logischen erklärt), und ferner, daß man zu Unrecht nun auch schon in allem Proble-
matischen der Naturen ein Pathologisches erblickt — ein Fehler, der häufig von
Naturwissenschaftlern gemacht wird und von dem selbst der Verfasser sich nicht
durchweg freihält. Der unbefangene Laie staunt in der Tat, was nun alles an
seelischem Konfliktsstoff als pathologisch abgestempelt oder als Nebenerscheinung
physiologischer Veränderungen in seiner Bedeutsamkeit weg erklärt werden soll.
Tatsache ist jedenfalls — und darauf weist Hellpach in guter Analyse hin —, daß
das Pathologische als solches das Dramatisch-Tragische aufhebt (wie es ja aus der
Willy Hellpach, Das Pathologische in der modernen Kunst. Heidel-
berg 1911, Carl Winter, 44 S.
Auf wenigen Seiten weiß uns der Verfasser in anregender Weise über das
Pathologische in der Kunst zu orientieren. Vor allem ist es erfreulich und dankens-
wert, daß er dem »Pathologischen« in der Kunst in metaphorischem Sinne behut-
sam aus dem Wege geht und so sich nicht zu der Zahl derer schlägt, die jede
ungewöhnliche Kunstform als krankhaft, als pathologisch ansprechen, sondern
seine Betrachtung gilt ganz eigentlich der Darstellung des Pathologischen in der
Kunst. Deshalb kann von einer solchen eigentlich auch nur in der Dichtkunst die
Rede sein, die pathologische Zustände im Zeitverlauf schildern kann; sehr unvoll-
kommen bereits in der Figurendarstellung der Malerei und Plastik, in der etwa
grazile Formgebung, Ausdruck des Leidens, Irreseins oder eine als pathologisch
gekennzeichnete Szene ihren Ausdruck finden kann; noch mehr bloß andeutend in
der Musik, die eigentlich nur als Illustration zu einem »pathologischen Text und
nur sofern der Text sie zu einer Darstellung des Pathologischen stempeln will,
sich mit dem Problem berührt. So bleiben Lyrik, Epik, Dramatik als die eigent-
lichen Tummelfelder des Pathologischen übrig.
Hellpach weist darauf hin, daß die moderne Kunst kaum mehr Darstellungen
und Zuspitzungen des Pathologischen aufweist als die ältere Literatur, Antike,
Mittelalter, galante Zeit, sofern sie uns eben nicht nur in usum Delphini, sondern
in ihrer wirklichen Gestalt bekannt geworden, aber daß wir allerdings in moderner
Zeit besonders empfindlich für die pathologische Seite der Kunst sind. In der
Lyrik erscheint ihm das Pathologische, namentlich als Ausdruck der sozusagen
natürlich-pathologischen, abnormen Zustände der einbrechenden geschlechtlichen
Erregungen am wenigsten auffallend. In der Epik zeigt sich ihm besonders an
Th. Manns Buddenbrooks und D'Annunzio eine meisterliche Darstellung des Patho-
logischen; inwiefern übrigens die Perversität dem Laster, wiefern der Krankheit
zugehört, ist auch noch durchaus strittig. In feiner Weise macht er darauf aufmerk-
sam, daß dasselbe Sujet je nachdem als pathologisch oder nicht empfunden wird,
ob wir es humoristisch oder tragisch nehmen; das Humoristische wirkt auch in
seinen Verzerrungen nicht pathologisch, sondern karikierend.
Betreffs des Dramas läßt sich sagen, daß das Pathologische darin für den
Pathologen auch in der scheinbar realistischen Gestalt, wie es z. B. bei Ibsen auf-
tritt, noch ^falsch« wirkt (was sich aus der künstlerischen Zuspitzung des Patho-
logischen erklärt), und ferner, daß man zu Unrecht nun auch schon in allem Proble-
matischen der Naturen ein Pathologisches erblickt — ein Fehler, der häufig von
Naturwissenschaftlern gemacht wird und von dem selbst der Verfasser sich nicht
durchweg freihält. Der unbefangene Laie staunt in der Tat, was nun alles an
seelischem Konfliktsstoff als pathologisch abgestempelt oder als Nebenerscheinung
physiologischer Veränderungen in seiner Bedeutsamkeit weg erklärt werden soll.
Tatsache ist jedenfalls — und darauf weist Hellpach in guter Analyse hin —, daß
das Pathologische als solches das Dramatisch-Tragische aufhebt (wie es ja aus der