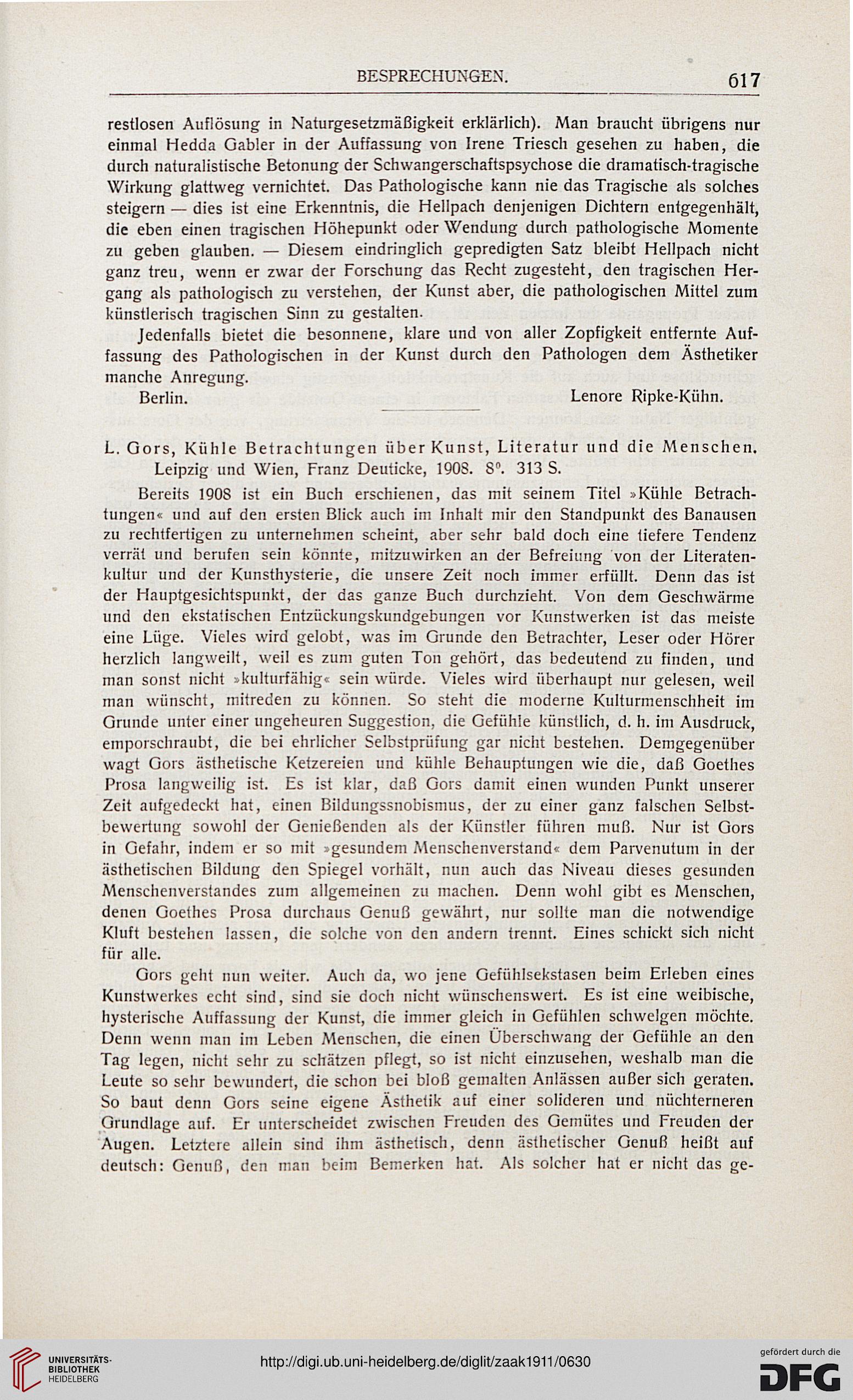BESPRECHUNGEN. 517
restlosen Auflösung in Naturgesetzmäßigkeit erklärlich). Man braucht übrigens nur
einmal Hedda Gabler in der Auffassung von Irene Triesch gesehen zu haben, die
durch naturalistische Betonung der Schwangerschaftspsychose die dramatisch-tragische
Wirkung glattweg vernichtet. Das Pathologische kann nie das Tragische als solches
steigern — dies ist eine Erkenntnis, die Hellpach denjenigen Dichtern entgegenhält,
die eben einen tragischen Höhepunkt oder Wendung durch pathologische Momente
zu geben glauben. — Diesem eindringlich gepredigten Satz bleibt Hellpach nicht
ganz treu, wenn er zwar der Forschung das Recht zugesteht, den tragischen Her-
gang als pathologisch zu verstehen, der Kunst aber, die pathologischen Mittel zum
künstlerisch tragischen Sinn zu gestalten.
Jedenfalls bietet die besonnene, klare und von aller Zopfigkeit entfernte Auf-
fassung des Pathologischen in der Kunst durch den Pathologen dem Ästhetiker
manche Anregung.
Berlin. Lenore Ripke-Kühn.
L. Gors, Kühle Betrachtungen über Kunst, Literatur und die Menschen.
Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1908. 8°. 313 S.
Bereits 190S ist ein Buch erschienen, das mit seinem Titel »Kühle Betrach-
tungen« und auf den ersten Blick auch im Inhalt mir den Standpunkt des Banausen
zu rechtfertigen zu unternehmen scheint, aber sehr bald doch eine tiefere Tendenz
verrät und berufen sein könnte, mitzuwirken an der Befreiung von der Literaten-
kultur und der Kunsthysterie, die unsere Zeit noch immer erfüllt. Denn das ist
der Hauptgesichtspunkt, der das ganze Buch durchzieht. Von dem Geschwärme
und den ekstatischen Entzückungskundgebungen vor Kunstwerken ist das meiste
eine Lüge. Vieles wird gelobt, was im Grunde den Betrachter, Leser oder Hörer
herzlich langweilt, weil es zum guten Ton gehört, das bedeutend zu finden, und
man sonst nicht »kulturfähigc sein würde. Vieles wird überhaupt mir gelesen, weil
man wünscht, mitreden zu können. So steht die moderne Kulturmenschheit im
Grunde unter einer ungeheuren Suggestion, die Gefühle künstlich, d. h. im Ausdruck,
emporschraubt, die bei ehrlicher Selbstprüfung gar nicht bestehen. Demgegenüber
wagt Gors ästhetische Ketzereien und kühle Behauptungen wie die, daß Goethes
Prosa langweilig ist. Es ist klar, daß Gors damit einen wunden Punkt unserer
Zeit aufgedeckt hat, einen Bildungssnobismus, der zu einer ganz falschen Selbst-
bewertung sowohl der Genießenden als der Künstler führen muß. Nur ist Gors
in Gefahr, indem er so mit »gesundem Menschenverstand« dem Parveiiufum in der
ästhetischen Bildung den Spiegel vorhält, nun auch das Niveau dieses gesunden
Menschenverstandes zum allgemeinen zu machen. Denn wohl gibt es Menschen,
denen Goethes Prosa durchaus Genuß gewährt, nur sollte man die notwendige
Kluft bestehen lassen, die solche von den andern trennt. Eines schickt sich nicht
für alle.
Gors geht nun weiter. Auch da, wo jene Gefühlsekstasen beim Erleben eines
Kunstwerkes echt sind, sind sie doch nicht wünschenswert. Es ist eine weibische,
hysterische Auffassung der Kunst, die immer gleich in Gefühlen schwelgen möchte.
Denn wenn man im Leben Menschen, die einen Überschwang der Gefühle an den
Tag legen, nicht sehr zu schätzen pflegt, so ist nicht einzusehen, weshalb man die
Leute so sehr bewundert, die schon bei bloß gemalten Anlässen außer sich geraten.
So baut denn Gors seine eigene Ästhetik auf einer solideren und nüchterneren
Grundlage auf. Er unterscheidet zwischen Freuden des Gemütes und Freuden der
Augen. Letztere allein sind ihm ästhetisch, denn ästhetischer Genuß heißt auf
deutsch: Genuß, den man beim Bemerken hat. Als solcher hat er nicht das ge-
restlosen Auflösung in Naturgesetzmäßigkeit erklärlich). Man braucht übrigens nur
einmal Hedda Gabler in der Auffassung von Irene Triesch gesehen zu haben, die
durch naturalistische Betonung der Schwangerschaftspsychose die dramatisch-tragische
Wirkung glattweg vernichtet. Das Pathologische kann nie das Tragische als solches
steigern — dies ist eine Erkenntnis, die Hellpach denjenigen Dichtern entgegenhält,
die eben einen tragischen Höhepunkt oder Wendung durch pathologische Momente
zu geben glauben. — Diesem eindringlich gepredigten Satz bleibt Hellpach nicht
ganz treu, wenn er zwar der Forschung das Recht zugesteht, den tragischen Her-
gang als pathologisch zu verstehen, der Kunst aber, die pathologischen Mittel zum
künstlerisch tragischen Sinn zu gestalten.
Jedenfalls bietet die besonnene, klare und von aller Zopfigkeit entfernte Auf-
fassung des Pathologischen in der Kunst durch den Pathologen dem Ästhetiker
manche Anregung.
Berlin. Lenore Ripke-Kühn.
L. Gors, Kühle Betrachtungen über Kunst, Literatur und die Menschen.
Leipzig und Wien, Franz Deuticke, 1908. 8°. 313 S.
Bereits 190S ist ein Buch erschienen, das mit seinem Titel »Kühle Betrach-
tungen« und auf den ersten Blick auch im Inhalt mir den Standpunkt des Banausen
zu rechtfertigen zu unternehmen scheint, aber sehr bald doch eine tiefere Tendenz
verrät und berufen sein könnte, mitzuwirken an der Befreiung von der Literaten-
kultur und der Kunsthysterie, die unsere Zeit noch immer erfüllt. Denn das ist
der Hauptgesichtspunkt, der das ganze Buch durchzieht. Von dem Geschwärme
und den ekstatischen Entzückungskundgebungen vor Kunstwerken ist das meiste
eine Lüge. Vieles wird gelobt, was im Grunde den Betrachter, Leser oder Hörer
herzlich langweilt, weil es zum guten Ton gehört, das bedeutend zu finden, und
man sonst nicht »kulturfähigc sein würde. Vieles wird überhaupt mir gelesen, weil
man wünscht, mitreden zu können. So steht die moderne Kulturmenschheit im
Grunde unter einer ungeheuren Suggestion, die Gefühle künstlich, d. h. im Ausdruck,
emporschraubt, die bei ehrlicher Selbstprüfung gar nicht bestehen. Demgegenüber
wagt Gors ästhetische Ketzereien und kühle Behauptungen wie die, daß Goethes
Prosa langweilig ist. Es ist klar, daß Gors damit einen wunden Punkt unserer
Zeit aufgedeckt hat, einen Bildungssnobismus, der zu einer ganz falschen Selbst-
bewertung sowohl der Genießenden als der Künstler führen muß. Nur ist Gors
in Gefahr, indem er so mit »gesundem Menschenverstand« dem Parveiiufum in der
ästhetischen Bildung den Spiegel vorhält, nun auch das Niveau dieses gesunden
Menschenverstandes zum allgemeinen zu machen. Denn wohl gibt es Menschen,
denen Goethes Prosa durchaus Genuß gewährt, nur sollte man die notwendige
Kluft bestehen lassen, die solche von den andern trennt. Eines schickt sich nicht
für alle.
Gors geht nun weiter. Auch da, wo jene Gefühlsekstasen beim Erleben eines
Kunstwerkes echt sind, sind sie doch nicht wünschenswert. Es ist eine weibische,
hysterische Auffassung der Kunst, die immer gleich in Gefühlen schwelgen möchte.
Denn wenn man im Leben Menschen, die einen Überschwang der Gefühle an den
Tag legen, nicht sehr zu schätzen pflegt, so ist nicht einzusehen, weshalb man die
Leute so sehr bewundert, die schon bei bloß gemalten Anlässen außer sich geraten.
So baut denn Gors seine eigene Ästhetik auf einer solideren und nüchterneren
Grundlage auf. Er unterscheidet zwischen Freuden des Gemütes und Freuden der
Augen. Letztere allein sind ihm ästhetisch, denn ästhetischer Genuß heißt auf
deutsch: Genuß, den man beim Bemerken hat. Als solcher hat er nicht das ge-