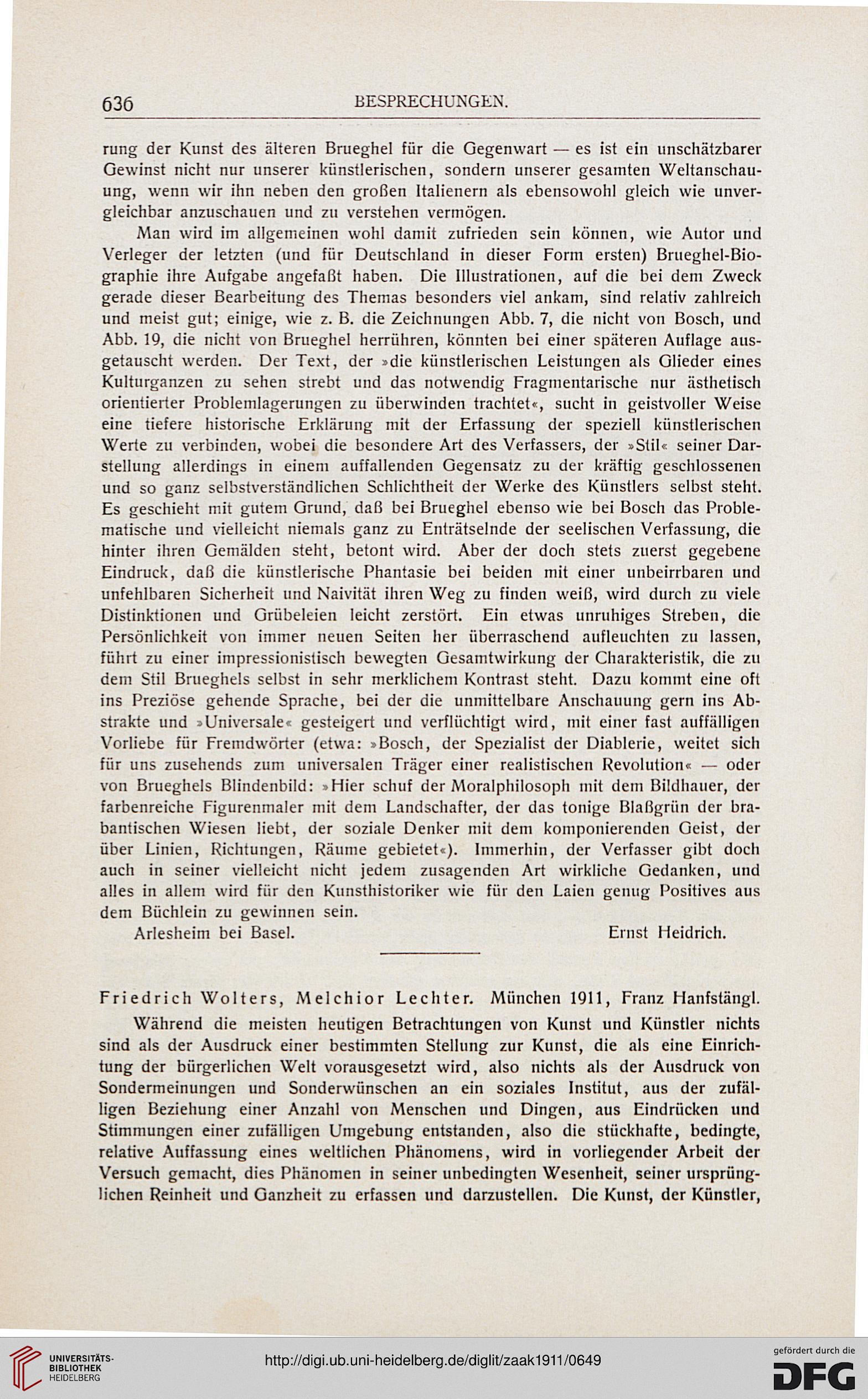636 BESPRECHUNGEN.
rung der Kunst des älteren Brueghel für die Gegenwart — es ist ein unschätzbarer
Gewinst nicht nur unserer künstlerischen, sondern unserer gesamten Weltanschau-
ung, wenn wir ihn neben den großen Italienern als ebensowohl gleich wie unver-
gleichbar anzuschauen und zu verstehen vermögen.
Man wird im allgemeinen wohl damit zufrieden sein können, wie Autor und
Verleger der letzten (und für Deutschland in dieser Form ersten) Brueghel-Bio-
graphie ihre Aufgabe angefaßt haben. Die Illustrationen, auf die bei dem Zweck
gerade dieser Bearbeitung des Themas besonders viel ankam, sind relativ zahlreich
und meist gut; einige, wie z. B. die Zeichnungen Abb. 7, die nicht von Bosch, und
Abb. 19, die nicht von Brueghel herrühren, könnten bei einer späteren Auflage aus-
getauscht werden. Der Text, der »die künstlerischen Leistungen als Glieder eines
Kulturganzen zu sehen strebt und das notwendig Fragmentarische nur ästhetisch
orientierter Problemlagerungen zu überwinden trachtet«, sucht in geistvoller Weise
eine tiefere historische Erklärung mit der Erfassung der speziell künstlerischen
Werte zu verbinden, wobei die besondere Art des Verfassers, der »Stil« seiner Dar-
stellung allerdings in einem auffallenden Gegensatz zu der kräftig geschlossenen
und so ganz selbstverständlichen Schlichtheit der Werke des Künstlers selbst steht.
Es geschieht mit gutem Grund, daß bei Brueghel ebenso wie bei Bosch das Proble-
matische und vielleicht niemals ganz zu Enträtselnde der seelischen Verfassung, die
hinter ihren Gemälden steht, betont wird. Aber der doch stets zuerst gegebene
Eindruck, daß die künstlerische Phantasie bei beiden mit einer unbeirrbaren und
unfehlbaren Sicherheit und Naivität ihren Weg zu finden weiß, wird durch zu viele
Distinktionen und Grübeleien leicht zerstört. Ein etwas unruhiges Streben, die
Persönlichkeit von immer neuen Seiten her überraschend aufleuchten zu lassen,
führt zu einer impressionistisch bewegten Gesamtwirkung der Charakteristik, die zu
dem Stil Brueghels selbst in sehr merklichem Kontrast steht. Dazu kommt eine oft
ins Preziöse gehende Sprache, bei der die unmittelbare Anschauung gern ins Ab-
strakte und »Universale« gesteigert und verflüchtigt wird, mit einer fast auffälligen
Vorliebe für Fremdwörter (etwa: »Bosch, der Spezialist der Diablerie, weitet sich
für uns zusehends zum universalen Träger einer realistischen Revolution« — oder
von Brueghels Blindenbild: »Hier schuf der Moralphilosoph mit dem Bildhauer, der
farbenreiche Figurenmaler mit dem Landschafter, der das tonige Blaßgrün der bra-
bantischen Wiesen liebt, der soziale Denker mit dem komponierenden Geist, der
über Linien, Richtungen, Räume gebietet«). Immerhin, der Verfasser gibt doch
auch in seiner vielleicht nicht jedem zusagenden Art wirkliche Gedanken, und
alles in allem wird für den Kunsthistoriker wie für den Laien genug Positives aus
dem Büchlein zu gewinnen sein.
Ariesheim bei Basel. Ernst Heidrich.
Friedrich Wolters, Melchior Lechter. München 1911, Franz Hanfstängl.
Während die meisten heutigen Betrachtungen von Kunst und Künstler nichts
sind als der Ausdruck einer bestimmten Stellung zur Kunst, die als eine Einrich-
tung der bürgerlichen Welt vorausgesetzt wird, also nichts als der Ausdruck von
Sondermeinungen und Sonderwünschen an ein soziales Institut, aus der zufäl-
ligen Beziehung einer Anzahl von Menschen und Dingen, aus Eindrücken und
Stimmungen einer zufälligen Umgebung entstanden, also die stückhafte, bedingte,
relative Auffassung eines weltlichen Phänomens, wird in vorliegender Arbeit der
Versuch gemacht, dies Phänomen in seiner unbedingten Wesenheit, seiner ursprüng-
lichen Reinheit und Ganzheit zu erfassen und darzustellen. Die Kunst, der Künstler,
rung der Kunst des älteren Brueghel für die Gegenwart — es ist ein unschätzbarer
Gewinst nicht nur unserer künstlerischen, sondern unserer gesamten Weltanschau-
ung, wenn wir ihn neben den großen Italienern als ebensowohl gleich wie unver-
gleichbar anzuschauen und zu verstehen vermögen.
Man wird im allgemeinen wohl damit zufrieden sein können, wie Autor und
Verleger der letzten (und für Deutschland in dieser Form ersten) Brueghel-Bio-
graphie ihre Aufgabe angefaßt haben. Die Illustrationen, auf die bei dem Zweck
gerade dieser Bearbeitung des Themas besonders viel ankam, sind relativ zahlreich
und meist gut; einige, wie z. B. die Zeichnungen Abb. 7, die nicht von Bosch, und
Abb. 19, die nicht von Brueghel herrühren, könnten bei einer späteren Auflage aus-
getauscht werden. Der Text, der »die künstlerischen Leistungen als Glieder eines
Kulturganzen zu sehen strebt und das notwendig Fragmentarische nur ästhetisch
orientierter Problemlagerungen zu überwinden trachtet«, sucht in geistvoller Weise
eine tiefere historische Erklärung mit der Erfassung der speziell künstlerischen
Werte zu verbinden, wobei die besondere Art des Verfassers, der »Stil« seiner Dar-
stellung allerdings in einem auffallenden Gegensatz zu der kräftig geschlossenen
und so ganz selbstverständlichen Schlichtheit der Werke des Künstlers selbst steht.
Es geschieht mit gutem Grund, daß bei Brueghel ebenso wie bei Bosch das Proble-
matische und vielleicht niemals ganz zu Enträtselnde der seelischen Verfassung, die
hinter ihren Gemälden steht, betont wird. Aber der doch stets zuerst gegebene
Eindruck, daß die künstlerische Phantasie bei beiden mit einer unbeirrbaren und
unfehlbaren Sicherheit und Naivität ihren Weg zu finden weiß, wird durch zu viele
Distinktionen und Grübeleien leicht zerstört. Ein etwas unruhiges Streben, die
Persönlichkeit von immer neuen Seiten her überraschend aufleuchten zu lassen,
führt zu einer impressionistisch bewegten Gesamtwirkung der Charakteristik, die zu
dem Stil Brueghels selbst in sehr merklichem Kontrast steht. Dazu kommt eine oft
ins Preziöse gehende Sprache, bei der die unmittelbare Anschauung gern ins Ab-
strakte und »Universale« gesteigert und verflüchtigt wird, mit einer fast auffälligen
Vorliebe für Fremdwörter (etwa: »Bosch, der Spezialist der Diablerie, weitet sich
für uns zusehends zum universalen Träger einer realistischen Revolution« — oder
von Brueghels Blindenbild: »Hier schuf der Moralphilosoph mit dem Bildhauer, der
farbenreiche Figurenmaler mit dem Landschafter, der das tonige Blaßgrün der bra-
bantischen Wiesen liebt, der soziale Denker mit dem komponierenden Geist, der
über Linien, Richtungen, Räume gebietet«). Immerhin, der Verfasser gibt doch
auch in seiner vielleicht nicht jedem zusagenden Art wirkliche Gedanken, und
alles in allem wird für den Kunsthistoriker wie für den Laien genug Positives aus
dem Büchlein zu gewinnen sein.
Ariesheim bei Basel. Ernst Heidrich.
Friedrich Wolters, Melchior Lechter. München 1911, Franz Hanfstängl.
Während die meisten heutigen Betrachtungen von Kunst und Künstler nichts
sind als der Ausdruck einer bestimmten Stellung zur Kunst, die als eine Einrich-
tung der bürgerlichen Welt vorausgesetzt wird, also nichts als der Ausdruck von
Sondermeinungen und Sonderwünschen an ein soziales Institut, aus der zufäl-
ligen Beziehung einer Anzahl von Menschen und Dingen, aus Eindrücken und
Stimmungen einer zufälligen Umgebung entstanden, also die stückhafte, bedingte,
relative Auffassung eines weltlichen Phänomens, wird in vorliegender Arbeit der
Versuch gemacht, dies Phänomen in seiner unbedingten Wesenheit, seiner ursprüng-
lichen Reinheit und Ganzheit zu erfassen und darzustellen. Die Kunst, der Künstler,