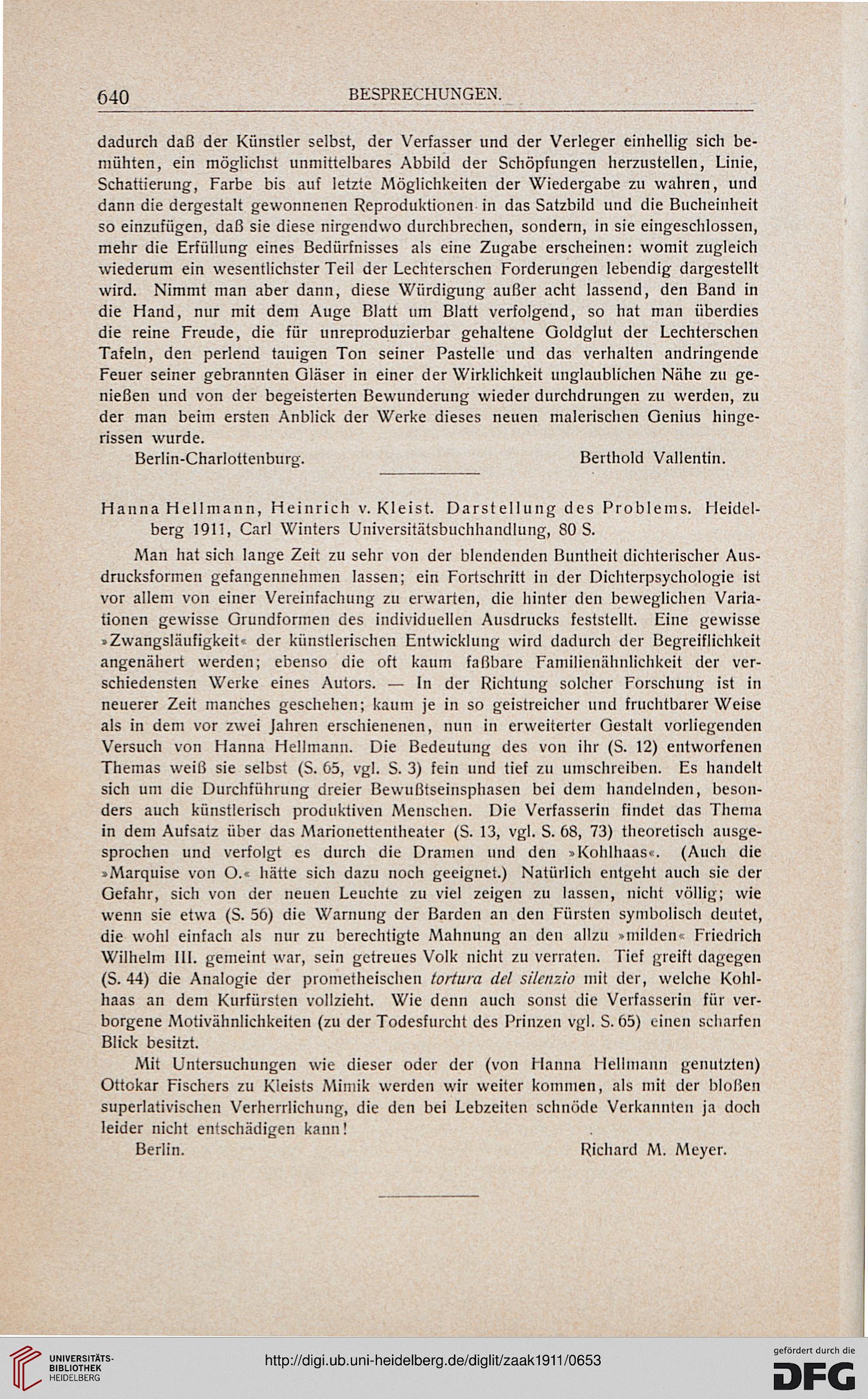640 BESPRECHUNGEN.
dadurch daß der Künstler selbst, der Verfasser und der Verleger einhellig sich be-
mühten, ein möglichst unmittelbares Abbild der Schöpfungen herzustellen, Linie,
Schattierung, Farbe bis auf letzte Möglichkeiten der Wiedergabe zu wahren, und
dann die dergestalt gewonnenen Reproduktionen in das Satzbild und die Bucheinheit
so einzufügen, daß sie diese nirgendwo durchbrechen, sondern, in sie eingeschlossen,
mehr die Erfüllung eines Bedürfnisses als eine Zugabe erscheinen: womit zugleich
wiederum ein wesentlichster Teil der Lechterschen Forderungen lebendig dargestellt
wird. Nimmt man aber dann, diese Würdigung außer acht lassend, den Band in
die Hand, nur mit dem Auge Blatt um Blatt verfolgend, so hat man überdies
die reine Freude, die für unreproduzierbar gehaltene Goldglut der Lechterschen
Tafeln, den perlend tauigen Ton seiner Pastelle und das verhalten andringende
Feuer seiner gebrannten Gläser in einer der Wirklichkeit unglaublichen Nähe zu ge-
nießen und von der begeisterten Bewunderung wieder durchdrungen zu werden, zu
der man beim ersten Anblick der Werke dieses neuen malerischen Genius hinge-
rissen wurde.
Berlin-Charlottenburg. Berthold Vallentin.
Hanna Hellmann, Heinrich v. Kleist. Darstellung des Problems. Heidel-
berg 1911, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, SOS.
Man hat sich lange Zeit zu sehr von der blendenden Buntheit dichterische]' Aus-
drucksfonnen gefangennehmen lassen; ein Fortschritt in der Dichterpsychologie ist
vor allem von einer Vereinfachung zu erwarten, die hinter den beweglichen Varia-
tionen gewisse Grundformen des individuellen Ausdrucks feststellt. Line gewisse
»Zwangsläufigkeit« der künstlerischen Entwicklung wird dadurch der Begreiflichkeit
angenähert werden; ebenso die oft kaum faßbare Familienähnlichkeit der ver-
schiedensten Werke eines Autors. — In der Richtung solcher Forschung ist in
neuerer Zeit manches geschehen; kaum je in so geistreicher und fruchtbarer Weise
als in dem vor zwei Jahren erschienenen, nun in erweiterter Gestalt vorliegenden
Versuch von Hanna Hellmann. Die Bedeutung des von ihr (S. 12) entworfenen
Themas weiß sie selbst (S. 65, vgl. S. 3) fein und tief zu umschreiben. Es handelt
sich um die Durchführung dreier Bewußtseinsphasen bei dem handelnden, beson-
ders auch künstlerisch produktiven Menschen. Die Verfasserin findet das Thema
in dem Aufsatz über das Marionettentheater (S. 13, vgl. S. 68, 73) theoretisch ausge-
sprochen und verfolgt es durch die Dramen und den »Kohlhaasc (Auch die
»Marquise von O.« hätte sich dazu noch geeignet.) Natürlich entgeht auch sie der
Gefahr, sich von der neuen Leuchte zu viel zeigen zu lassen, nicht völlig; wie
wenn sie etwa (S. 56) die Warnung der Barden an den Fürsten symbolisch deutet,
die wohl einfach als nur zu berechtigte Mahnung an den allzu »milden« Friedrich
Wilhelm III. gemeint war, sein getreues Volk nicht zu verraten. Tief greift dagegen
(S. 44) die Analogie der prometheischen tortura del silcnzio mit der, welche Kohl-
haas an dem Kurfürsten vollzieht. Wie denn auch sonst die Verfasserin für ver-
borgene Motivähnlichkeiten (zu der Todesfurcht des Prinzen vgl. S. 65) einen scharfen
Blick besitzt.
Mit Untersuchungen wie dieser oder der (von Hanna Helitnann genutzten)
Ottokar Fischers zu Kleists Mimik werden wir weiter kommen, als mit der bloßen
superlativischen Verherrlichung, die den bei Lebzeiten schnöde Verkannten ja doch
leider nicht entschädigen kann!
Berlin. Richard M. Meyer.
dadurch daß der Künstler selbst, der Verfasser und der Verleger einhellig sich be-
mühten, ein möglichst unmittelbares Abbild der Schöpfungen herzustellen, Linie,
Schattierung, Farbe bis auf letzte Möglichkeiten der Wiedergabe zu wahren, und
dann die dergestalt gewonnenen Reproduktionen in das Satzbild und die Bucheinheit
so einzufügen, daß sie diese nirgendwo durchbrechen, sondern, in sie eingeschlossen,
mehr die Erfüllung eines Bedürfnisses als eine Zugabe erscheinen: womit zugleich
wiederum ein wesentlichster Teil der Lechterschen Forderungen lebendig dargestellt
wird. Nimmt man aber dann, diese Würdigung außer acht lassend, den Band in
die Hand, nur mit dem Auge Blatt um Blatt verfolgend, so hat man überdies
die reine Freude, die für unreproduzierbar gehaltene Goldglut der Lechterschen
Tafeln, den perlend tauigen Ton seiner Pastelle und das verhalten andringende
Feuer seiner gebrannten Gläser in einer der Wirklichkeit unglaublichen Nähe zu ge-
nießen und von der begeisterten Bewunderung wieder durchdrungen zu werden, zu
der man beim ersten Anblick der Werke dieses neuen malerischen Genius hinge-
rissen wurde.
Berlin-Charlottenburg. Berthold Vallentin.
Hanna Hellmann, Heinrich v. Kleist. Darstellung des Problems. Heidel-
berg 1911, Carl Winters Universitätsbuchhandlung, SOS.
Man hat sich lange Zeit zu sehr von der blendenden Buntheit dichterische]' Aus-
drucksfonnen gefangennehmen lassen; ein Fortschritt in der Dichterpsychologie ist
vor allem von einer Vereinfachung zu erwarten, die hinter den beweglichen Varia-
tionen gewisse Grundformen des individuellen Ausdrucks feststellt. Line gewisse
»Zwangsläufigkeit« der künstlerischen Entwicklung wird dadurch der Begreiflichkeit
angenähert werden; ebenso die oft kaum faßbare Familienähnlichkeit der ver-
schiedensten Werke eines Autors. — In der Richtung solcher Forschung ist in
neuerer Zeit manches geschehen; kaum je in so geistreicher und fruchtbarer Weise
als in dem vor zwei Jahren erschienenen, nun in erweiterter Gestalt vorliegenden
Versuch von Hanna Hellmann. Die Bedeutung des von ihr (S. 12) entworfenen
Themas weiß sie selbst (S. 65, vgl. S. 3) fein und tief zu umschreiben. Es handelt
sich um die Durchführung dreier Bewußtseinsphasen bei dem handelnden, beson-
ders auch künstlerisch produktiven Menschen. Die Verfasserin findet das Thema
in dem Aufsatz über das Marionettentheater (S. 13, vgl. S. 68, 73) theoretisch ausge-
sprochen und verfolgt es durch die Dramen und den »Kohlhaasc (Auch die
»Marquise von O.« hätte sich dazu noch geeignet.) Natürlich entgeht auch sie der
Gefahr, sich von der neuen Leuchte zu viel zeigen zu lassen, nicht völlig; wie
wenn sie etwa (S. 56) die Warnung der Barden an den Fürsten symbolisch deutet,
die wohl einfach als nur zu berechtigte Mahnung an den allzu »milden« Friedrich
Wilhelm III. gemeint war, sein getreues Volk nicht zu verraten. Tief greift dagegen
(S. 44) die Analogie der prometheischen tortura del silcnzio mit der, welche Kohl-
haas an dem Kurfürsten vollzieht. Wie denn auch sonst die Verfasserin für ver-
borgene Motivähnlichkeiten (zu der Todesfurcht des Prinzen vgl. S. 65) einen scharfen
Blick besitzt.
Mit Untersuchungen wie dieser oder der (von Hanna Helitnann genutzten)
Ottokar Fischers zu Kleists Mimik werden wir weiter kommen, als mit der bloßen
superlativischen Verherrlichung, die den bei Lebzeiten schnöde Verkannten ja doch
leider nicht entschädigen kann!
Berlin. Richard M. Meyer.