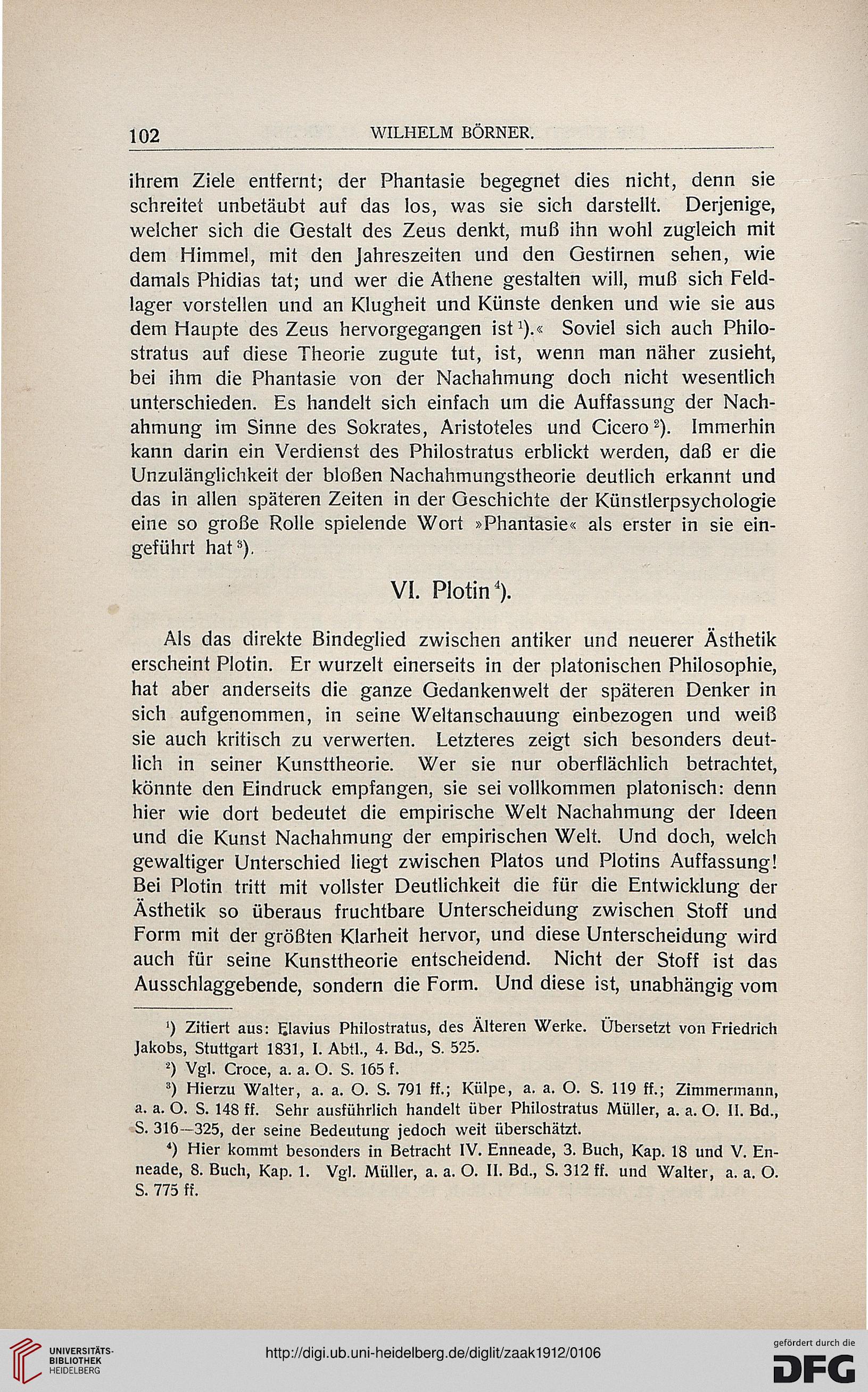102 WILHELM BÖRNER.
ihrem Ziele entfernt; der Phantasie begegnet dies nicht, denn sie
schreitet unbetäubt auf das los, was sie sich darstellt. Derjenige,
welcher sich die Gestalt des Zeus denkt, muß ihn wohl zugleich mit
dem Himmel, mit den Jahreszeiten und den Gestirnen sehen, wie
damals Phidias tat; und wer die Athene gestalten will, muß sich Feld-
lager vorstellen und an Klugheit und Künste denken und wie sie aus
dem Haupte des Zeus hervorgegangen ist1).« Soviel sich auch Philo-
stratus auf diese Theorie zugute tut, ist, wenn man näher zusieht,
bei ihm die Phantasie von der Nachahmung doch nicht wesentlich
unterschieden. Es handelt sich einfach um die Auffassung der Nach-
ahmung im Sinne des Sokrates, Aristoteles und Cicero2). Immerhin
kann darin ein Verdienst des Philostratus erblickt werden, daß er die
Unzulänglichkeit der bloßen Nachahmungstheorie deutlich erkannt und
das in allen späteren Zeiten in der Geschichte der Künstlerpsychologie
eine so große Rolle spielende Wort »Phantasie« als erster in sie ein-
geführt hat3).
VI. Plotin4).
Als das direkte Bindeglied zwischen antiker und neuerer Ästhetik
erscheint Plotin. Er wurzelt einerseits in der platonischen Philosophie,
hat aber anderseits die ganze Gedankenwelt der späteren Denker in
sich aufgenommen, in seine Weltanschauung einbezogen und weiß
sie auch kritisch zu verwerten. Letzteres zeigt sich besonders deut-
lich in seiner Kunsttheorie. Wer sie nur oberflächlich betrachtet,
könnte den Eindruck empfangen, sie sei vollkommen platonisch: denn
hier wie dort bedeutet die empirische Welt Nachahmung der Ideen
und die Kunst Nachahmung der empirischen Welt. Und doch, welch
gewaltiger Unterschied liegt zwischen Piatos und Plotins Auffassung!
Bei Plotin tritt mit vollster Deutlichkeit die für die Entwicklung der
Ästhetik so überaus fruchtbare Unterscheidung zwischen Stoff und
Form mit der größten Klarheit hervor, und diese Unterscheidung wird
auch für seine Kunsttheorie entscheidend. Nicht der Stoff ist das
Ausschlaggebende, sondern die Form. Und diese ist, unabhängig vom
') Zitiert aus: glavius Philostratus, des Älteren Werke. Übersetzt von Friedlich
Jakobs, Stuttgart 1831, I. Abtl., 4. Bd., S. 525.
2) Vgl. Croce, a. a. O. S. 165 f.
s) Hierzu Walter, a. a. O. S. 791 ff.; Külpe, a. a. O. S. 119 ff.; Zimmermann,
a. a. O. S. 148 ff. Sehr ausführlich handelt über Philostratus Müller, a. a. O. II. Bd.,
S. 316—325, der seine Bedeutung jedoch weit überschätzt.
4) Hier kommt besonders in Betracht IV. Enneade, 3. Buch, Kap. 18 und V. En-
neade, 8. Buch, Kap. 1. Vgl. Müller, a. a. O. II. Bd., S. 312 ff. und Walter, a. a. O.
S. 775 ff.
ihrem Ziele entfernt; der Phantasie begegnet dies nicht, denn sie
schreitet unbetäubt auf das los, was sie sich darstellt. Derjenige,
welcher sich die Gestalt des Zeus denkt, muß ihn wohl zugleich mit
dem Himmel, mit den Jahreszeiten und den Gestirnen sehen, wie
damals Phidias tat; und wer die Athene gestalten will, muß sich Feld-
lager vorstellen und an Klugheit und Künste denken und wie sie aus
dem Haupte des Zeus hervorgegangen ist1).« Soviel sich auch Philo-
stratus auf diese Theorie zugute tut, ist, wenn man näher zusieht,
bei ihm die Phantasie von der Nachahmung doch nicht wesentlich
unterschieden. Es handelt sich einfach um die Auffassung der Nach-
ahmung im Sinne des Sokrates, Aristoteles und Cicero2). Immerhin
kann darin ein Verdienst des Philostratus erblickt werden, daß er die
Unzulänglichkeit der bloßen Nachahmungstheorie deutlich erkannt und
das in allen späteren Zeiten in der Geschichte der Künstlerpsychologie
eine so große Rolle spielende Wort »Phantasie« als erster in sie ein-
geführt hat3).
VI. Plotin4).
Als das direkte Bindeglied zwischen antiker und neuerer Ästhetik
erscheint Plotin. Er wurzelt einerseits in der platonischen Philosophie,
hat aber anderseits die ganze Gedankenwelt der späteren Denker in
sich aufgenommen, in seine Weltanschauung einbezogen und weiß
sie auch kritisch zu verwerten. Letzteres zeigt sich besonders deut-
lich in seiner Kunsttheorie. Wer sie nur oberflächlich betrachtet,
könnte den Eindruck empfangen, sie sei vollkommen platonisch: denn
hier wie dort bedeutet die empirische Welt Nachahmung der Ideen
und die Kunst Nachahmung der empirischen Welt. Und doch, welch
gewaltiger Unterschied liegt zwischen Piatos und Plotins Auffassung!
Bei Plotin tritt mit vollster Deutlichkeit die für die Entwicklung der
Ästhetik so überaus fruchtbare Unterscheidung zwischen Stoff und
Form mit der größten Klarheit hervor, und diese Unterscheidung wird
auch für seine Kunsttheorie entscheidend. Nicht der Stoff ist das
Ausschlaggebende, sondern die Form. Und diese ist, unabhängig vom
') Zitiert aus: glavius Philostratus, des Älteren Werke. Übersetzt von Friedlich
Jakobs, Stuttgart 1831, I. Abtl., 4. Bd., S. 525.
2) Vgl. Croce, a. a. O. S. 165 f.
s) Hierzu Walter, a. a. O. S. 791 ff.; Külpe, a. a. O. S. 119 ff.; Zimmermann,
a. a. O. S. 148 ff. Sehr ausführlich handelt über Philostratus Müller, a. a. O. II. Bd.,
S. 316—325, der seine Bedeutung jedoch weit überschätzt.
4) Hier kommt besonders in Betracht IV. Enneade, 3. Buch, Kap. 18 und V. En-
neade, 8. Buch, Kap. 1. Vgl. Müller, a. a. O. II. Bd., S. 312 ff. und Walter, a. a. O.
S. 775 ff.