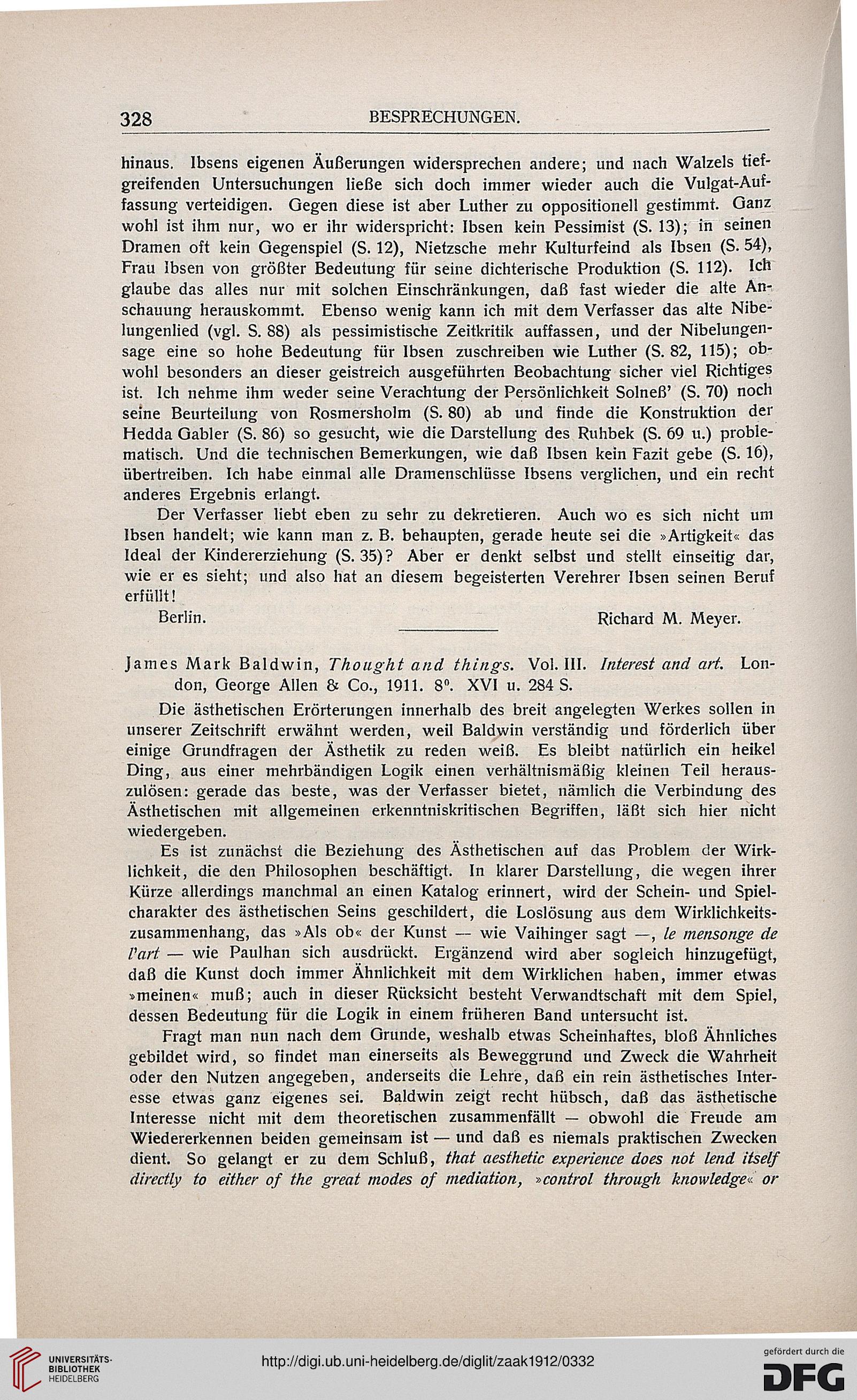328 BESPRECHUNGEN.
hinaus. Ibsens eigenen Äußerungen widersprechen andere; und nach Walzeis tief-
greifenden Untersuchungen ließe sich doch immer wieder auch die Vulgat-Auf-
fassung verteidigen. Gegen diese ist aber Luther zu oppositionell gestimmt. Ganz
wohl ist ihm nur, wo er ihr widerspricht: Ibsen kein Pessimist (S. 13); in seinen
Dramen oft kein Gegenspiel (S. 12), Nietzsche mehr Kulturfeind als Ibsen (S. 54),
Frau Ibsen von größter Bedeutung für seine dichterische Produktion (S. 112). Ich
glaube das alles nur mit solchen Einschränkungen, daß fast wieder die alte An-
schauung herauskommt. Ebenso wenig kann ich mit dem Verfasser das alte Nibe-
lungenlied (vgl. S. 88) als pessimistische Zeitkritik auffassen, und der Nibelungen-
sage eine so hohe Bedeutung für Ibsen zuschreiben wie Luther (S. 82, 115); ob-
wohl besonders an dieser geistreich ausgeführten Beobachtung sicher viel Richtiges
ist. Ich nehme ihm weder seine Verachtung der Persönlichkeit Solneß' (S. 70) noch
seine Beurteilung von Rosmersholm (S. 80) ab und finde die Konstruktion der
Hedda Gabler (S. 86) so gesucht, wie die Darstellung des Ruhbek (S. 69 u.) proble-
matisch. Und die technischen Bemerkungen, wie daß Ibsen kein Fazit gebe (S. 16),
übertreiben. Ich habe einmal alle Dramenschlüsse Ibsens verglichen, und ein recht
anderes Ergebnis erlangt.
Der Verfasser liebt eben zu sehr zu dekretieren. Auch wo es sich nicht um
Ibsen handelt; wie kann man z. B. behaupten, gerade heute sei die »Artigkeit« das
Ideal der Kindererziehung (S. 35) ? Aber er denkt selbst und stellt einseitig dar,
wie er es sieht; und also hat an diesem begeisterten Verehrer Ibsen seinen Beruf
erfüllt!
Berlin. Richard M. Meyer.
James Mark Baldwin, Thoaght and things. Vol. III. Interest and art. Lon-
don, George Allen & Co., 1911. 8°. XVI u. 284 S.
Die ästhetischen Erörterungen innerhalb des breit angelegten Werkes sollen in
unserer Zeitschrift erwähnt werden, weil Baldwin verständig und förderlich über
einige Grundfragen der Ästhetik zu reden weiß. Es bleibt natürlich ein heikel
Ding, aus einer mehrbändigen Logik einen verhältnismäßig kleinen Teil heraus-
zulösen: gerade das beste, was der Verfasser bietet, nämlich die Verbindung des
Ästhetischen mit allgemeinen erkenntniskritischen Begriffen, läßt sich hier nicht
wiedergeben.
Es ist zunächst die Beziehung des Ästhetischen auf das Problem der Wirk-
lichkeit, die den Philosophen beschäftigt. In klarer Darstellung, die wegen ihrer
Kürze allerdings manchmal an einen Katalog erinnert, wird der Schein- und Spiel-
charakter des ästhetischen Seins geschildert, die Loslösung aus dem Wirklichkeits-
zusammenhang, das »Als ob« der Kunst — wie Vaihinger sagt —, le mensonge de
Pari — wie Paulhan sich ausdrückt. Ergänzend wird aber sogleich hinzugefügt,
daß die Kunst doch immer Ähnlichkeit mit dem Wirklichen haben, immer etwas
»meinen« muß; auch in dieser Rücksicht besteht Verwandtschaft mit dem Spiel,
dessen Bedeutung für die Logik in einem früheren Band untersucht ist.
Fragt man nun nach dem Grunde, weshalb etwas Scheinhaftes, bloß Ähnliches
gebildet wird, so findet man einerseits als Beweggrund und Zweck die Wahrheit
oder den Nutzen angegeben, anderseits die Lehre, daß ein rein ästhetisches Inter-
esse etwas ganz eigenes sei. Baldwin zeigt recht hübsch, daß das ästhetische
Interesse nicht mit dem theoretischen zusammenfällt — obwohl die Freude am
Wiedererkennen beiden gemeinsam ist — und daß es niemals praktischen Zwecken
dient. So gelangt er zu dem Schluß, that aesthetic experience does not lend itself
directly to either of the great modes of mediation, »control through knowledge« or
hinaus. Ibsens eigenen Äußerungen widersprechen andere; und nach Walzeis tief-
greifenden Untersuchungen ließe sich doch immer wieder auch die Vulgat-Auf-
fassung verteidigen. Gegen diese ist aber Luther zu oppositionell gestimmt. Ganz
wohl ist ihm nur, wo er ihr widerspricht: Ibsen kein Pessimist (S. 13); in seinen
Dramen oft kein Gegenspiel (S. 12), Nietzsche mehr Kulturfeind als Ibsen (S. 54),
Frau Ibsen von größter Bedeutung für seine dichterische Produktion (S. 112). Ich
glaube das alles nur mit solchen Einschränkungen, daß fast wieder die alte An-
schauung herauskommt. Ebenso wenig kann ich mit dem Verfasser das alte Nibe-
lungenlied (vgl. S. 88) als pessimistische Zeitkritik auffassen, und der Nibelungen-
sage eine so hohe Bedeutung für Ibsen zuschreiben wie Luther (S. 82, 115); ob-
wohl besonders an dieser geistreich ausgeführten Beobachtung sicher viel Richtiges
ist. Ich nehme ihm weder seine Verachtung der Persönlichkeit Solneß' (S. 70) noch
seine Beurteilung von Rosmersholm (S. 80) ab und finde die Konstruktion der
Hedda Gabler (S. 86) so gesucht, wie die Darstellung des Ruhbek (S. 69 u.) proble-
matisch. Und die technischen Bemerkungen, wie daß Ibsen kein Fazit gebe (S. 16),
übertreiben. Ich habe einmal alle Dramenschlüsse Ibsens verglichen, und ein recht
anderes Ergebnis erlangt.
Der Verfasser liebt eben zu sehr zu dekretieren. Auch wo es sich nicht um
Ibsen handelt; wie kann man z. B. behaupten, gerade heute sei die »Artigkeit« das
Ideal der Kindererziehung (S. 35) ? Aber er denkt selbst und stellt einseitig dar,
wie er es sieht; und also hat an diesem begeisterten Verehrer Ibsen seinen Beruf
erfüllt!
Berlin. Richard M. Meyer.
James Mark Baldwin, Thoaght and things. Vol. III. Interest and art. Lon-
don, George Allen & Co., 1911. 8°. XVI u. 284 S.
Die ästhetischen Erörterungen innerhalb des breit angelegten Werkes sollen in
unserer Zeitschrift erwähnt werden, weil Baldwin verständig und förderlich über
einige Grundfragen der Ästhetik zu reden weiß. Es bleibt natürlich ein heikel
Ding, aus einer mehrbändigen Logik einen verhältnismäßig kleinen Teil heraus-
zulösen: gerade das beste, was der Verfasser bietet, nämlich die Verbindung des
Ästhetischen mit allgemeinen erkenntniskritischen Begriffen, läßt sich hier nicht
wiedergeben.
Es ist zunächst die Beziehung des Ästhetischen auf das Problem der Wirk-
lichkeit, die den Philosophen beschäftigt. In klarer Darstellung, die wegen ihrer
Kürze allerdings manchmal an einen Katalog erinnert, wird der Schein- und Spiel-
charakter des ästhetischen Seins geschildert, die Loslösung aus dem Wirklichkeits-
zusammenhang, das »Als ob« der Kunst — wie Vaihinger sagt —, le mensonge de
Pari — wie Paulhan sich ausdrückt. Ergänzend wird aber sogleich hinzugefügt,
daß die Kunst doch immer Ähnlichkeit mit dem Wirklichen haben, immer etwas
»meinen« muß; auch in dieser Rücksicht besteht Verwandtschaft mit dem Spiel,
dessen Bedeutung für die Logik in einem früheren Band untersucht ist.
Fragt man nun nach dem Grunde, weshalb etwas Scheinhaftes, bloß Ähnliches
gebildet wird, so findet man einerseits als Beweggrund und Zweck die Wahrheit
oder den Nutzen angegeben, anderseits die Lehre, daß ein rein ästhetisches Inter-
esse etwas ganz eigenes sei. Baldwin zeigt recht hübsch, daß das ästhetische
Interesse nicht mit dem theoretischen zusammenfällt — obwohl die Freude am
Wiedererkennen beiden gemeinsam ist — und daß es niemals praktischen Zwecken
dient. So gelangt er zu dem Schluß, that aesthetic experience does not lend itself
directly to either of the great modes of mediation, »control through knowledge« or