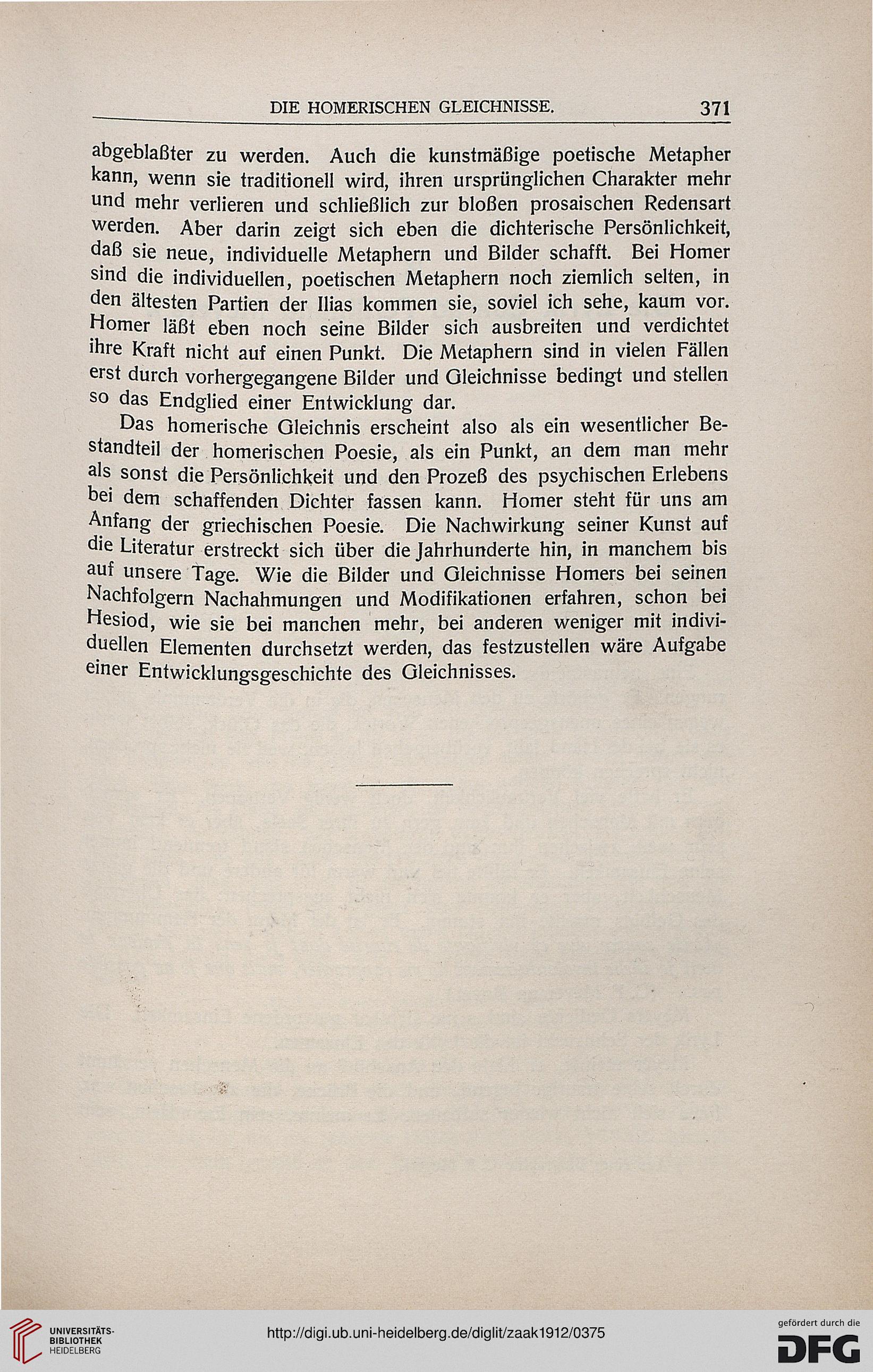DIE HOMERISCHEN GLEICHNISSE. 371
abgeblaßter zu werden. Auch die kunstmäßige poetische Metapher
kann, wenn sie traditionell wird, ihren ursprünglichen Charakter mehr
und mehr verlieren und schließlich zur bloßen prosaischen Redensart
werden. Aber darin zeigt sich eben die dichterische Persönlichkeit,
daß sie neue, individuelle Metaphern und Bilder schafft. Bei Homer
sind die individuellen, poetischen Metaphern noch ziemlich selten, in
den ältesten Partien der Ilias kommen sie, soviel ich sehe, kaum vor.
Homer läßt eben noch seine Bilder sich ausbreiten und verdichtet
ihre Kraft nicht auf einen Punkt. Die Metaphern sind in vielen Fällen
erst durch vorhergegangene Bilder und Oleichnisse bedingt und stellen
so das Endglied einer Entwicklung dar.
Das homerische Gleichnis erscheint also als ein wesentlicher Be-
standteil der homerischen Poesie, als ein Punkt, an dem man mehr
als sonst die Persönlichkeit und den Prozeß des psychischen Erlebens
bei dem schaffenden Dichter fassen kann. Homer steht für uns am
Anfang der griechischen Poesie. Die Nachwirkung seiner Kunst auf
die Literatur erstreckt sich über die Jahrhunderte hin, in manchem bis
auf unsere tage. Wie die Bilder und Oleichnisse Homers bei seinen
Nachfolgern Nachahmungen und Modifikationen erfahren, schon bei
Hesiod, wie sie bei manchen mehr, bei anderen weniger mit indivi-
duellen Elementen durchsetzt werden, das festzustellen wäre Aufgabe
einer Entwicklungsgeschichte des Gleichnisses.
abgeblaßter zu werden. Auch die kunstmäßige poetische Metapher
kann, wenn sie traditionell wird, ihren ursprünglichen Charakter mehr
und mehr verlieren und schließlich zur bloßen prosaischen Redensart
werden. Aber darin zeigt sich eben die dichterische Persönlichkeit,
daß sie neue, individuelle Metaphern und Bilder schafft. Bei Homer
sind die individuellen, poetischen Metaphern noch ziemlich selten, in
den ältesten Partien der Ilias kommen sie, soviel ich sehe, kaum vor.
Homer läßt eben noch seine Bilder sich ausbreiten und verdichtet
ihre Kraft nicht auf einen Punkt. Die Metaphern sind in vielen Fällen
erst durch vorhergegangene Bilder und Oleichnisse bedingt und stellen
so das Endglied einer Entwicklung dar.
Das homerische Gleichnis erscheint also als ein wesentlicher Be-
standteil der homerischen Poesie, als ein Punkt, an dem man mehr
als sonst die Persönlichkeit und den Prozeß des psychischen Erlebens
bei dem schaffenden Dichter fassen kann. Homer steht für uns am
Anfang der griechischen Poesie. Die Nachwirkung seiner Kunst auf
die Literatur erstreckt sich über die Jahrhunderte hin, in manchem bis
auf unsere tage. Wie die Bilder und Oleichnisse Homers bei seinen
Nachfolgern Nachahmungen und Modifikationen erfahren, schon bei
Hesiod, wie sie bei manchen mehr, bei anderen weniger mit indivi-
duellen Elementen durchsetzt werden, das festzustellen wäre Aufgabe
einer Entwicklungsgeschichte des Gleichnisses.