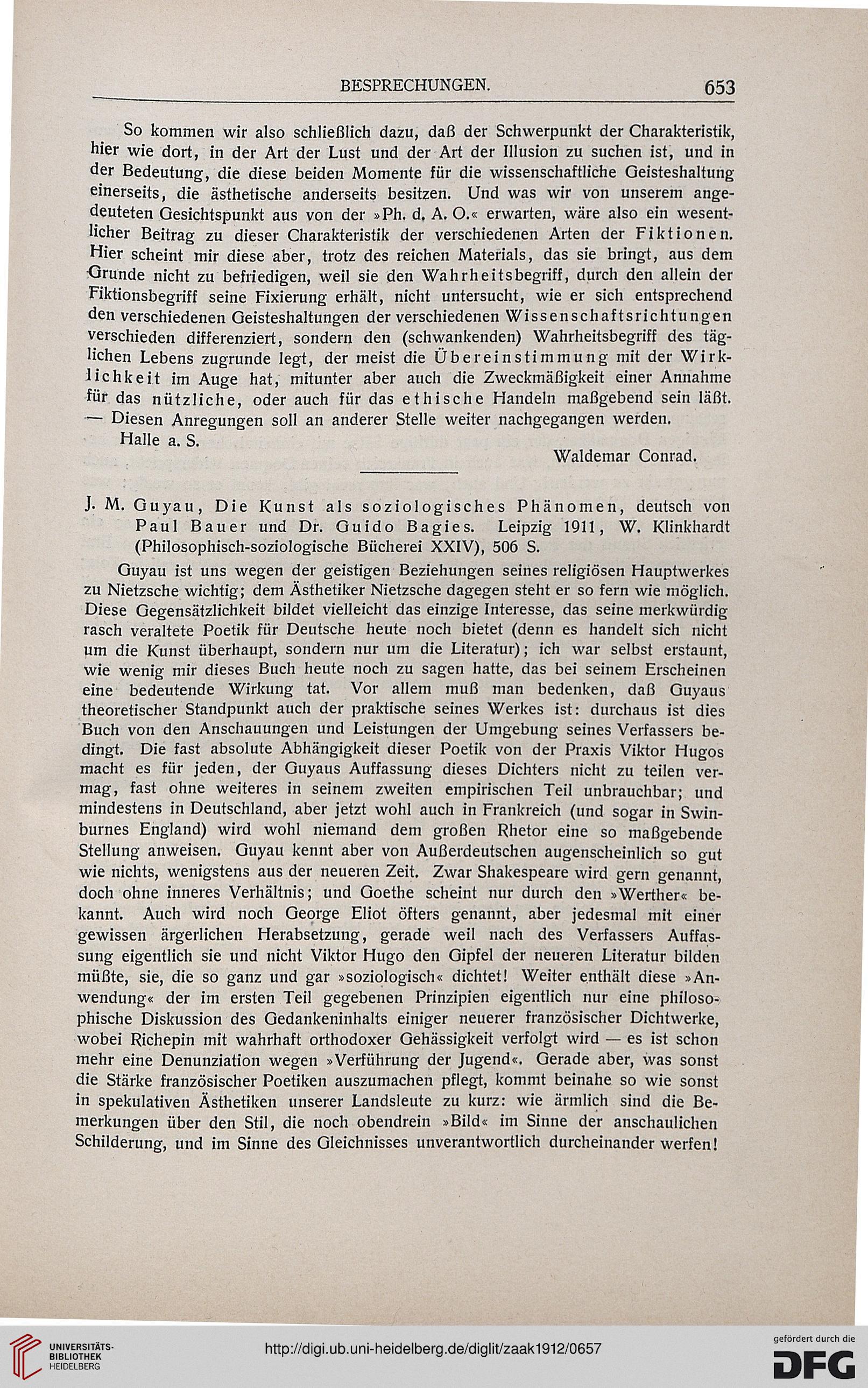BESPRECHUNGEN. 653
So kommen wir also schließlich dazu, daß der Schwerpunkt der Charakteristik,
hier wie dort, in der Art der Lust und der Art der Illusion zu suchen ist, und in
der Bedeutung, die diese beiden Momente für die wissenschaftliche Geisteshaltung
einerseits, die ästhetische anderseits besitzen. Und was wir von unserem ange-
deuteten Gesichtspunkt aus von der »Ph. d. A. O.« erwarten, wäre also ein wesent-
licher Beitrag zu dieser Charakteristik der verschiedenen Arten der Fiktionen.
Hier scheint mir diese aber, trotz des reichen Materials, das sie bringt, aus dem
Grunde nicht zu befriedigen, weil sie den Wahrheitsbegriff, durch den allein der
Fiktionsbegriff seine Fixierung erhält, nicht untersucht, wie er sich entsprechend
den verschiedenen Geisteshaltungen der verschiedenen Wissenschaftsrichtungen
verschieden differenziert, sondern den (schwankenden) Wahrheitsbegriff des täg-
lichen Lebens zugrunde legt, der meist die Übereinstimmung mit der Wirk-
lichkeit im Auge hat, mitunter aber auch die Zweckmäßigkeit einer Annahme
für das nützliche, oder auch für das ethische Handeln maßgebend sein läßt.
— Diesen Anregungen soll an anderer Stelle weiter nachgegangen werden.
Halle a. S.
Waldemar Conrad.
J. M. Guyau, Die Kunst als soziologisches Phänomen, deutsch von
Paul Bauer und Dr. Guido Bagies. Leipzig 1911, W. Klinkhardt
(Philosophisch-soziologische Bücherei XXIV), 506 S.
Guyau ist uns wegen der geistigen Beziehungen seines religiösen Hauptwerkes
zu Nietzsche wichtig; dem Ästhetiker Nietzsche dagegen steht er so fern wie möglich.
Diese Gegensätzlichkeit bildet vielleicht das einzige Interesse, das seine merkwürdig
rasch veraltete Poetik für Deutsche heute noch bietet (denn es handelt sich nicht
um die Kunst überhaupt, sondern nur um die Literatur); ich war selbst erstaunt,
wie wenig mir dieses Buch heute noch zu sagen hatte, das bei seinem Erscheinen
eine bedeutende Wirkung tat. Vor allem muß man bedenken, daß Guyaus
theoretischer Standpunkt auch der praktische seines Werkes ist: durchaus ist dies
Buch von den Anschauungen und Leistungen der Umgebung seines Verfassers be-
dingt. Die fast absolute Abhängigkeit dieser Poetik von der Praxis Viktor Hugos
macht es für jeden, der Guyaus Auffassung dieses Dichters nicht zu teilen ver-
mag, fast ohne weiteres in seinem zweiten empirischen Teil unbrauchbar; und
mindestens in Deutschland, aber jetzt wohl auch in Frankreich (und sogar in Swin-
burnes England) wird wohl niemand dem großen Rhetor eine so maßgebende
Stellung anweisen. Guyau kennt aber von Außerdeutschen augenscheinlich so gut
wie nichts, wenigstens aus der neueren Zeit. Zwar Shakespeare wird gern genannt,
doch ohne inneres Verhältnis; und Goethe scheint nur durch den »Werther«: be-
kannt. Auch wird noch George Eliot öfters genannt, aber jedesmal mit einer
gewissen ärgerlichen Herabsetzung, gerade weil nach des Verfassers Auffas-
sung eigentlich sie und nicht Viktor Hugo den Gipfel der neueren Literatur bilden
müßte, sie, die so ganz und gar »soziologisch« dichtet! Weiter enthält diese »An-
wendung« der im ersten Teil gegebenen Prinzipien eigentlich nur eine philoso-
phische Diskussion des Gedankeninhalts einiger neuerer französischer Dichtwerke,
wobei Richepin mit wahrhaft orthodoxer Gehässigkeit verfolgt wird — es ist schon
mehr eine Denunziation wegen »Verführung der Jugend«. Gerade aber, was sonst
die Stärke französischer Poetiken auszumachen pflegt, kommt beinahe so wie sonst
in spekulativen Ästhetiken unserer Landsleute zu kurz: wie ärmlich sind die Be-
merkungen über den Stil, die noch obendrein »Bild« im Sinne der anschaulichen
Schilderung, und im Sinne des Gleichnisses unverantwortlich durcheinander werfen!
So kommen wir also schließlich dazu, daß der Schwerpunkt der Charakteristik,
hier wie dort, in der Art der Lust und der Art der Illusion zu suchen ist, und in
der Bedeutung, die diese beiden Momente für die wissenschaftliche Geisteshaltung
einerseits, die ästhetische anderseits besitzen. Und was wir von unserem ange-
deuteten Gesichtspunkt aus von der »Ph. d. A. O.« erwarten, wäre also ein wesent-
licher Beitrag zu dieser Charakteristik der verschiedenen Arten der Fiktionen.
Hier scheint mir diese aber, trotz des reichen Materials, das sie bringt, aus dem
Grunde nicht zu befriedigen, weil sie den Wahrheitsbegriff, durch den allein der
Fiktionsbegriff seine Fixierung erhält, nicht untersucht, wie er sich entsprechend
den verschiedenen Geisteshaltungen der verschiedenen Wissenschaftsrichtungen
verschieden differenziert, sondern den (schwankenden) Wahrheitsbegriff des täg-
lichen Lebens zugrunde legt, der meist die Übereinstimmung mit der Wirk-
lichkeit im Auge hat, mitunter aber auch die Zweckmäßigkeit einer Annahme
für das nützliche, oder auch für das ethische Handeln maßgebend sein läßt.
— Diesen Anregungen soll an anderer Stelle weiter nachgegangen werden.
Halle a. S.
Waldemar Conrad.
J. M. Guyau, Die Kunst als soziologisches Phänomen, deutsch von
Paul Bauer und Dr. Guido Bagies. Leipzig 1911, W. Klinkhardt
(Philosophisch-soziologische Bücherei XXIV), 506 S.
Guyau ist uns wegen der geistigen Beziehungen seines religiösen Hauptwerkes
zu Nietzsche wichtig; dem Ästhetiker Nietzsche dagegen steht er so fern wie möglich.
Diese Gegensätzlichkeit bildet vielleicht das einzige Interesse, das seine merkwürdig
rasch veraltete Poetik für Deutsche heute noch bietet (denn es handelt sich nicht
um die Kunst überhaupt, sondern nur um die Literatur); ich war selbst erstaunt,
wie wenig mir dieses Buch heute noch zu sagen hatte, das bei seinem Erscheinen
eine bedeutende Wirkung tat. Vor allem muß man bedenken, daß Guyaus
theoretischer Standpunkt auch der praktische seines Werkes ist: durchaus ist dies
Buch von den Anschauungen und Leistungen der Umgebung seines Verfassers be-
dingt. Die fast absolute Abhängigkeit dieser Poetik von der Praxis Viktor Hugos
macht es für jeden, der Guyaus Auffassung dieses Dichters nicht zu teilen ver-
mag, fast ohne weiteres in seinem zweiten empirischen Teil unbrauchbar; und
mindestens in Deutschland, aber jetzt wohl auch in Frankreich (und sogar in Swin-
burnes England) wird wohl niemand dem großen Rhetor eine so maßgebende
Stellung anweisen. Guyau kennt aber von Außerdeutschen augenscheinlich so gut
wie nichts, wenigstens aus der neueren Zeit. Zwar Shakespeare wird gern genannt,
doch ohne inneres Verhältnis; und Goethe scheint nur durch den »Werther«: be-
kannt. Auch wird noch George Eliot öfters genannt, aber jedesmal mit einer
gewissen ärgerlichen Herabsetzung, gerade weil nach des Verfassers Auffas-
sung eigentlich sie und nicht Viktor Hugo den Gipfel der neueren Literatur bilden
müßte, sie, die so ganz und gar »soziologisch« dichtet! Weiter enthält diese »An-
wendung« der im ersten Teil gegebenen Prinzipien eigentlich nur eine philoso-
phische Diskussion des Gedankeninhalts einiger neuerer französischer Dichtwerke,
wobei Richepin mit wahrhaft orthodoxer Gehässigkeit verfolgt wird — es ist schon
mehr eine Denunziation wegen »Verführung der Jugend«. Gerade aber, was sonst
die Stärke französischer Poetiken auszumachen pflegt, kommt beinahe so wie sonst
in spekulativen Ästhetiken unserer Landsleute zu kurz: wie ärmlich sind die Be-
merkungen über den Stil, die noch obendrein »Bild« im Sinne der anschaulichen
Schilderung, und im Sinne des Gleichnisses unverantwortlich durcheinander werfen!