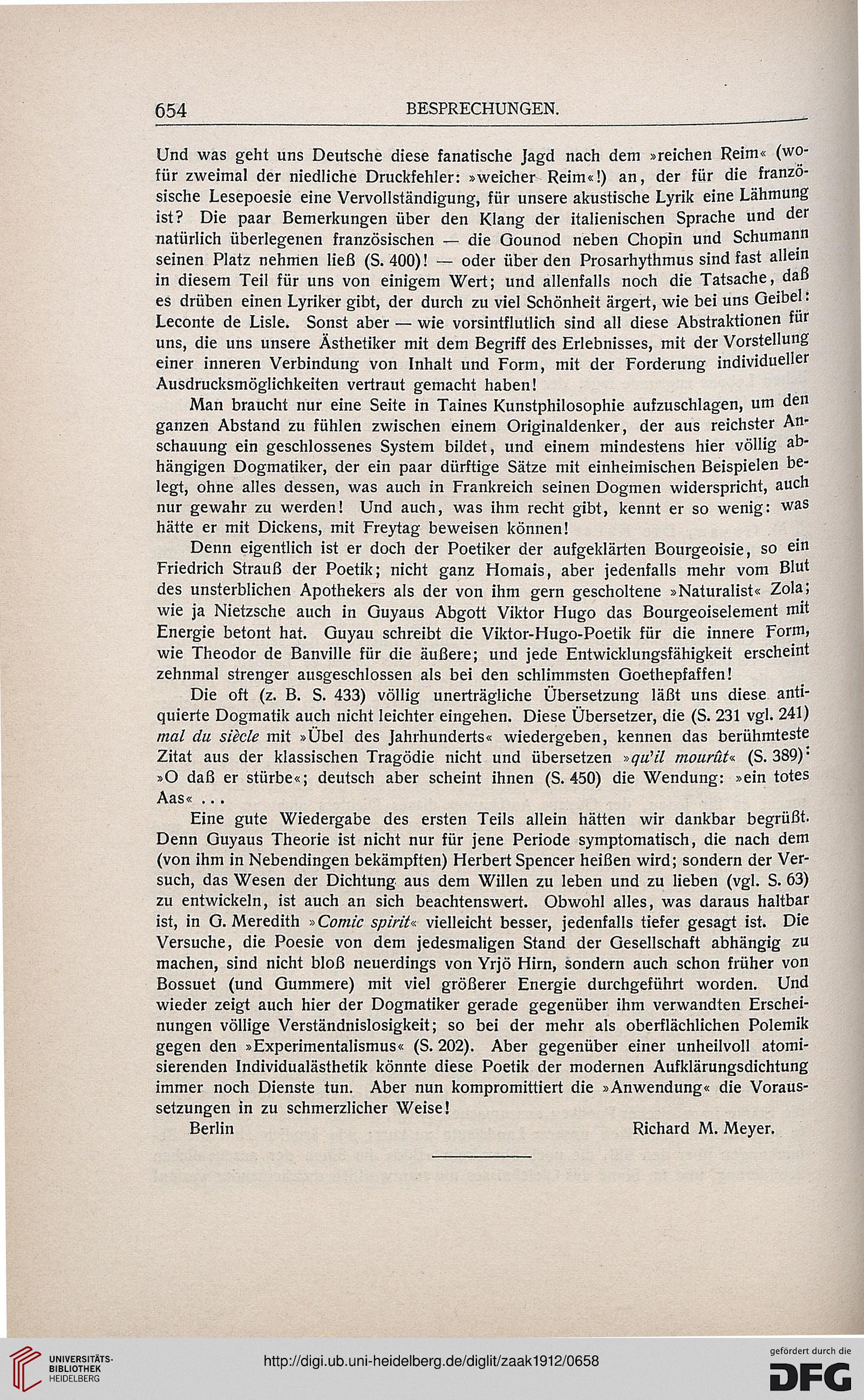654 BESPRECHUNGEN.
Und was geht uns Deutsche diese fanatische Jagd nach dem »reichen Reim« (wo-
für zweimal der niedliche Druckfehler: »weicher Reim«!) an, der für die franzo-
sische Lesepoesie eine Vervollständigung, für unsere akustische Lyrik eine Lähmung
ist? Die paar Bemerkungen über den Klang der italienischen Sprache und der
natürlich überlegenen französischen — die Oounod neben Chopin und Schumann
seinen Platz nehmen ließ (S. 400)! — oder über den Prosarhythmus sind fast allein
in diesem Teil für uns von einigem Wert; und allenfalls noch die Tatsache, daß
es drüben einen Lyriker gibt, der durch zu viel Schönheit ärgert, wie bei uns Geibel:
Leconte de Lisle. Sonst aber — wie vorsintflutlich sind all diese Abstraktionen für
uns, die uns unsere Ästhetiker mit dem Begriff des Erlebnisses, mit der Vorstellung
einer inneren Verbindung von Inhalt und Form, mit der Forderung individueller
Ausdrucksmöglichkeiten vertraut gemacht haben!
Man braucht nur eine Seite in Taines Kunstphilosophie aufzuschlagen, um den
ganzen Abstand zu fühlen zwischen einem Originaldenker, der aus reichster An-
schauung ein geschlossenes System bildet, und einem mindestens hier völlig a"'
hängigen Dogmatiker, der ein paar dürftige Sätze mit einheimischen Beispielen be-
legt, ohne alles dessen, was auch in Frankreich seinen Dogmen widerspricht, auch
nur gewahr zu werden! Und auch, was ihm recht gibt, kennt er so wenig: was
hätte er mit Dickens, mit Freytag beweisen können!
Denn eigentlich ist er doch der Poetiker der aufgeklärten Bourgeoisie, so ein
Friedrich Strauß der Poetik; nicht ganz Homais, aber jedenfalls mehr vom Blut
des unsterblichen Apothekers als der von ihm gern gescholtene »Naturalist« Zola;
wie ja Nietzsche auch in Guyaus Abgott Viktor Hugo das Bourgeoiselement mit
Energie betont hat. Guyau schreibt die Viktor-Hugo-Poetik für die innere Form,
wie Theodor de Banville für die äußere; und jede Entwicklungsfähigkeit erscheint
zehnmal strenger ausgeschlossen als bei den schlimmsten Goethepfaffen!
Die oft (z. B. S. 433) völlig unerträgliche Übersetzung läßt uns diese anti-
quierte Dogmatik auch nicht leichter eingehen. Diese Übersetzer, die (S. 231 vgl. 241)
mal du siede mit »Übel des Jahrhunderts« wiedergeben, kennen das berühmteste
Zitat aus der klassischen Tragödie nicht und übersetzen »qu'il moumU (S. 389)*
»O daß er stürbe«; deutsch aber scheint ihnen (S. 450) die Wendung: »ein totes
Aas« ...
Eine gute Wiedergabe des ersten Teils allein hätten wir dankbar begrüßt.
Denn Guyaus Theorie ist nicht nur für jene Periode symptomatisch, die nach dem
(von ihm in Nebendingen bekämpften) Herbert Spencer heißen wird; sondern der Ver-
such, das Wesen der Dichtung aus dem Willen zu leben und zu lieben (vgl. S. 63)
zu entwickeln, ist auch an sich beachtenswert. Obwohl alles, was daraus haltbar
ist, in G. Meredith »Comic spiriU vielleicht besser, jedenfalls tiefer gesagt ist. Die
Versuche, die Poesie von dem jedesmaligen Stand der Gesellschaft abhängig zu
machen, sind nicht bloß neuerdings von Yrjö Hirn, sondern auch schon früher von
Bossuet (und Gummere) mit viel größerer Energie durchgeführt worden. Und
wieder zeigt auch hier der Dogmatiker gerade gegenüber ihm verwandten Erschei-
nungen völlige Verständnislosigkeit; so bei der mehr als oberflächlichen Polemik
gegen den »Experimentalismus« (S. 202). Aber gegenüber einer unheilvoll atomi-
sierenden Individualästhetik könnte diese Poetik der modernen Aufklärungsdichtung
immer noch Dienste tun. Aber nun kompromittiert die »Anwendung« die Voraus-
setzungen in zu schmerzlicher Weise!
Berlin Richard M. Meyer.