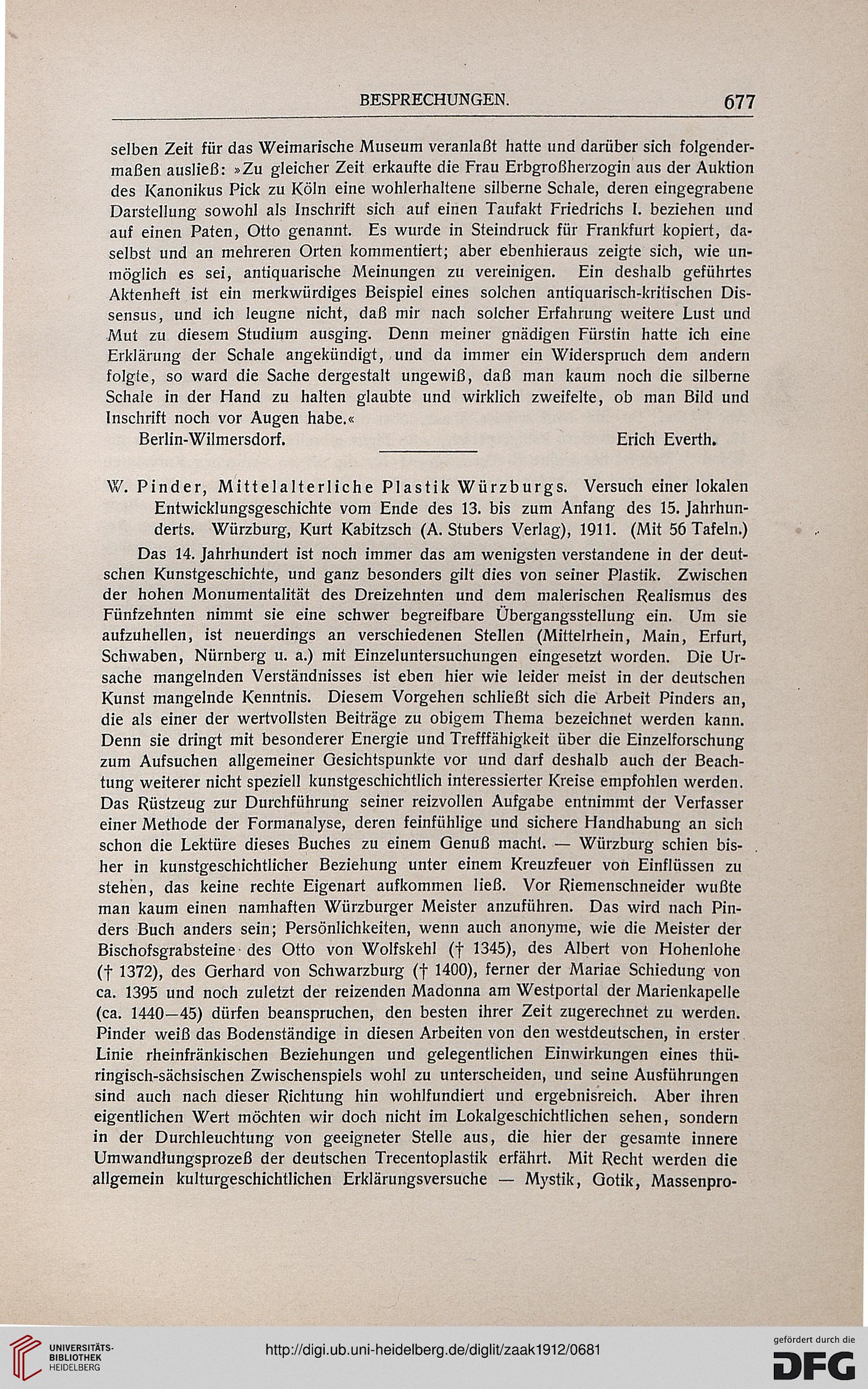BESPRECHUNGEN. 677
selben Zeit für das Weimarische Museum veranlaßt hatte und darüber sich folgender-
maßen ausließ: »Zu gleicher Zeit erkaufte die Frau Erbgroßherzogin aus der Auktion
des Kanonikus Pick zu Köln eine wohlerhaltene silberne Schale, deren eingegrabene
Darstellung sowohl als Inschrift sich auf einen Taufakt Friedrichs f. beziehen und
auf einen Paten, Otto genannt. Es wurde in Steindruck für Frankfurt kopiert, da-
selbst und an mehreren Orten kommentiert; aber ebenhieraus zeigte sich, wie un-
möglich es sei, antiquarische Meinungen zu vereinigen. Ein deshalb geführtes
Aktenheft ist ein merkwürdiges Beispiel eines solchen antiquarisch-kritischen Dis-
sensus, und ich leugne nicht, daß mir nach solcher Erfahrung weitere Lust und
Mut zu diesem Studium ausging. Denn meiner gnädigen Fürstin hatte ich eine
Erklärung der Schale angekündigt, und da immer ein Widerspruch dem andern
folgte, so ward die Sache dergestalt ungewiß, daß man kaum noch die silberne
Schale in der Hand zu halten glaubte und wirklich zweifelte, ob man Bild und
Inschrift noch vor Augen habe.«
Berlin-Wilmersdorf. Erich Everth.
W. Pinder, Mittelalterliche Plastik Würzburgs. Versuch einer lokalen
Entwicklungsgeschichte vom Ende des 13. bis zum Anfang des 15. Jahrhun-
derts. Würzburg, Kurt Kabitzsch (A. Stubers Verlag), 1911. (Mit 56 Tafeln.)
Das 14. Jahrhundert ist noch immer das am wenigsten verstandene in der deut-
schen Kunstgeschichte, und ganz besonders gilt dies von seiner Plastik. Zwischen
der hohen Monumentalität des Dreizehnten und dem malerischen Realismus des
Fünfzehnten nimmt sie eine schwer begreifbare Übergangsstellung ein. Um sie
aufzuhellen, ist neuerdings an verschiedenen Stellen (Mittelrhein, Main, Erfurt,
Schwaben, Nürnberg u. a.) mit Einzeluntersuchungen eingesetzt worden. Die Ur-
sache mangelnden Verständnisses ist eben hier wie leider meist in der deutschen
Kunst mangelnde Kenntnis. Diesem Vorgehen schließt sich die Arbeit Pinders an,
die als einer der wertvollsten Beiträge zu obigem Thema bezeichnet werden kann.
Denn sie dringt mit besonderer Energie und Trefffähigkeit über die Einzelforschung
zum Aufsuchen allgemeiner Gesichtspunkte vor und darf deshalb auch der Beach-
tung weiterer nicht speziell kunstgeschichtlich interessierter Kreise empfohlen werden.
Das Rüstzeug zur Durchführung seiner reizvollen Aufgabe entnimmt der Verfasser
einer Methode der Formanalyse, deren feinfühlige und sichere Handhabung an sich
schon die Lektüre dieses Buches zu einem Genuß macht. — Würzburg schien bis-
her in kunstgeschichtlicher Beziehung unter einem Kreuzfeuer von Einflüssen zu
stehen, das keine rechte Eigenart aufkommen ließ. Vor Riemenschneider wußte
man kaum einen namhaften Würzburger Meister anzuführen. Das wird nach Pin-
ders Buch anders sein; Persönlichkeiten, wenn auch anonyme, wie die Meister der
Bischofsgrabsteine des Otto von Wolfskehl (f 1345), des Albert von Hohenlohe
(f 1372), des Gerhard von Schwarzburg (f 1400), ferner der Mariae Schiedung von
ca. 1395 und noch zuletzt der reizenden Madonna am Westportal der Marienkapelle
(ca. 1440—45) dürfen beanspruchen, den besten ihrer Zeit zugerechnet zu werden.
Pinder weiß das Bodenständige in diesen Arbeiten von den westdeutschen, in erster
Linie rheinfränkischen Beziehungen und gelegentlichen Einwirkungen eines thü-
ringisch-sächsischen Zwischenspiels wohl zu unterscheiden, und seine Ausführungen
sind auch nach dieser Richtung hin wohlfundiert und ergebnisreich. Aber ihren
eigentlichen Wert möchten wir doch nicht im Lokalgeschichtlichen sehen, sondern
in der Durchleuchtung von geeigneter Stelle aus, die hier der gesamte innere
Umwandlungsprozeß der deutschen Trecentoplastik erfährt. Mit Recht werden die
allgemein kulturgeschichtlichen Erklärungsversuche — Mystik, Gotik, Massenpro-