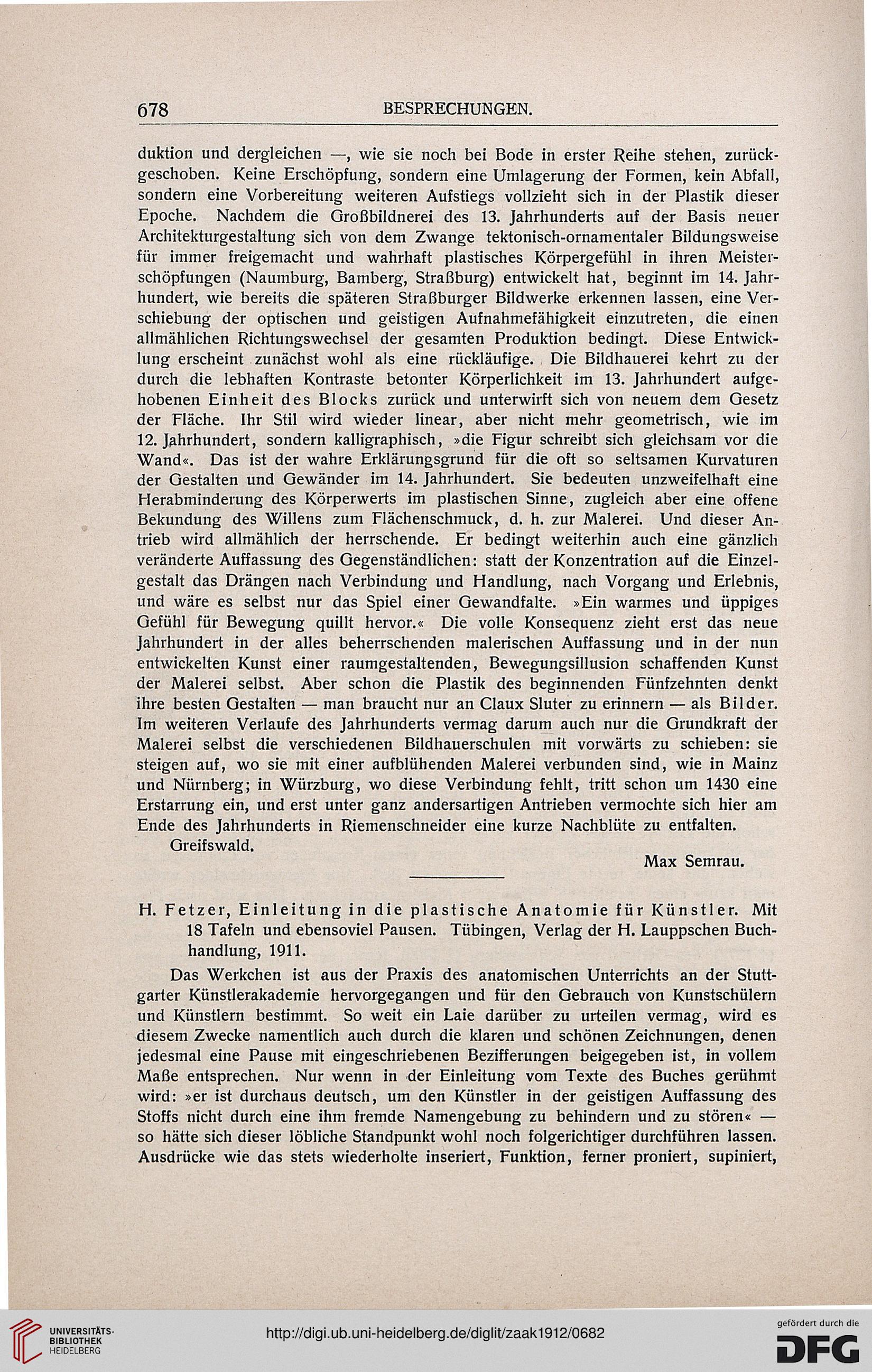678 BESPRECHUNGEN.
duktion und dergleichen —, wie sie noch bei Bode in erster Reihe stehen, zurück-
geschoben. Keine Erschöpfung, sondern eine Umlagerung der Formen, kein Abfall,
sondern eine Vorbereitung weiteren Aufstiegs vollzieht sich in der Plastik dieser
Epoche. Nachdem die Großbildnerei des 13. Jahrhunderts auf der Basis neuer
Architekturgestaltung sich von dem Zwange tektonisch-ornamentaler Bildungsweise
für immer freigemacht und wahrhaft plastisches Körpergefühl in ihren Meister-
schöpfungen (Naumburg, Bamberg, Straßburg) entwickelt hat, beginnt im 14. Jahr-
hundert, wie bereits die späteren Straßburger Bildwerke erkennen lassen, eine Ver-
schiebung der optischen und geistigen Aufnahmefähigkeit einzutreten, die einen
allmählichen Richtungswechsel der gesamten Produktion bedingt. Diese Entwick-
lung erscheint zunächst wohl als eine rückläufige. Die Bildhauerei kehrt zu der
durch die lebhaften Kontraste betonter Körperlichkeit im 13. Jahrhundert aufge-
hobenen Einheit des Blocks zurück und unterwirft sich von neuem dem Gesetz
der Fläche. Ihr Stil wird wieder linear, aber nicht mehr geometrisch, wie im
12. Jahrhundert, sondern kalligraphisch, »die Figur schreibt sich gleichsam vor die
Wand«. Das ist der wahre Erklärungsgrund für die oft so seltsamen Kurvaturen
der Gestalten und Gewänder im 14. Jahrhundert. Sie bedeuten unzweifelhaft eine
Herabminderung des Körperwerts im plastischen Sinne, zugleich aber eine offene
Bekundung des Willens zum Flächenschmuck, d. h. zur Malerei. Und dieser An-
trieb wird allmählich der herrschende. Er bedingt weiterhin auch eine gänzlich
veränderte Auffassung des Gegenständlichen: statt der Konzentration auf die Einzel-
gestalt das Drängen nach Verbindung und Handlung, nach Vorgang und Erlebnis,
und wäre es selbst nur das Spiel einer Gewandfalte. »Ein warmes und üppiges
Gefühl für Bewegung quillt hervor.« Die volle Konsequenz zieht erst das neue
Jahrhundert in der alles beherrschenden malerischen Auffassung und in der nun
entwickelten Kunst einer raumgestaltenden, Bewegungsillusion schaffenden Kunst
der Malerei selbst. Aber schon die Plastik des beginnenden Fünfzehnten denkt
ihre besten Gestalten — man braucht nur an Claux Sluter zu erinnern — als Bilder.
Im weiteren Verlaufe des Jahrhunderts vermag darum auch nur die Grundkraft der
Malerei selbst die verschiedenen Bildhauerschulen mit vorwärts zu schieben: sie
steigen auf, wo sie mit einer aufblühenden Malerei verbunden sind, wie in Mainz
und Nürnberg; in Würzburg, wo diese Verbindung fehlt, tritt schon um 1430 eine
Erstarrung ein, und erst unter ganz andersartigen Antrieben vermochte sich hier am
Ende des Jahrhunderts in Riemenschneider eine kurze Nachblüte zu entfalten.
Greifswald.
Max Semrau.
H. Fetzer, Einleitung in die plastische Anatomie für Künstler. Mit
18 Tafeln und ebensoviel Pausen. Tübingen, Verlag der H. Lauppschen Buch-
handlung, 1911.
Das Werkchen ist aus der Praxis des anatomischen Unterrichts an der Stutt-
garter Künstlerakademie hervorgegangen und für den Gebrauch von Kunstschülern
und Künstlern bestimmt. So weit ein Laie darüber zu urteilen vermag, wird es
diesem Zwecke namentlich auch durch die klaren und schönen Zeichnungen, denen
jedesmal eine Pause mit eingeschriebenen Bezifferungen beigegeben ist, in vollem
Maße entsprechen. Nur wenn in der Einleitung vom Texte des Buches gerühmt
wird: »er ist durchaus deutsch, um den Künstler in der geistigen Auffassung des
Stoffs nicht durch eine ihm fremde Namengebung zu behindern und zu stören« —
so hätte sich dieser löbliche Standpunkt wohl noch folgerichtiger durchführen lassen.
Ausdrücke wie das stets wiederholte inseriert, Funktion, ferner proniert, supiniert,