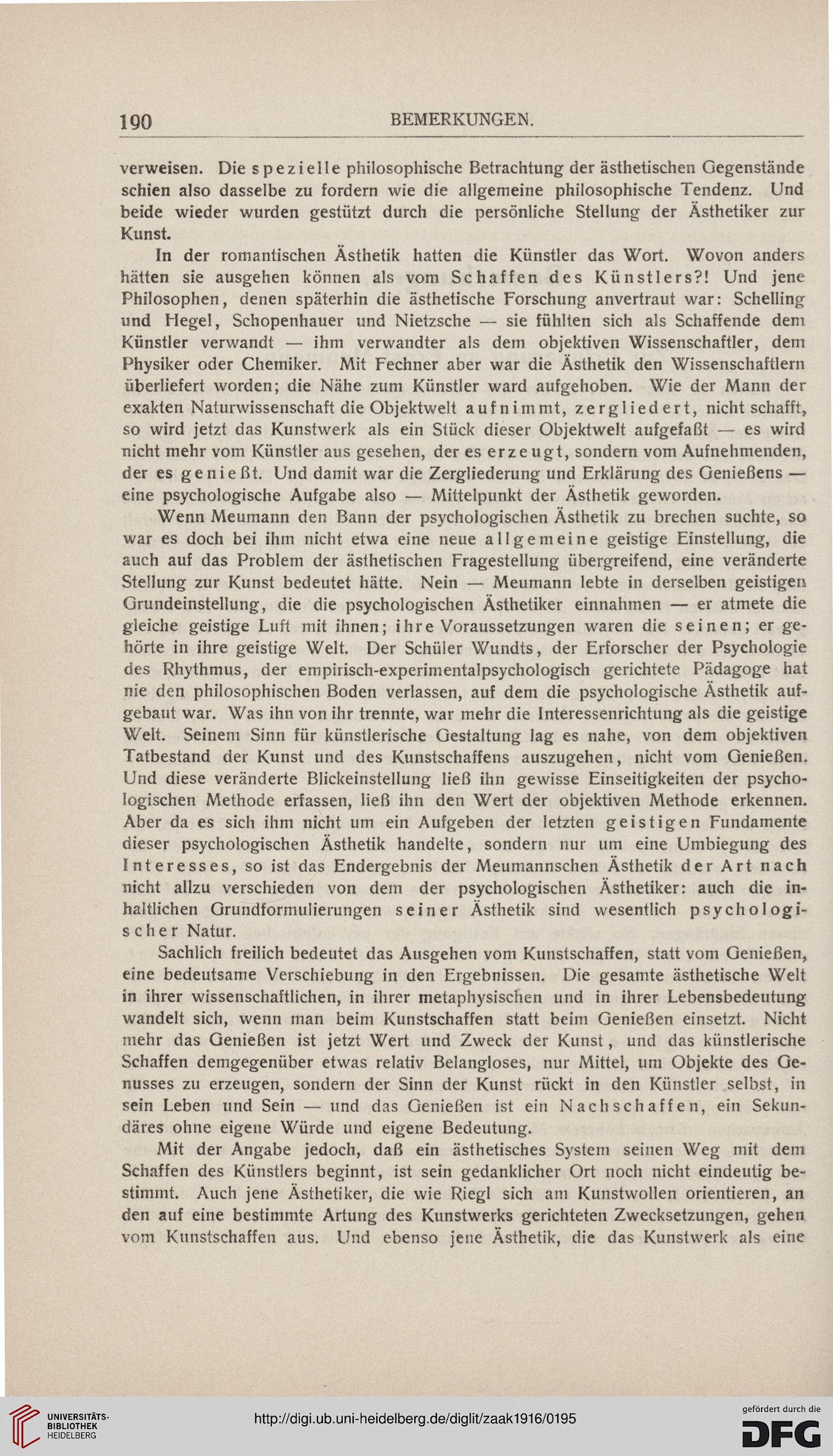1Q0 BEMERKUNGEN.
verweisen. Die spezielle philosophische Betrachtung der ästhetischen Gegenstände
schien also dasselbe zu fordern wie die allgemeine philosophische Tendenz. Und
beide wieder wurden gestützt durch die persönliche Stellung der Ästhetiker zur
Kunst.
In der romantischen Ästhetik hatten die Künstler das Wort. Wovon anders
hätten sie ausgehen können als vom Schaffen des Künstlers?! Und jene
Philosophen, denen späterhin die ästhetische Forschung anvertraut war: Schelling
und Hegel, Schopenhauer und Nietzsche — sie fühlten sich als Schaffende dem
Künstler verwandt — ihm verwandter als dem objektiven Wissenschaftler, dem
Physiker oder Chemiker. Mit Fechner aber war die Ästhetik den Wissenschaftlern
überliefert worden; die Nähe zum Künstler ward aufgehoben. Wie der Mann der
exakten Naturwissenschaft die Objektwelt aufnimmt, zergliedert, nicht schafft,
so wird jetzt das Kunstwerk als ein Stück dieser Objektwelt aufgefaßt — es wird
nicht mehr vom Künstler aus gesehen, der es erzeugt, sondern vom Aufnehmenden,
der es genießt. Und damit war die Zergliederung und Erklärung des Genießens —
eine psychologische Aufgabe also — Mittelpunkt der Ästhetik geworden.
Wenn Meumann den Bann der psychologischen Ästhetik zu brechen suchte, so
war es doch bei ihm nicht etwa eine neue allgemeine geistige Einstellung, die
auch auf das Problem der ästhetischen Fragestellung übergreifend, eine veränderte
Stellung zur Kunst bedeutet hätte. Nein — Meumann lebte in derselben geistigen
Grundeinstellung, die die psychologischen Ästhetiker einnahmen — er atmete die
gleiche geistige Luft mit ihnen; ihre Voraussetzungen waren die seinen; er ge-
hörte in ihre geistige Welt. Der Schüler Wundts, der Erforscher der Psychologie
des Rhythmus, der empirisch-experimentalpsychologisch gerichtete Pädagoge hat
nie den philosophischen Boden verlassen, auf dem die psychologische Ästhetik auf-
gebaut war. Was ihn von ihr trennte, war mehr die Interessenrichtung als die geistige
Welt. Seinem Sinn für künstlerische Gestaltung lag es nahe, von dem objektiven
Tatbestand der Kunst und des Kunstschaffens auszugehen, nicht vom Genießen.
Und diese veränderte Blickeinstellung ließ ihn gewisse Einseitigkeiten der psycho-
logischen Methode erfassen, ließ ihn den Wert der objektiven Methode erkennen.
Aber da es sich ihm nicht um ein Aufgeben der letzten geistigen Fundamente
dieser psychologischen Ästhetik handelte, sondern nur um eine Umbiegung des
Interesses, so ist das Endergebnis der Meumannschen Ästhetik der Art nach
nicht allzu verschieden von dem der psychologischen Ästhetiker: auch die in-
haltlichen Grundformulierungen seiner Ästhetik sind wesentlich psychologi-
scher Natur.
Sachlich freilich bedeutet das Ausgehen vom Kunstschaffen, statt vom Genießen,
eine bedeutsame Verschiebung in den Ergebnissen. Die gesamte ästhetische Welt
in ihrer wissenschaftlichen, in ihrer metaphysischen und in ihrer Lebensbedeutung
wandelt sich, wenn man beim Kunstschaffen statt beim Genießen einsetzt. Nicht
mehr das Genießen ist jetzt Wert und Zweck der Kunst, und das künstlerische
Schaffen demgegenüber etwas relativ Belangloses, nur Mittel, um Objekte des Ge-
nusses zu erzeugen, sondern der Sinn der Kunst rückt in den Künstler selbst, in
sein Leben und Sein — und das Genießen ist ein Nach seh äff en, ein Sekun-
däres ohne eigene Würde und eigene Bedeutung.
Mit der Angabe jedoch, daß ein ästhetisches System seinen Weg mit dem
Schaffen des Künstlers beginnt, ist sein gedanklicher Ort noch nicht eindeutig be-
stimmt. Auch jene Ästhetiker, die wie Riegl sich am Kunstwollen orientieren, an
den auf eine bestimmte Artung des Kunstwerks gerichteten Zwecksetzungen, gehen
vom Kunstschaffen aus. Und ebenso jene Ästhetik, die das Kunstwerk als eine