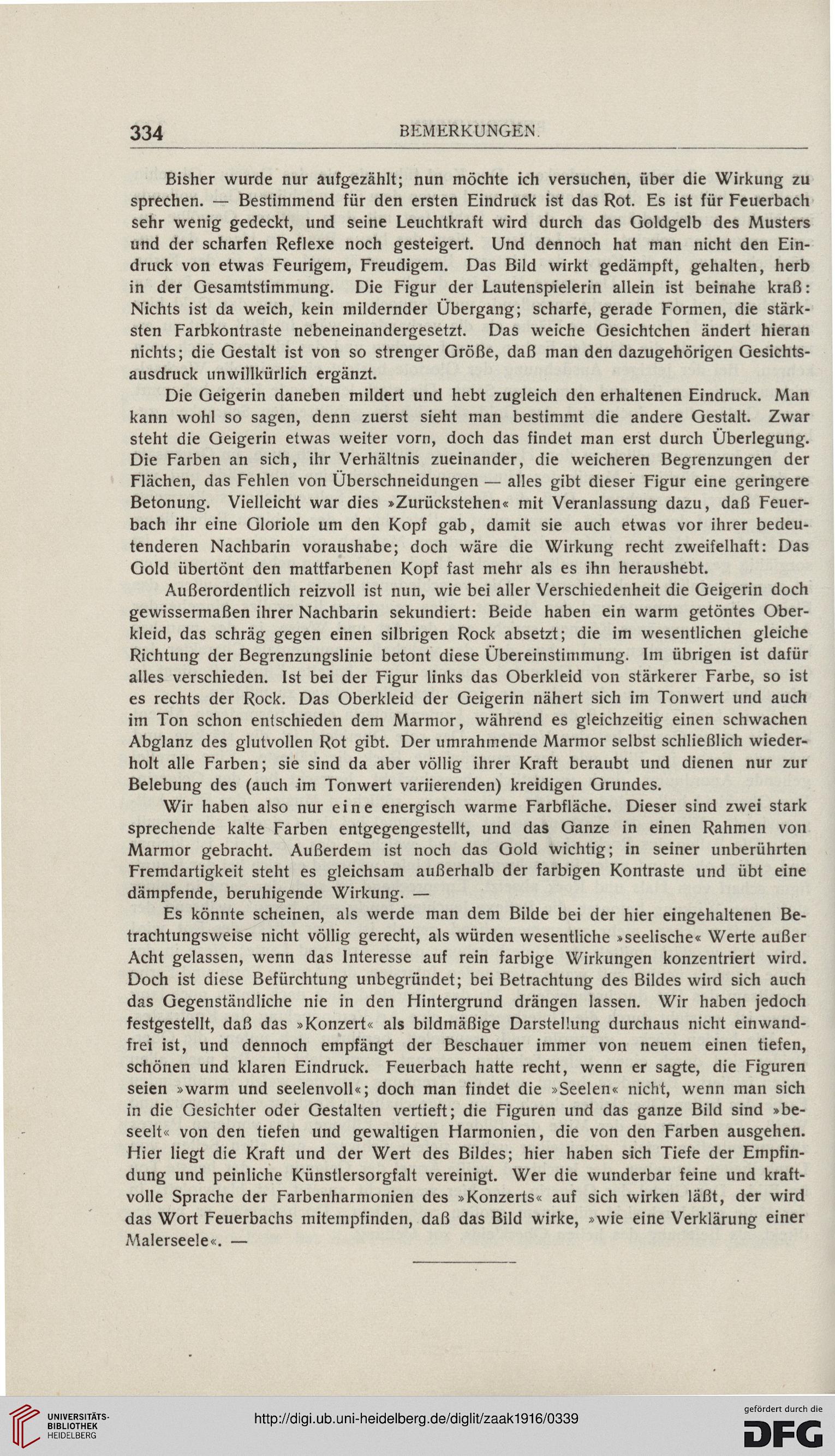334 BEMERKUNGEN
Bisher wurde nur aufgezählt; nun möchte ich versuchen, über die Wirkung zu
sprechen. — Bestimmend für den ersten Eindruck ist das Rot. Es ist für Feuerbach
sehr wenig gedeckt, und seine Leuchtkraft wird durch das Goldgelb des Musters
und der scharfen Reflexe noch gesteigert. Und dennoch hat man nicht den Ein-
druck von etwas Feurigem, Freudigem. Das Bild wirkt gedämpft, gehalten, herb
in der Gesamtstimmung. Die Figur der Lautenspielerin allein ist beinahe kraß:
Nichts ist da weich, kein mildernder Übergang; scharfe, gerade Formen, die stärk-
sten Farbkontraste nebeneinandergesetzt. Das weiche Gesichtchen ändert hieran
nichts; die Gestalt ist von so strenger Größe, daß man den dazugehörigen Gesichts-
ausdruck unwillkürlich ergänzt.
Die Geigerin daneben mildert und hebt zugleich den erhaltenen Eindruck. Man
kann wohl so sagen, denn zuerst sieht man bestimmt die andere Gestalt. Zwar
steht die Geigerin etwas weiter vorn, doch das findet man erst durch Überlegung.
Die Farben an sich, ihr Verhältnis zueinander, die weicheren Begrenzungen der
Flächen, das Fehlen von Überschneidungen — alles gibt dieser Figur eine geringere
Betonung. Vielleicht war dies »Zurückstehen« mit Veranlassung dazu, daß Feuer-
bach ihr eine Gloriole um den Kopf gab, damit sie auch etwas vor ihrer bedeu-
tenderen Nachbarin voraushabe; doch wäre die Wirkung recht zweifelhaft: Das
Gold übertönt den mattfarbenen Kopf fast mehr als es ihn heraushebt.
Außerordentlich reizvoll ist nun, wie bei aller Verschiedenheit die Geigerin doch
gewissermaßen ihrer Nachbarin sekundiert: Beide haben ein warm getöntes Ober-
kleid, das schräg gegen einen silbrigen Rock absetzt; die im wesentlichen gleiche
Richtung der Begrenzungslinie betont diese Übereinstimmung. Im übrigen ist dafür
alles verschieden. Ist bei der Figur links das Oberkleid von stärkerer Farbe, so ist
es rechts der Rock. Das Oberkleid der Geigerin nähert sich im Tonwert und auch
im Ton schon entschieden dem Marmor, während es gleichzeitig einen schwachen
Abglanz des glutvollen Rot gibt. Der umrahmende Marmor selbst schließlich wieder-
holt alle Farben; sie sind da aber völlig ihrer Kraft beraubt und dienen nur zur
Belebung des (auch im Tonwert variierenden) kreidigen Grundes.
Wir haben also nur eine energisch warme Farbfläche. Dieser sind zwei stark
sprechende kalte Farben entgegengestellt, und das Ganze in einen Rahmen von
Marmor gebracht. Außerdem ist noch das Gold wichtig; in seiner unberührten
Fremdartigkeit steht es gleichsam außerhalb der farbigen Kontraste und übt eine
dämpfende, beruhigende Wirkung. —
Es könnte scheinen, als werde man dem Bilde bei der hier eingehaltenen Be-
trachtungsweise nicht völlig gerecht, als würden wesentliche »seelische« Werte außer
Acht gelassen, wenn das Interesse auf rein farbige Wirkungen konzentriert wird.
Doch ist diese Befürchtung unbegründet; bei Betrachtung des Bildes wird sich auch
das Gegenständliche nie in den Hintergrund drängen lassen. Wir haben jedoch
festgestellt, daß das »Konzert« als bildmäßige Darstellung durchaus nicht einwand-
frei ist, und dennoch empfängt der Beschauer immer von neuem einen tiefen,
schönen und klaren Eindruck. Feuerbach hatte recht, wenn er sagte, die Figuren
seien »warm und seelenvoll«; doch man findet die »Seelen« nicht, wenn man sich
in die Gesichter oder Gestalten vertieft; die Figuren und das ganze Bild sind »be-
seelt« von den tiefen und gewaltigen Harmonien, die von den Farben ausgehen.
Hier liegt die Kraft und der Wert des Bildes; hier haben sich Tiefe der Empfin-
dung und peinliche Künstlersorgfalt vereinigt. Wer die wunderbar feine und kraft-
volle Sprache der Farbenharmonien des »Konzerts« auf sich wirken läßt, der wird
das Wort Feuerbachs mitempfinden, daß das Bild wirke, »wie eine Verklärung einer
Malerseele«. —
Bisher wurde nur aufgezählt; nun möchte ich versuchen, über die Wirkung zu
sprechen. — Bestimmend für den ersten Eindruck ist das Rot. Es ist für Feuerbach
sehr wenig gedeckt, und seine Leuchtkraft wird durch das Goldgelb des Musters
und der scharfen Reflexe noch gesteigert. Und dennoch hat man nicht den Ein-
druck von etwas Feurigem, Freudigem. Das Bild wirkt gedämpft, gehalten, herb
in der Gesamtstimmung. Die Figur der Lautenspielerin allein ist beinahe kraß:
Nichts ist da weich, kein mildernder Übergang; scharfe, gerade Formen, die stärk-
sten Farbkontraste nebeneinandergesetzt. Das weiche Gesichtchen ändert hieran
nichts; die Gestalt ist von so strenger Größe, daß man den dazugehörigen Gesichts-
ausdruck unwillkürlich ergänzt.
Die Geigerin daneben mildert und hebt zugleich den erhaltenen Eindruck. Man
kann wohl so sagen, denn zuerst sieht man bestimmt die andere Gestalt. Zwar
steht die Geigerin etwas weiter vorn, doch das findet man erst durch Überlegung.
Die Farben an sich, ihr Verhältnis zueinander, die weicheren Begrenzungen der
Flächen, das Fehlen von Überschneidungen — alles gibt dieser Figur eine geringere
Betonung. Vielleicht war dies »Zurückstehen« mit Veranlassung dazu, daß Feuer-
bach ihr eine Gloriole um den Kopf gab, damit sie auch etwas vor ihrer bedeu-
tenderen Nachbarin voraushabe; doch wäre die Wirkung recht zweifelhaft: Das
Gold übertönt den mattfarbenen Kopf fast mehr als es ihn heraushebt.
Außerordentlich reizvoll ist nun, wie bei aller Verschiedenheit die Geigerin doch
gewissermaßen ihrer Nachbarin sekundiert: Beide haben ein warm getöntes Ober-
kleid, das schräg gegen einen silbrigen Rock absetzt; die im wesentlichen gleiche
Richtung der Begrenzungslinie betont diese Übereinstimmung. Im übrigen ist dafür
alles verschieden. Ist bei der Figur links das Oberkleid von stärkerer Farbe, so ist
es rechts der Rock. Das Oberkleid der Geigerin nähert sich im Tonwert und auch
im Ton schon entschieden dem Marmor, während es gleichzeitig einen schwachen
Abglanz des glutvollen Rot gibt. Der umrahmende Marmor selbst schließlich wieder-
holt alle Farben; sie sind da aber völlig ihrer Kraft beraubt und dienen nur zur
Belebung des (auch im Tonwert variierenden) kreidigen Grundes.
Wir haben also nur eine energisch warme Farbfläche. Dieser sind zwei stark
sprechende kalte Farben entgegengestellt, und das Ganze in einen Rahmen von
Marmor gebracht. Außerdem ist noch das Gold wichtig; in seiner unberührten
Fremdartigkeit steht es gleichsam außerhalb der farbigen Kontraste und übt eine
dämpfende, beruhigende Wirkung. —
Es könnte scheinen, als werde man dem Bilde bei der hier eingehaltenen Be-
trachtungsweise nicht völlig gerecht, als würden wesentliche »seelische« Werte außer
Acht gelassen, wenn das Interesse auf rein farbige Wirkungen konzentriert wird.
Doch ist diese Befürchtung unbegründet; bei Betrachtung des Bildes wird sich auch
das Gegenständliche nie in den Hintergrund drängen lassen. Wir haben jedoch
festgestellt, daß das »Konzert« als bildmäßige Darstellung durchaus nicht einwand-
frei ist, und dennoch empfängt der Beschauer immer von neuem einen tiefen,
schönen und klaren Eindruck. Feuerbach hatte recht, wenn er sagte, die Figuren
seien »warm und seelenvoll«; doch man findet die »Seelen« nicht, wenn man sich
in die Gesichter oder Gestalten vertieft; die Figuren und das ganze Bild sind »be-
seelt« von den tiefen und gewaltigen Harmonien, die von den Farben ausgehen.
Hier liegt die Kraft und der Wert des Bildes; hier haben sich Tiefe der Empfin-
dung und peinliche Künstlersorgfalt vereinigt. Wer die wunderbar feine und kraft-
volle Sprache der Farbenharmonien des »Konzerts« auf sich wirken läßt, der wird
das Wort Feuerbachs mitempfinden, daß das Bild wirke, »wie eine Verklärung einer
Malerseele«. —