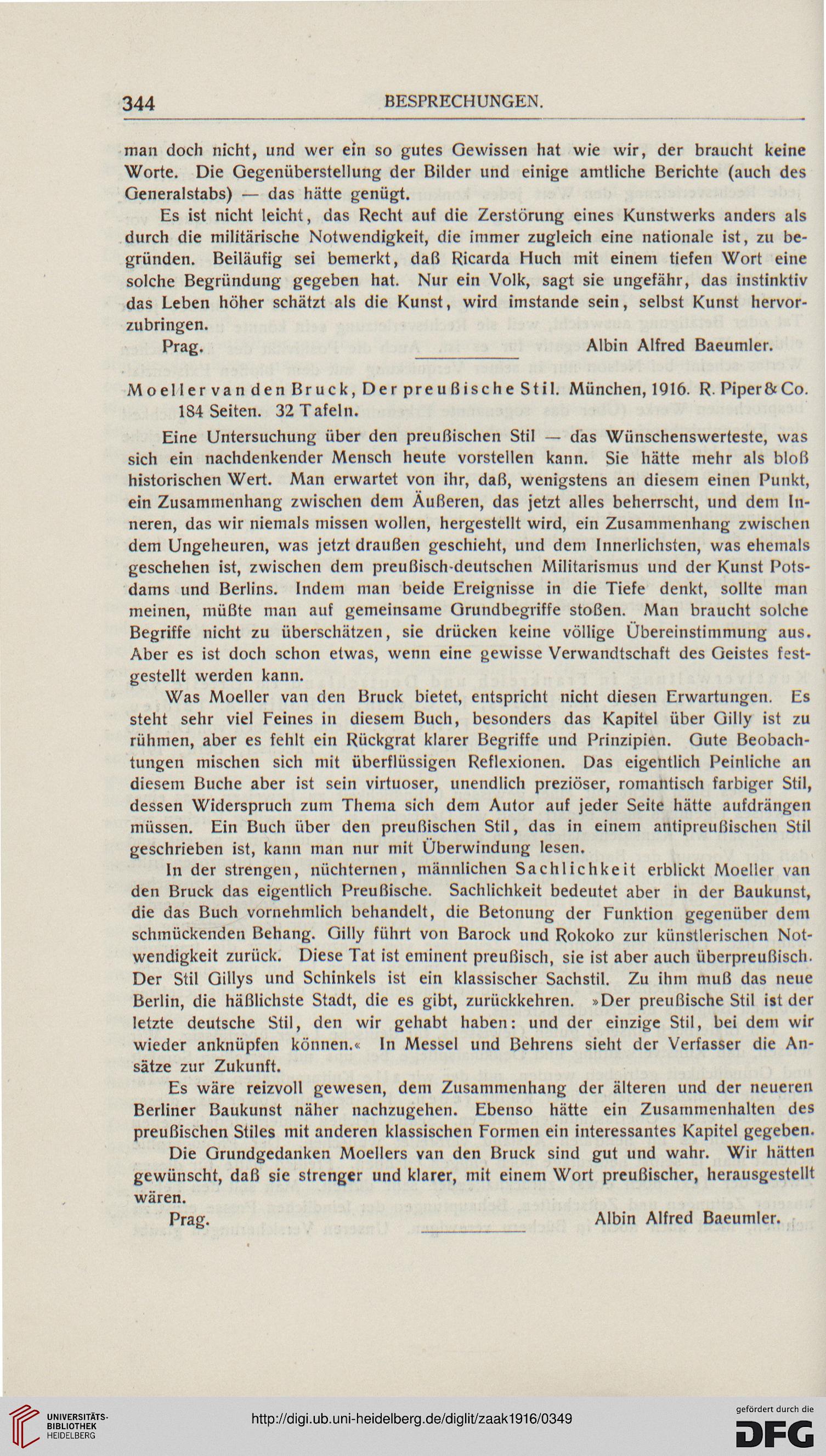man doch nicht, und wer ein so gutes Gewissen hat wie wir, der braucht keine
Worte. Die Gegenüberstellung der Bilder und einige amtliche Berichte (auch des
Generalstabs) — das hätte genügt.
Es ist nicht leicht, das Recht auf die Zerstörung eines Kunstwerks anders als
durch die militärische Notwendigkeit, die immer zugleich eine nationale ist, zu be-
gründen. Beiläufig sei bemerkt, daß Ricarda Huch mit einem tiefen Wort eine
solche Begründung gegeben hat. Nur ein Volk, sagt sie ungefähr, das instinktiv
das Leben höher schätzt als die Kunst, wird imstande sein, selbst Kunst hervor-
zubringen.
Prag. Albin Alfred Baeumler.
Moeller van den Brück, Der preußische Stil. München, 1916. R. Piper & Co.
184 Seiten. 32 Tafeln.
Eine Untersuchung über den preußischen Stil — das Wünschenswerteste, was
sich ein nachdenkender Mensch heute vorstellen kann. Sie hätte mehr als bloß
historischen Wert. Man erwartet von ihr, daß, wenigstens an diesem einen Punkt,
ein Zusammenhang zwischen dem Äußeren, das jetzt alles beherrscht, und dem In-
neren, das wir niemals missen wollen, hergestellt wird, ein Zusammenhang zwischen
dem Ungeheuren, was jetzt draußen geschieht, und dem Innerlichsten, was ehemals
geschehen ist, zwischen dem preußisch-deutschen Militarismus und der Kunst Pots-
dams und Berlins. Indem man beide Ereignisse in die Tiefe denkt, sollte man
meinen, müßte man auf gemeinsame Grundbegriffe stoßen. Man braucht solche
Begriffe nicht zu überschätzen, sie drücken keine völlige Übereinstimmung aus.
Aber es ist doch schon etwas, wenn eine gewisse Verwandtschaft des Geistes fest-
gestellt werden kann.
Was Moeller van den Brück bietet, entspricht nicht diesen Erwartungen. Es
steht sehr viel Feines in diesem Buch, besonders das Kapitel über Gilly ist zu
rühmen, aber es fehlt ein Rückgrat klarer Begriffe und Prinzipien. Gute Beobach-
tungen mischen sich mit überflüssigen Reflexionen. Das eigentlich Peinliche an
diesem Buche aber ist sein virtuoser, unendlich preziöser, romantisch farbiger Stil,
dessen Widerspruch zum Thema sich dem Autor auf jeder Seite hätte aufdrängen
müssen. Ein Buch über den preußischen Stil, das in einem antipreußischen Stil
geschrieben ist, kann man nur mit Überwindung lesen.
In der strengen, nüchternen, männlichen Sachlichkeit erblickt Moeller van
den Brück das eigentlich Preußische. Sachlichkeit bedeutet aber in der Baukunst,
die das Buch vornehmlich behandelt, die Betonung der Funktion gegenüber dem
schmückenden Behang. Gilly führt von Barock und Rokoko zur künstlerischen Not-
wendigkeit zurück. Diese Tat ist eminent preußisch, sie ist aber auch überpreußisch.
Der Stil Gillys und Schinkels ist ein klassischer Sachstil. Zu ihm muß das neue
Berlin, die häßlichste Stadt, die es gibt, zurückkehren. »Der preußische Stil ist der
letzte deutsche Stil, den wir gehabt haben: und der einzige Stil, bei dem wir
wieder anknüpfen können.« In Messel und Behrens sieht der Verfasser die An-
sätze zur Zukunft.
Es wäre reizvoll gewesen, dem Zusammenhang der älteren und der neueren
Berliner Baukunst näher nachzugehen. Ebenso hätte ein Zusammenhalten des
preußischen Stiles mit anderen klassischen Formen ein interessantes Kapitel gegeben.
Die Grundgedanken Moellers van den Brück sind gut und wahr. Wir hätten
gewünscht, daß sie strenger und klarer, mit einem Wort preußischer, herausgestellt
wären.
Prag. Albin Alfred Baeumler.
Worte. Die Gegenüberstellung der Bilder und einige amtliche Berichte (auch des
Generalstabs) — das hätte genügt.
Es ist nicht leicht, das Recht auf die Zerstörung eines Kunstwerks anders als
durch die militärische Notwendigkeit, die immer zugleich eine nationale ist, zu be-
gründen. Beiläufig sei bemerkt, daß Ricarda Huch mit einem tiefen Wort eine
solche Begründung gegeben hat. Nur ein Volk, sagt sie ungefähr, das instinktiv
das Leben höher schätzt als die Kunst, wird imstande sein, selbst Kunst hervor-
zubringen.
Prag. Albin Alfred Baeumler.
Moeller van den Brück, Der preußische Stil. München, 1916. R. Piper & Co.
184 Seiten. 32 Tafeln.
Eine Untersuchung über den preußischen Stil — das Wünschenswerteste, was
sich ein nachdenkender Mensch heute vorstellen kann. Sie hätte mehr als bloß
historischen Wert. Man erwartet von ihr, daß, wenigstens an diesem einen Punkt,
ein Zusammenhang zwischen dem Äußeren, das jetzt alles beherrscht, und dem In-
neren, das wir niemals missen wollen, hergestellt wird, ein Zusammenhang zwischen
dem Ungeheuren, was jetzt draußen geschieht, und dem Innerlichsten, was ehemals
geschehen ist, zwischen dem preußisch-deutschen Militarismus und der Kunst Pots-
dams und Berlins. Indem man beide Ereignisse in die Tiefe denkt, sollte man
meinen, müßte man auf gemeinsame Grundbegriffe stoßen. Man braucht solche
Begriffe nicht zu überschätzen, sie drücken keine völlige Übereinstimmung aus.
Aber es ist doch schon etwas, wenn eine gewisse Verwandtschaft des Geistes fest-
gestellt werden kann.
Was Moeller van den Brück bietet, entspricht nicht diesen Erwartungen. Es
steht sehr viel Feines in diesem Buch, besonders das Kapitel über Gilly ist zu
rühmen, aber es fehlt ein Rückgrat klarer Begriffe und Prinzipien. Gute Beobach-
tungen mischen sich mit überflüssigen Reflexionen. Das eigentlich Peinliche an
diesem Buche aber ist sein virtuoser, unendlich preziöser, romantisch farbiger Stil,
dessen Widerspruch zum Thema sich dem Autor auf jeder Seite hätte aufdrängen
müssen. Ein Buch über den preußischen Stil, das in einem antipreußischen Stil
geschrieben ist, kann man nur mit Überwindung lesen.
In der strengen, nüchternen, männlichen Sachlichkeit erblickt Moeller van
den Brück das eigentlich Preußische. Sachlichkeit bedeutet aber in der Baukunst,
die das Buch vornehmlich behandelt, die Betonung der Funktion gegenüber dem
schmückenden Behang. Gilly führt von Barock und Rokoko zur künstlerischen Not-
wendigkeit zurück. Diese Tat ist eminent preußisch, sie ist aber auch überpreußisch.
Der Stil Gillys und Schinkels ist ein klassischer Sachstil. Zu ihm muß das neue
Berlin, die häßlichste Stadt, die es gibt, zurückkehren. »Der preußische Stil ist der
letzte deutsche Stil, den wir gehabt haben: und der einzige Stil, bei dem wir
wieder anknüpfen können.« In Messel und Behrens sieht der Verfasser die An-
sätze zur Zukunft.
Es wäre reizvoll gewesen, dem Zusammenhang der älteren und der neueren
Berliner Baukunst näher nachzugehen. Ebenso hätte ein Zusammenhalten des
preußischen Stiles mit anderen klassischen Formen ein interessantes Kapitel gegeben.
Die Grundgedanken Moellers van den Brück sind gut und wahr. Wir hätten
gewünscht, daß sie strenger und klarer, mit einem Wort preußischer, herausgestellt
wären.
Prag. Albin Alfred Baeumler.