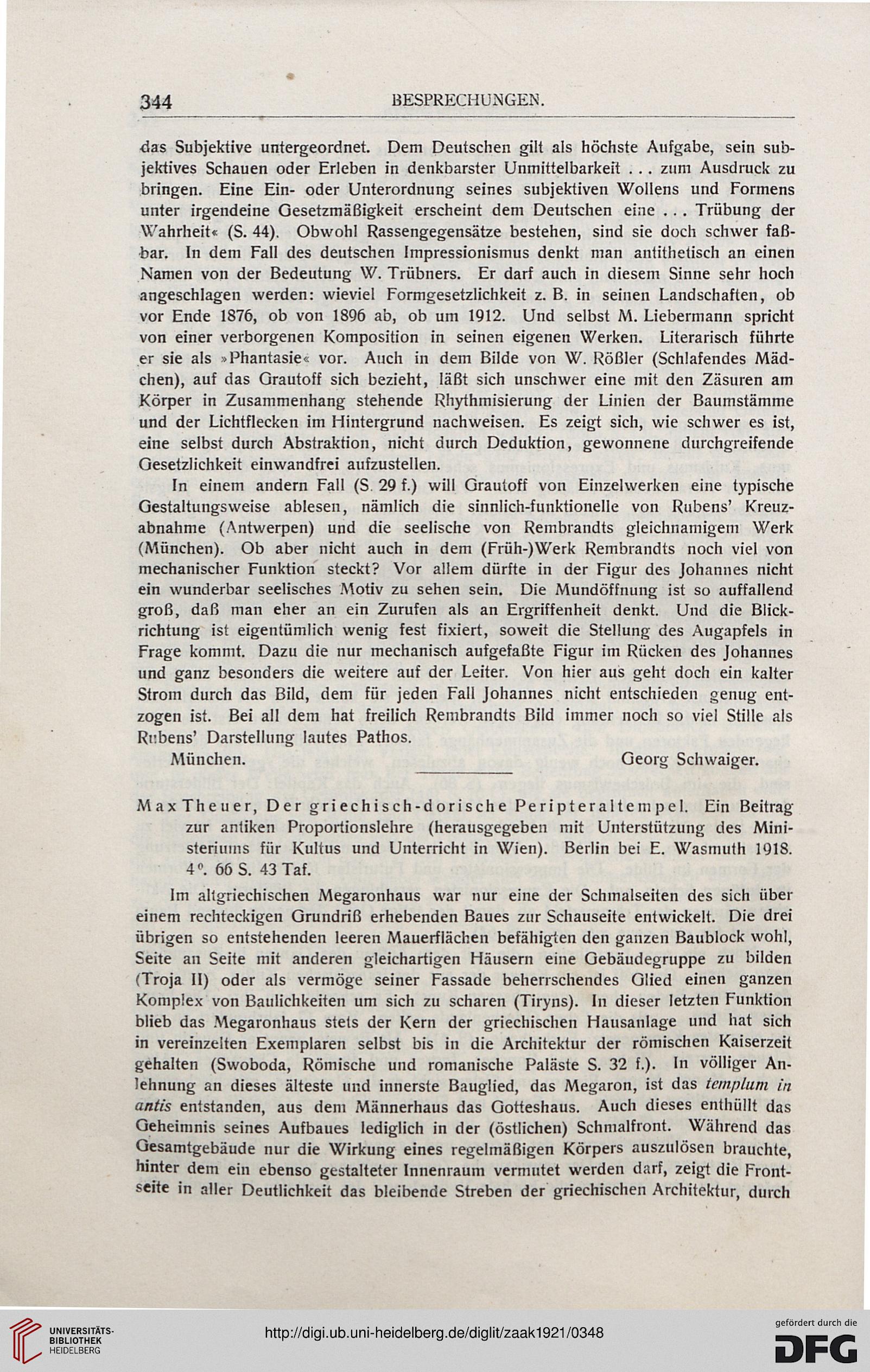344 BESPRECHUNGEN.
das Subjektive untergeordnet. Dem Deutschen gilt als höchste Aufgabe, sein sub-
jektives Schauen oder Erleben in denkbarster Unmittelbarkeit . .. zum Ausdruck zu
bringen. Eine Ein- oder Unterordnung seines subjektiven Wollens und Formens
unter irgendeine Gesetzmäßigkeit erscheint dem Deutschen eine .. . Trübung der
Wahrheit« (S. 44). Obwohl Rassengegensätze bestehen, sind sie doch schwer faß-
bar. In dem Fall des deutschen Impressionismus denkt man antithetisch an einen
Namen von der Bedeutung W. Trübners. Er darf auch in diesem Sinne sehr hoch
angeschlagen werden: wieviel Formgesetzlichkeit z. B. in seinen Landschaften, ob
vor Ende 1876, ob von 1896 ab, ob um 1912. Und selbst M. Liebermann spricht
von einer verborgenen Komposition in seinen eigenen Werken. Literarisch führte
er sie als »Phantasie« vor. Auch in dem Bilde von W. Rößler (Schlafendes Mäd-
chen), auf das Grautoff sich bezieht, läßt sich unschwer eine mit den Zäsuren am
Körper in Zusammenhang stehende Rhythmisierung der Linien der Baumstämme
und der Lichtflecken im Hintergrund nachweisen. Es zeigt sich, wie schwer es ist,
eine selbst durch Abstraktion, nicht durch Deduktion, gewonnene durchgreifende
Gesetzlichkeit einwandfrei aufzustellen.
In einem andern Fall (S. 29 f.) will Grautoff von Einzelwerken eine typische
Gestaltungsweise ablesen, nämlich die sinnlich-funktionelle von Rubens' Kreuz-
abnahme (Antwerpen) und die seelische von Rembrandts gleichnamigem Werk
(München). Ob aber nicht auch in dem (Früh-)Werk Rembrandts noch viel von
mechanischer Funktion steckt? Vor allem dürfte in der Figur des Johannes nicht
ein wunderbar seelisches Motiv zu sehen sein. Die Mundöffnung ist so auffallend
groß, daß man eher an ein Zurufen als an Ergriffenheit denkt. Und die Blick-
richtung ist eigentümlich wenig fest fixiert, soweit die Stellung des Augapfels in
Frage kommt. Dazu die nur mechanisch aufgefaßte Figur im Rücken des Johannes
und ganz besonders die weitere auf der Leiter. Von hier aus geht doch ein kalter
Strom durch das Bild, dem für jeden Fall Johannes nicht entschieden genug ent-
zogen ist. Bei all dem hat freilich Rembrandts Bild immer noch so viel Stille als
Rubens' Darstellung lautes Pathos.
München. Georg Schwaiger.
MaxTheuer, Der griechisch-dorische Peripteraltempel. Ein Beitrag
zur antiken Proportionslehre (herausgegeben mit Unterstützung des Mini-
steriums für Kultus und Unterricht in Wien). Berlin bei E. Wasmuth 1918.
4". 66 S. 43Taf.
Im altgriechischen Megaronhaus war nur eine der Schmalseiten des sich über
einem rechteckigen Grundriß erhebenden Baues zur Schauseite entwickelt. Die drei
übrigen so entstehenden leeren Mauerflächen befähigten den ganzen Baublock wohl,
Seite an Seite mit anderen gleichartigen Häusern eine Gebäudegruppe zu bilden
(Troja II) oder als vermöge seiner Fassade beherrschendes Glied einen ganzen
Komplex von Baulichkeiten um sich zu scharen (Tiryns). In dieser letzten Funktion
blieb das Megaronhaus stets der Kern der griechischen Hausanlage und hat sich
in vereinzelten Exemplaren selbst bis in die Architektur der römischen Kaiserzeit
gehalten (Swoboda, Römische und romanische Paläste S. 32 f.). In völliger An-
lehnung an dieses älteste und innerste Bauglied, das Megaron, ist das tanplum in
antis entstanden, aus dem Männerhaus das Gotteshaus. Auch dieses enthüllt das
Geheimnis seines Aufbaues lediglich in der (östlichen) Schmalfront. Während das
Gesamtgebäude nur die Wirkung eines regelmäßigen Körpers auszulösen brauchte,
hinter dem ein ebenso gestalteter Innenraum vermutet werden darf, zeigt die Front-
seite in aller Deutlichkeit das bleibende Streben der griechischen Architektur, durch
das Subjektive untergeordnet. Dem Deutschen gilt als höchste Aufgabe, sein sub-
jektives Schauen oder Erleben in denkbarster Unmittelbarkeit . .. zum Ausdruck zu
bringen. Eine Ein- oder Unterordnung seines subjektiven Wollens und Formens
unter irgendeine Gesetzmäßigkeit erscheint dem Deutschen eine .. . Trübung der
Wahrheit« (S. 44). Obwohl Rassengegensätze bestehen, sind sie doch schwer faß-
bar. In dem Fall des deutschen Impressionismus denkt man antithetisch an einen
Namen von der Bedeutung W. Trübners. Er darf auch in diesem Sinne sehr hoch
angeschlagen werden: wieviel Formgesetzlichkeit z. B. in seinen Landschaften, ob
vor Ende 1876, ob von 1896 ab, ob um 1912. Und selbst M. Liebermann spricht
von einer verborgenen Komposition in seinen eigenen Werken. Literarisch führte
er sie als »Phantasie« vor. Auch in dem Bilde von W. Rößler (Schlafendes Mäd-
chen), auf das Grautoff sich bezieht, läßt sich unschwer eine mit den Zäsuren am
Körper in Zusammenhang stehende Rhythmisierung der Linien der Baumstämme
und der Lichtflecken im Hintergrund nachweisen. Es zeigt sich, wie schwer es ist,
eine selbst durch Abstraktion, nicht durch Deduktion, gewonnene durchgreifende
Gesetzlichkeit einwandfrei aufzustellen.
In einem andern Fall (S. 29 f.) will Grautoff von Einzelwerken eine typische
Gestaltungsweise ablesen, nämlich die sinnlich-funktionelle von Rubens' Kreuz-
abnahme (Antwerpen) und die seelische von Rembrandts gleichnamigem Werk
(München). Ob aber nicht auch in dem (Früh-)Werk Rembrandts noch viel von
mechanischer Funktion steckt? Vor allem dürfte in der Figur des Johannes nicht
ein wunderbar seelisches Motiv zu sehen sein. Die Mundöffnung ist so auffallend
groß, daß man eher an ein Zurufen als an Ergriffenheit denkt. Und die Blick-
richtung ist eigentümlich wenig fest fixiert, soweit die Stellung des Augapfels in
Frage kommt. Dazu die nur mechanisch aufgefaßte Figur im Rücken des Johannes
und ganz besonders die weitere auf der Leiter. Von hier aus geht doch ein kalter
Strom durch das Bild, dem für jeden Fall Johannes nicht entschieden genug ent-
zogen ist. Bei all dem hat freilich Rembrandts Bild immer noch so viel Stille als
Rubens' Darstellung lautes Pathos.
München. Georg Schwaiger.
MaxTheuer, Der griechisch-dorische Peripteraltempel. Ein Beitrag
zur antiken Proportionslehre (herausgegeben mit Unterstützung des Mini-
steriums für Kultus und Unterricht in Wien). Berlin bei E. Wasmuth 1918.
4". 66 S. 43Taf.
Im altgriechischen Megaronhaus war nur eine der Schmalseiten des sich über
einem rechteckigen Grundriß erhebenden Baues zur Schauseite entwickelt. Die drei
übrigen so entstehenden leeren Mauerflächen befähigten den ganzen Baublock wohl,
Seite an Seite mit anderen gleichartigen Häusern eine Gebäudegruppe zu bilden
(Troja II) oder als vermöge seiner Fassade beherrschendes Glied einen ganzen
Komplex von Baulichkeiten um sich zu scharen (Tiryns). In dieser letzten Funktion
blieb das Megaronhaus stets der Kern der griechischen Hausanlage und hat sich
in vereinzelten Exemplaren selbst bis in die Architektur der römischen Kaiserzeit
gehalten (Swoboda, Römische und romanische Paläste S. 32 f.). In völliger An-
lehnung an dieses älteste und innerste Bauglied, das Megaron, ist das tanplum in
antis entstanden, aus dem Männerhaus das Gotteshaus. Auch dieses enthüllt das
Geheimnis seines Aufbaues lediglich in der (östlichen) Schmalfront. Während das
Gesamtgebäude nur die Wirkung eines regelmäßigen Körpers auszulösen brauchte,
hinter dem ein ebenso gestalteter Innenraum vermutet werden darf, zeigt die Front-
seite in aller Deutlichkeit das bleibende Streben der griechischen Architektur, durch