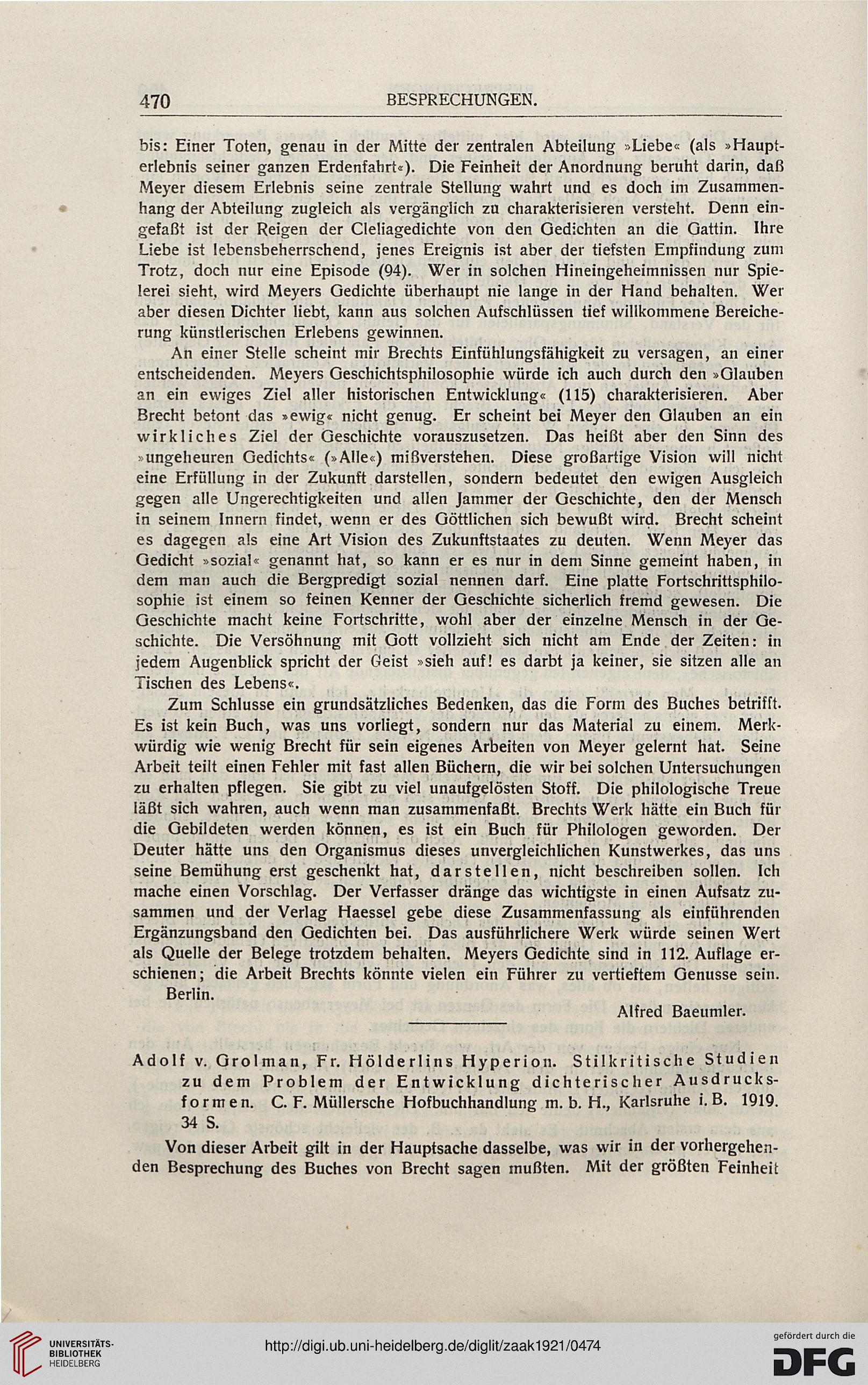470 BESPRECHUNGEN.
bis: Einer Toten, genau in der Mitte der zentralen Abteilung »Liebe« (als »Haupt-
erlebnis seiner ganzen Erdenfabrt«). Die Feinheit der Anordnung beruht darin, daß
Meyer diesem Erlebnis seine zentrale Stellung wahrt und es doch im Zusammen-
hang der Abteilung zugleich als vergänglich zu charakterisieren versteht. Denn ein-
gefaßt ist der Reigen der Cleliagedichte von den Gedichten an die Gattin. Ihre
Liebe ist lebensbeherrschend, jenes Ereignis ist aber der tiefsten Empfindung zum
Trotz, doch nur eine Episode (94). Wer in solchen Hineingeheimnissen nur Spie-
lerei sieht, wird Meyers Gedichte überhaupt nie lange in der Hand behalten. Wer
aber diesen Dichter liebt, kann aus solchen Aufschlüssen tief willkommene Bereiche-
rung künstlerischen Erlebens gewinnen.
An einer Stelle scheint mir Brechts Einfühlungsfähigkeit zu versagen, an einer
entscheidenden. Meyers Geschichtsphilosophie würde ich auch durch den »Glauben
an ein ewiges Ziel aller historischen Entwicklung« (115) charakterisieren. Aber
Brecht betont das »ewig« nicht genug. Er scheint bei Meyer den Glauben an ein
wirkliches Ziel der Geschichte vorauszusetzen. Das heißt aber den Sinn des
»ungeheuren Gedichts« (»Alle«) mißverstehen. Diese großartige Vision will nicht
eine Erfüllung in der Zukunft darstellen, sondern bedeutet den ewigen Ausgleich
gegen alle Ungerechtigkeiten und allen Jammer der Geschichte, den der Mensch
in seinem Innern findet, wenn er des Göttlichen sich bewußt wird. Brecht scheint
es dagegen als eine Art Vision des Zukunftstaates zu deuten. Wenn Meyer das
Gedicht »sozial« genannt hat, so kann er es nur in dem Sinne gemeint haben, in
dem man auch die Bergpredigt sozial nennen darf. Eine platte Fortschrittsphilo-
sophie ist einem so feinen Kenner der Geschichte sicherlich fremd gewesen. Die
Geschichte macht keine Fortschritte, wohl aber der einzelne Mensch in der Ge-
schichte. Die Versöhnung mit Gott vollzieht sich nicht am Ende der Zeiten: in
jedem Augenblick spricht der Geist »sieh auf! es darbt ja keiner, sie sitzen alle an
Tischen des Lebens«.
Zum Schlüsse ein grundsätzliches Bedenken, das die Form des Buches betrifft.
Es ist kein Buch, was uns vorliegt, sondern nur das Material zu einem. Merk-
würdig wie wenig Brecht für sein eigenes Arbeiten von Meyer gelernt hat. Seine
Arbeit teilt einen Fehler mit fast allen Büchern, die wir bei solchen Untersuchungen
zu erhalten pflegen. Sie gibt zu viel unaufgelösten Stoff. Die philologische Treue
läßt sich wahren, auch wenn man zusammenfaßt. Brechts Werk hätte ein Buch für
die Gebildeten werden können, es ist ein Buch für Philologen geworden. Der
Deuter hätte uns den Organismus dieses unvergleichlichen Kunstwerkes, das uns
seine Bemühung erst geschenkt hat, darstellen, nicht beschreiben sollen. Ich
mache einen Vorschlag. Der Verfasser dränge das wichtigste in einen Aufsatz zu-
sammen und der Verlag Haessel gebe diese Zusammenfassung als einführenden
Ergänzungsband den Gedichten bei. Das ausführlichere Werk würde seinen Wert
als Quelle der Belege trotzdem behalten. Meyers Gedichte sind in 112. Auflage er-
schienen; die Arbeit Brechts könnte vielen ein Führer zu vertieftem Genüsse sein.
Berlin.
Alfred Baeumler.
Adolf v. Grolman, Fr. Hölderlins Hyperion. Stilkritische Studien
zu dem Problem der Entwicklung dichterischer Ausdrucks-
formen. C. F. Müllersche Hofbuchhandlung m.b.H., Karlsruhe i.B. 1919.
34 S.
Von dieser Arbeit gilt in der Hauptsache dasselbe, was wir in der vorhergehen-
den Besprechung des Buches von Brecht sagen mußten. Mit der größten Feinheit
bis: Einer Toten, genau in der Mitte der zentralen Abteilung »Liebe« (als »Haupt-
erlebnis seiner ganzen Erdenfabrt«). Die Feinheit der Anordnung beruht darin, daß
Meyer diesem Erlebnis seine zentrale Stellung wahrt und es doch im Zusammen-
hang der Abteilung zugleich als vergänglich zu charakterisieren versteht. Denn ein-
gefaßt ist der Reigen der Cleliagedichte von den Gedichten an die Gattin. Ihre
Liebe ist lebensbeherrschend, jenes Ereignis ist aber der tiefsten Empfindung zum
Trotz, doch nur eine Episode (94). Wer in solchen Hineingeheimnissen nur Spie-
lerei sieht, wird Meyers Gedichte überhaupt nie lange in der Hand behalten. Wer
aber diesen Dichter liebt, kann aus solchen Aufschlüssen tief willkommene Bereiche-
rung künstlerischen Erlebens gewinnen.
An einer Stelle scheint mir Brechts Einfühlungsfähigkeit zu versagen, an einer
entscheidenden. Meyers Geschichtsphilosophie würde ich auch durch den »Glauben
an ein ewiges Ziel aller historischen Entwicklung« (115) charakterisieren. Aber
Brecht betont das »ewig« nicht genug. Er scheint bei Meyer den Glauben an ein
wirkliches Ziel der Geschichte vorauszusetzen. Das heißt aber den Sinn des
»ungeheuren Gedichts« (»Alle«) mißverstehen. Diese großartige Vision will nicht
eine Erfüllung in der Zukunft darstellen, sondern bedeutet den ewigen Ausgleich
gegen alle Ungerechtigkeiten und allen Jammer der Geschichte, den der Mensch
in seinem Innern findet, wenn er des Göttlichen sich bewußt wird. Brecht scheint
es dagegen als eine Art Vision des Zukunftstaates zu deuten. Wenn Meyer das
Gedicht »sozial« genannt hat, so kann er es nur in dem Sinne gemeint haben, in
dem man auch die Bergpredigt sozial nennen darf. Eine platte Fortschrittsphilo-
sophie ist einem so feinen Kenner der Geschichte sicherlich fremd gewesen. Die
Geschichte macht keine Fortschritte, wohl aber der einzelne Mensch in der Ge-
schichte. Die Versöhnung mit Gott vollzieht sich nicht am Ende der Zeiten: in
jedem Augenblick spricht der Geist »sieh auf! es darbt ja keiner, sie sitzen alle an
Tischen des Lebens«.
Zum Schlüsse ein grundsätzliches Bedenken, das die Form des Buches betrifft.
Es ist kein Buch, was uns vorliegt, sondern nur das Material zu einem. Merk-
würdig wie wenig Brecht für sein eigenes Arbeiten von Meyer gelernt hat. Seine
Arbeit teilt einen Fehler mit fast allen Büchern, die wir bei solchen Untersuchungen
zu erhalten pflegen. Sie gibt zu viel unaufgelösten Stoff. Die philologische Treue
läßt sich wahren, auch wenn man zusammenfaßt. Brechts Werk hätte ein Buch für
die Gebildeten werden können, es ist ein Buch für Philologen geworden. Der
Deuter hätte uns den Organismus dieses unvergleichlichen Kunstwerkes, das uns
seine Bemühung erst geschenkt hat, darstellen, nicht beschreiben sollen. Ich
mache einen Vorschlag. Der Verfasser dränge das wichtigste in einen Aufsatz zu-
sammen und der Verlag Haessel gebe diese Zusammenfassung als einführenden
Ergänzungsband den Gedichten bei. Das ausführlichere Werk würde seinen Wert
als Quelle der Belege trotzdem behalten. Meyers Gedichte sind in 112. Auflage er-
schienen; die Arbeit Brechts könnte vielen ein Führer zu vertieftem Genüsse sein.
Berlin.
Alfred Baeumler.
Adolf v. Grolman, Fr. Hölderlins Hyperion. Stilkritische Studien
zu dem Problem der Entwicklung dichterischer Ausdrucks-
formen. C. F. Müllersche Hofbuchhandlung m.b.H., Karlsruhe i.B. 1919.
34 S.
Von dieser Arbeit gilt in der Hauptsache dasselbe, was wir in der vorhergehen-
den Besprechung des Buches von Brecht sagen mußten. Mit der größten Feinheit