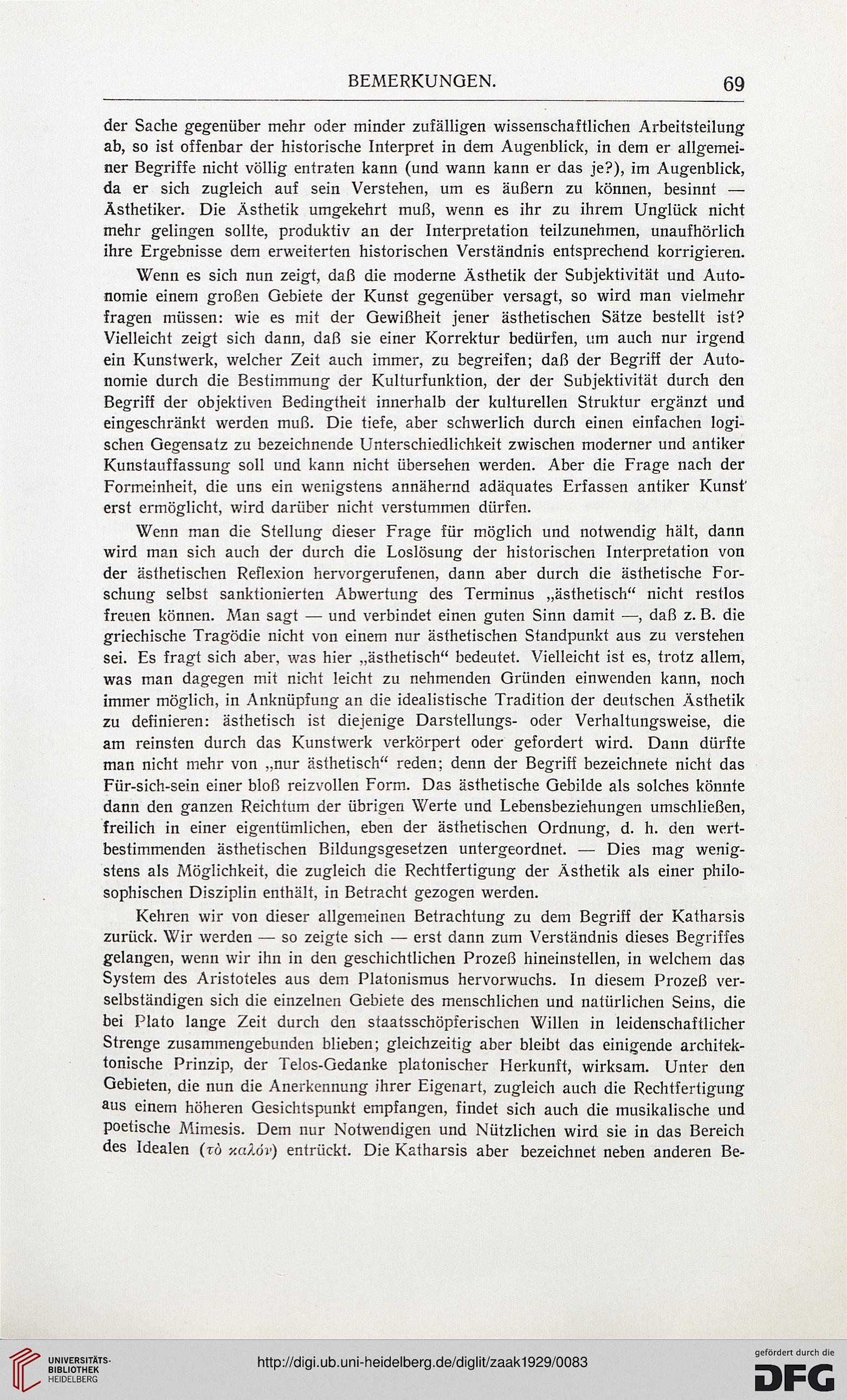BEMERKUNGEN.
69
der Sache gegenüber mehr oder minder zufälligen wissenschaftlichen Arbeitsteilung
ab, so ist offenbar der historische Interpret in dem Augenblick, in dem er allgemei-
ner Begriffe nicht völlig entraten kann (und wann kann er das je?), im Augenblick,
da er sich zugleich auf sein Verstehen, um es äußern zu können, besinnt —
Ästhetiker. Die Ästhetik umgekehrt muß, wenn es ihr zu ihrem Unglück nicht
mehr gelingen sollte, produktiv an der Interpretation teilzunehmen, unaufhörlich
ihre Ergebnisse dem erweiterten historischen Verständnis entsprechend korrigieren.
Wenn es sich nun zeigt, daß die moderne Ästhetik der Subjektivität und Auto-
nomie einem großen Gebiete der Kunst gegenüber versagt, so wird man vielmehr
fragen müssen: wie es mit der Gewißheit jener ästhetischen Sätze bestellt ist?
Vielleicht zeigt sich dann, daß sie einer Korrektur bedürfen, um auch nur irgend
ein Kunstwerk, welcher Zeit auch immer, zu begreifen; daß der Begriff der Auto-
nomie durch die Bestimmung der Kulturfunktion, der der Subjektivität durch den
Begriff der objektiven Bedingtheit innerhalb der kulturellen Struktur ergänzt und
eingeschränkt werden muß. Die tiefe, aber schwerlich durch einen einfachen logi-
schen Gegensatz zu bezeichnende Unterschiedlichkeit zwischen moderner und antiker
Kunstauffassung soll und kann nicht übersehen werden. Aber die Frage nach der
Formeinheit, die uns ein wenigstens annähernd adäquates Erfassen antiker Kunst'
erst ermöglicht, wird darüber nicht verstummen dürfen.
Wenn man die Stellung dieser Frage für möglich und notwendig hält, dann
wird man sich auch der durch die Loslösung der historischen Interpretation von
der ästhetischen Reflexion hervorgerufenen, dann aber durch die ästhetische For-
schung selbst sanktionierten Abwertung des Terminus „ästhetisch" nicht restlos
freuen können. Man sagt — und verbindet einen guten Sinn damit —, daß z. B. die
griechische Tragödie nicht von einem nur ästhetischen Standpunkt aus zu verstehen
sei. Es fragt sich aber, was hier „ästhetisch" bedeutet. Vielleicht ist es, trotz allem,
was man dagegen mit nicht leicht zu nehmenden Gründen einwenden kann, noch
immer möglich, in Anknüpfung an die idealistische Tradition der deutschen Ästhetik
zu definieren: ästhetisch ist diejenige Darstellungs- oder Verhaltungsweise, die
am reinsten durch das Kunstwerk verkörpert oder gefordert wird. Dann dürfte
man nicht mehr von „nur ästhetisch" reden; denn der Begriff bezeichnete nicht das
Für-sich-sein einer bloß reizvollen Form. Das ästhetische Gebilde als solches könnte
dann den ganzen Reichtum der übrigen Werte und Lebensbeziehungen umschließen,
freilich in einer eigentümlichen, eben der ästhetischen Ordnung, d. h. den wert-
bestimmenden ästhetischen Bildungsgesetzen untergeordnet. — Dies mag wenig-
stens als Möglichkeit, die zugleich die Rechtfertigung der Ästhetik als einer philo-
sophischen Disziplin enthält, in Betracht gezogen werden.
Kehren wir von dieser allgemeinen Betrachtung zu dem Begriff der Katharsis
zurück. Wir werden — so zeigte sich — erst dann zum Verständnis dieses Begriffes
gelangen, wenn wir ihn in den geschichtlichen Prozeß hineinstellen, in welchem das
System des Aristoteles aus dem Piatonismus hervorwuchs. In diesem Prozeß ver-
selbständigen sich die einzelnen Gebiete des menschlichen und natürlichen Seins, die
bei Plato lange Zeit durch den staatsschöpferischen Willen in leidenschaftlicher
Strenge zusammengebunden blieben; gleichzeitig aber bleibt das einigende architek-
tonische Prinzip, der Telos-Gedanke platonischer Herkunft, wirksam. Unter den
Gebieten, die nun die Anerkennung ihrer Eigenart, zugleich auch die Rechtfertigung
aus einem höheren Gesichtspunkt empfangen, findet sich auch die musikalische und
poetische Mimesis. Dem nur Notwendigen und Nützlichen wird sie in das Bereich
des Idealen (tö y.a?.6v) entrückt. Die Katharsis aber bezeichnet neben anderen Be-
69
der Sache gegenüber mehr oder minder zufälligen wissenschaftlichen Arbeitsteilung
ab, so ist offenbar der historische Interpret in dem Augenblick, in dem er allgemei-
ner Begriffe nicht völlig entraten kann (und wann kann er das je?), im Augenblick,
da er sich zugleich auf sein Verstehen, um es äußern zu können, besinnt —
Ästhetiker. Die Ästhetik umgekehrt muß, wenn es ihr zu ihrem Unglück nicht
mehr gelingen sollte, produktiv an der Interpretation teilzunehmen, unaufhörlich
ihre Ergebnisse dem erweiterten historischen Verständnis entsprechend korrigieren.
Wenn es sich nun zeigt, daß die moderne Ästhetik der Subjektivität und Auto-
nomie einem großen Gebiete der Kunst gegenüber versagt, so wird man vielmehr
fragen müssen: wie es mit der Gewißheit jener ästhetischen Sätze bestellt ist?
Vielleicht zeigt sich dann, daß sie einer Korrektur bedürfen, um auch nur irgend
ein Kunstwerk, welcher Zeit auch immer, zu begreifen; daß der Begriff der Auto-
nomie durch die Bestimmung der Kulturfunktion, der der Subjektivität durch den
Begriff der objektiven Bedingtheit innerhalb der kulturellen Struktur ergänzt und
eingeschränkt werden muß. Die tiefe, aber schwerlich durch einen einfachen logi-
schen Gegensatz zu bezeichnende Unterschiedlichkeit zwischen moderner und antiker
Kunstauffassung soll und kann nicht übersehen werden. Aber die Frage nach der
Formeinheit, die uns ein wenigstens annähernd adäquates Erfassen antiker Kunst'
erst ermöglicht, wird darüber nicht verstummen dürfen.
Wenn man die Stellung dieser Frage für möglich und notwendig hält, dann
wird man sich auch der durch die Loslösung der historischen Interpretation von
der ästhetischen Reflexion hervorgerufenen, dann aber durch die ästhetische For-
schung selbst sanktionierten Abwertung des Terminus „ästhetisch" nicht restlos
freuen können. Man sagt — und verbindet einen guten Sinn damit —, daß z. B. die
griechische Tragödie nicht von einem nur ästhetischen Standpunkt aus zu verstehen
sei. Es fragt sich aber, was hier „ästhetisch" bedeutet. Vielleicht ist es, trotz allem,
was man dagegen mit nicht leicht zu nehmenden Gründen einwenden kann, noch
immer möglich, in Anknüpfung an die idealistische Tradition der deutschen Ästhetik
zu definieren: ästhetisch ist diejenige Darstellungs- oder Verhaltungsweise, die
am reinsten durch das Kunstwerk verkörpert oder gefordert wird. Dann dürfte
man nicht mehr von „nur ästhetisch" reden; denn der Begriff bezeichnete nicht das
Für-sich-sein einer bloß reizvollen Form. Das ästhetische Gebilde als solches könnte
dann den ganzen Reichtum der übrigen Werte und Lebensbeziehungen umschließen,
freilich in einer eigentümlichen, eben der ästhetischen Ordnung, d. h. den wert-
bestimmenden ästhetischen Bildungsgesetzen untergeordnet. — Dies mag wenig-
stens als Möglichkeit, die zugleich die Rechtfertigung der Ästhetik als einer philo-
sophischen Disziplin enthält, in Betracht gezogen werden.
Kehren wir von dieser allgemeinen Betrachtung zu dem Begriff der Katharsis
zurück. Wir werden — so zeigte sich — erst dann zum Verständnis dieses Begriffes
gelangen, wenn wir ihn in den geschichtlichen Prozeß hineinstellen, in welchem das
System des Aristoteles aus dem Piatonismus hervorwuchs. In diesem Prozeß ver-
selbständigen sich die einzelnen Gebiete des menschlichen und natürlichen Seins, die
bei Plato lange Zeit durch den staatsschöpferischen Willen in leidenschaftlicher
Strenge zusammengebunden blieben; gleichzeitig aber bleibt das einigende architek-
tonische Prinzip, der Telos-Gedanke platonischer Herkunft, wirksam. Unter den
Gebieten, die nun die Anerkennung ihrer Eigenart, zugleich auch die Rechtfertigung
aus einem höheren Gesichtspunkt empfangen, findet sich auch die musikalische und
poetische Mimesis. Dem nur Notwendigen und Nützlichen wird sie in das Bereich
des Idealen (tö y.a?.6v) entrückt. Die Katharsis aber bezeichnet neben anderen Be-