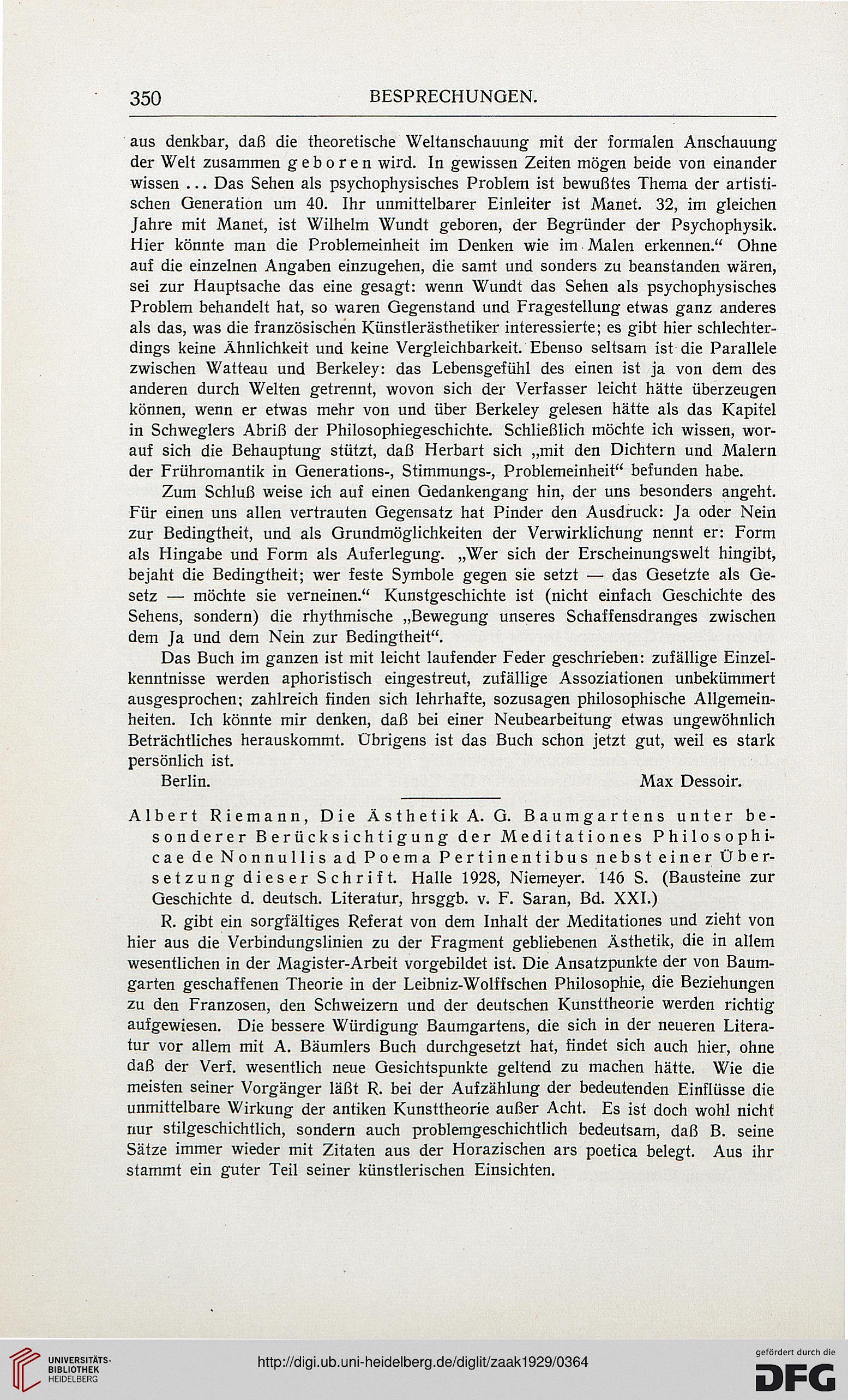350
BESPRECHUNGEN.
aus denkbar, daß die theoretische Weltanschauung mit der formalen Anschauung
der Welt zusammen geboren wird. In gewissen Zeiten mögen beide von einander
wissen ... Das Sehen als psychophysisches Problem ist bewußtes Thema der artisti-
schen Generation um 40. Ihr unmittelbarer Einleiter ist Manet. 32, im gleichen
Jahre mit Manet, ist Wilhelm Wundt geboren, der Begründer der Psychophysik.
Hier könnte man die Problemeinheit im Denken wie im Malen erkennen." Ohne
auf die einzelnen Angaben einzugehen, die samt und sonders zu beanstanden wären,
sei zur Hauptsache das eine gesagt: wenn Wundt das Sehen als psychophysisches
Problem behandelt hat, so waren Gegenstand und Fragestellung etwas ganz anderes
als das, was die französischen Künstlerästhetiker interessierte; es gibt hier schlechter-
dings keine Ähnlichkeit und keine Vergleichbarkeit. Ebenso seltsam ist die Parallele
zwischen Watteau und Berkeley: das Lebensgefühl des einen ist ja von dem des
anderen durch Welten getrennt, wovon sich der Verfasser leicht hätte überzeugen
können, wenn er etwas mehr von und über Berkeley gelesen hätte als das Kapitel
in Schweglers Abriß der Philosophiegeschichte. Schließlich möchte ich wissen, wor-
auf sich die Behauptung stützt, daß Herbart sich „mit den Dichtern und Malern
der Frühromantik in Generations-, Stimmungs-, Problemeinheit" befunden habe.
Zum Schluß weise ich auf einen Gedankengang hin, der uns besonders angeht.
Für einen uns allen vertrauten Gegensatz hat Pinder den Ausdruck: Ja oder Nein
zur Bedingtheit, und als Grundmöglichkeiten der Verwirklichung nennt er: Form
als Hingabe und Form als Auferlegung. „Wer sich der Erscheinungswelt hingibt,
bejaht die Bedingtheit; wer feste Symbole gegen sie setzt — das Gesetzte als Ge-
setz — möchte sie verneinen." Kunstgeschichte ist (nicht einfach Geschichte des
Sehens, sondern) die rhythmische „Bewegung unseres Schaffensdranges zwischen
dem Ja und dem Nein zur Bedingtheit".
Das Buch im ganzen ist mit leicht laufender Feder geschrieben: zufällige Einzel-
kenntnisse werden aphoristisch eingestreut, zufällige Assoziationen unbekümmert
ausgesprochen; zahlreich finden sich lehrhafte, sozusagen philosophische Allgemein-
heiten. Ich könnte mir denken, daß bei einer Neubearbeitung etwas ungewöhnlich
Beträchtliches herauskommt. Übrigens ist das Buch schon jetzt gut, weil es stark
persönlich ist.
Berlin. Max Dessoir.
Albert Riemann, Die Ästhetik A. G. Baumgartens unter be-
sonderer Berücksichtigung der Meditationes Philosoph i-
cae de Nonnullis ad Poema Pertinentibus nebst einer Ober-
setzung dieser Schrift. Halle 1928, Niemeyer. 146 S. (Bausteine zur
Geschichte d. deutsch. Literatur, hrsggb. v. F. Saran, Bd. XXI.)
R. gibt ein sorgfältiges Referat von dem Inhalt der Meditationes und zieht von
hier aus die Verbindungslinien zu der Fragment gebliebenen Ästhetik, die in allem
wesentlichen in der Magister-Arbeit vorgebildet ist. Die Ansatzpunkte der von Baum-
garten geschaffenen Theorie in der Leibniz-Wolffschen Philosophie, die Beziehungen
zu den Franzosen, den Schweizern und der deutschen Kunsttheorie werden richtig
aufgewiesen. Die bessere Würdigung Baumgartens, die sich in der neueren Litera-
tur vor allem mit A. Bäumlers Buch durchgesetzt hat, findet sich auch hier, ohne
daß der Verf. wesentlich neue Gesichtspunkte geltend zu machen hätte. Wie die
meisten seiner Vorgänger läßt R. bei der Aufzählung der bedeutenden Einflüsse die
unmittelbare Wirkung der antiken Kunsttheorie außer Acht. Es ist doch wohl nicht
nur stilgeschichtlich, sondern auch problemgeschichtlich bedeutsam, daß B. seine
Sätze immer wieder mit Zitaten aus der Horazischen ars poetica belegt. Aus ihr
stammt ein guter Teil seiner künstlerischen Einsichten.
BESPRECHUNGEN.
aus denkbar, daß die theoretische Weltanschauung mit der formalen Anschauung
der Welt zusammen geboren wird. In gewissen Zeiten mögen beide von einander
wissen ... Das Sehen als psychophysisches Problem ist bewußtes Thema der artisti-
schen Generation um 40. Ihr unmittelbarer Einleiter ist Manet. 32, im gleichen
Jahre mit Manet, ist Wilhelm Wundt geboren, der Begründer der Psychophysik.
Hier könnte man die Problemeinheit im Denken wie im Malen erkennen." Ohne
auf die einzelnen Angaben einzugehen, die samt und sonders zu beanstanden wären,
sei zur Hauptsache das eine gesagt: wenn Wundt das Sehen als psychophysisches
Problem behandelt hat, so waren Gegenstand und Fragestellung etwas ganz anderes
als das, was die französischen Künstlerästhetiker interessierte; es gibt hier schlechter-
dings keine Ähnlichkeit und keine Vergleichbarkeit. Ebenso seltsam ist die Parallele
zwischen Watteau und Berkeley: das Lebensgefühl des einen ist ja von dem des
anderen durch Welten getrennt, wovon sich der Verfasser leicht hätte überzeugen
können, wenn er etwas mehr von und über Berkeley gelesen hätte als das Kapitel
in Schweglers Abriß der Philosophiegeschichte. Schließlich möchte ich wissen, wor-
auf sich die Behauptung stützt, daß Herbart sich „mit den Dichtern und Malern
der Frühromantik in Generations-, Stimmungs-, Problemeinheit" befunden habe.
Zum Schluß weise ich auf einen Gedankengang hin, der uns besonders angeht.
Für einen uns allen vertrauten Gegensatz hat Pinder den Ausdruck: Ja oder Nein
zur Bedingtheit, und als Grundmöglichkeiten der Verwirklichung nennt er: Form
als Hingabe und Form als Auferlegung. „Wer sich der Erscheinungswelt hingibt,
bejaht die Bedingtheit; wer feste Symbole gegen sie setzt — das Gesetzte als Ge-
setz — möchte sie verneinen." Kunstgeschichte ist (nicht einfach Geschichte des
Sehens, sondern) die rhythmische „Bewegung unseres Schaffensdranges zwischen
dem Ja und dem Nein zur Bedingtheit".
Das Buch im ganzen ist mit leicht laufender Feder geschrieben: zufällige Einzel-
kenntnisse werden aphoristisch eingestreut, zufällige Assoziationen unbekümmert
ausgesprochen; zahlreich finden sich lehrhafte, sozusagen philosophische Allgemein-
heiten. Ich könnte mir denken, daß bei einer Neubearbeitung etwas ungewöhnlich
Beträchtliches herauskommt. Übrigens ist das Buch schon jetzt gut, weil es stark
persönlich ist.
Berlin. Max Dessoir.
Albert Riemann, Die Ästhetik A. G. Baumgartens unter be-
sonderer Berücksichtigung der Meditationes Philosoph i-
cae de Nonnullis ad Poema Pertinentibus nebst einer Ober-
setzung dieser Schrift. Halle 1928, Niemeyer. 146 S. (Bausteine zur
Geschichte d. deutsch. Literatur, hrsggb. v. F. Saran, Bd. XXI.)
R. gibt ein sorgfältiges Referat von dem Inhalt der Meditationes und zieht von
hier aus die Verbindungslinien zu der Fragment gebliebenen Ästhetik, die in allem
wesentlichen in der Magister-Arbeit vorgebildet ist. Die Ansatzpunkte der von Baum-
garten geschaffenen Theorie in der Leibniz-Wolffschen Philosophie, die Beziehungen
zu den Franzosen, den Schweizern und der deutschen Kunsttheorie werden richtig
aufgewiesen. Die bessere Würdigung Baumgartens, die sich in der neueren Litera-
tur vor allem mit A. Bäumlers Buch durchgesetzt hat, findet sich auch hier, ohne
daß der Verf. wesentlich neue Gesichtspunkte geltend zu machen hätte. Wie die
meisten seiner Vorgänger läßt R. bei der Aufzählung der bedeutenden Einflüsse die
unmittelbare Wirkung der antiken Kunsttheorie außer Acht. Es ist doch wohl nicht
nur stilgeschichtlich, sondern auch problemgeschichtlich bedeutsam, daß B. seine
Sätze immer wieder mit Zitaten aus der Horazischen ars poetica belegt. Aus ihr
stammt ein guter Teil seiner künstlerischen Einsichten.