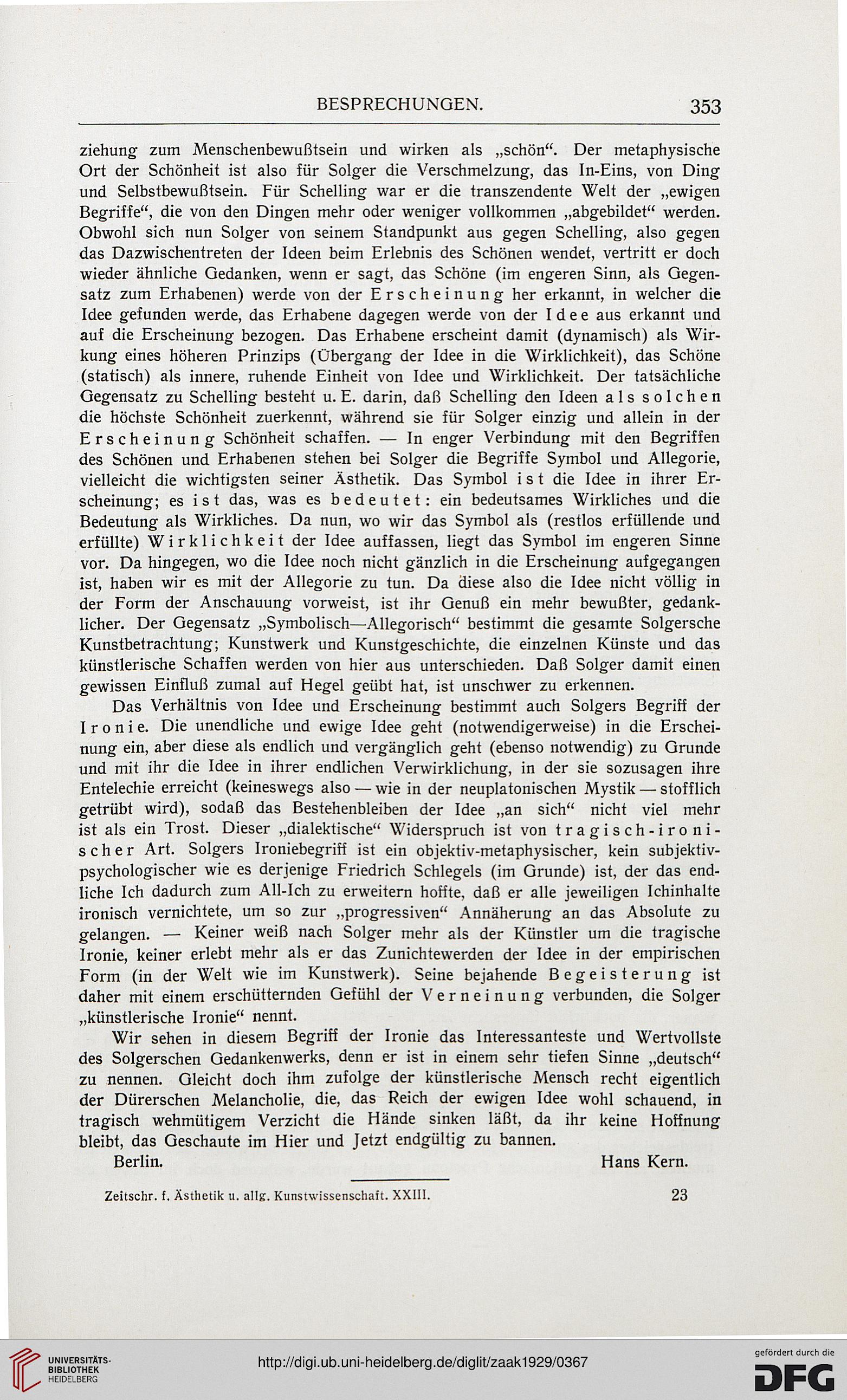BESPRECHUNGEN.
353
Ziehung zum Menschenbewußtsein und wirken als „schön". Der metaphysische
Ort der Schönheit ist also für Solger die Verschmelzung, das In-Eins, von Ding
und Selbstbewußtsein. Für Schelling war er die transzendente Welt der „ewigen
Begriffe", die von den Dingen mehr oder weniger vollkommen „abgebildet" werden.
Obwohl sich nun Solger von seinem Standpunkt aus gegen Schelling, also gegen
das Dazwischentreten der Ideen beim Erlebnis des Schönen wendet, vertritt er doch
wieder ähnliche Gedanken, wenn er sagt, das Schöne (im engeren Sinn, als Gegen-
satz zum Erhabenen) werde von der Erscheinung her erkannt, in welcher die
Idee gefunden werde, das Erhabene dagegen werde von der Idee aus erkannt und
auf die Erscheinung bezogen. Das Erhabene erscheint damit (dynamisch) als Wir-
kung eines höheren Prinzips (Obergang der Idee in die Wirklichkeit), das Schöne
(statisch) als innere, ruhende Einheit von Idee und Wirklichkeit. Der tatsächliche
Gegensatz zu Schelling besteht u.E. darin, daß Schelling den Ideen als solchen
die höchste Schönheit zuerkennt, während sie für Solger einzig und allein in der
Erscheinung Schönheit schaffen. — In enger Verbindung mit den Begriffen
des Schönen und Erhabenen stehen bei Solger die Begriffe Symbol und Allegorie,
vielleicht die wichtigsten seiner Ästhetik. Das Symbol ist die Idee in ihrer Er-
scheinung; es i s t das, was es bedeutet: ein bedeutsames Wirkliches und die
Bedeutung als Wirkliches. Da nun, wo wir das Symbol als (restlos erfüllende und
erfüllte) Wirklichkeit der Idee auffassen, liegt das Symbol im engeren Sinne
vor. Da hingegen, wo die Idee noch nicht gänzlich in die Erscheinung aufgegangen
ist, haben wir es mit der Allegorie zu tun. Da diese also die Idee nicht völlig in
der Form der Anschauung vorweist, ist ihr Genuß ein mehr bewußter, gedank-
licher. Der Gegensatz „Symbolisch—Allegorisch" bestimmt die gesamte Solgersche
Kunstbetrachtung; Kunstwerk und Kunstgeschichte, die einzelnen Künste und das
künstlerische Schaffen werden von hier aus unterschieden. Daß Solger damit einen
gewissen Einfluß zumal auf Hegel geübt hat, ist unschwer zu erkennen.
Das Verhältnis von Idee und Erscheinung bestimmt auch Solgers Begriff der
Ironie. Die unendliche und ewige Idee geht (notwendigerweise) in die Erschei-
nung ein, aber diese als endlich und vergänglich geht (ebenso notwendig) zu Grunde
und mit ihr die Idee in ihrer endlichen Verwirklichung, in der sie sozusagen ihre
Entelechie erreicht (keineswegs also — wie in der neuplatonischen Mystik — stofflich
getrübt wird), sodaß das Bestehenbleiben der Idee „an sich" nicht viel mehr
ist als ein Trost. Dieser „dialektische" Widerspruch ist von tragisch-ironi-
scher Art. Solgers Ironiebegriff ist ein objektiv-metaphysischer, kein subjektiv-
psychologischer wie es derjenige Friedrich Schlegels (im Grunde) ist, der das end-
liche Ich dadurch zum All-Ich zu erweitern hoffte, daß er alle jeweiligen Ichinhalte
ironisch vernichtete, um so zur „progressiven" Annäherung an das Absolute zu
gelangen. — Keiner weiß nach Solger mehr als der Künstler um die tragische
Ironie, keiner erlebt mehr als er das Zunichtewerden der Idee in der empirischen
Form (in der Welt wie im Kunstwerk). Seine bejahende Begeisterung ist
daher mit einem erschütternden Gefühl der Verneinung verbunden, die Solger
„künstlerische Ironie" nennt.
Wir sehen in diesem Begriff der Ironie das Interessanteste und Wertvollste
des Solgerschen Gedankenwerks, denn er ist in einem sehr tiefen Sinne „deutsch"
zu nennen. Gleicht doch ihm zufolge der künstlerische Mensch recht eigentlich
der Dürerschen Melancholie, die, das Reich der ewigen Idee wohl schauend, in
tragisch wehmütigem Verzicht die Hände sinken läßt, da ihr keine Hoffnung
bleibt, das Geschaute im Hier und Jetzt endgültig zu bannen.
Berlin. Hans Kern.
Zeitschr. f. Ästhetik u. alle. Kunstwissenschaft. XXIII.
23
353
Ziehung zum Menschenbewußtsein und wirken als „schön". Der metaphysische
Ort der Schönheit ist also für Solger die Verschmelzung, das In-Eins, von Ding
und Selbstbewußtsein. Für Schelling war er die transzendente Welt der „ewigen
Begriffe", die von den Dingen mehr oder weniger vollkommen „abgebildet" werden.
Obwohl sich nun Solger von seinem Standpunkt aus gegen Schelling, also gegen
das Dazwischentreten der Ideen beim Erlebnis des Schönen wendet, vertritt er doch
wieder ähnliche Gedanken, wenn er sagt, das Schöne (im engeren Sinn, als Gegen-
satz zum Erhabenen) werde von der Erscheinung her erkannt, in welcher die
Idee gefunden werde, das Erhabene dagegen werde von der Idee aus erkannt und
auf die Erscheinung bezogen. Das Erhabene erscheint damit (dynamisch) als Wir-
kung eines höheren Prinzips (Obergang der Idee in die Wirklichkeit), das Schöne
(statisch) als innere, ruhende Einheit von Idee und Wirklichkeit. Der tatsächliche
Gegensatz zu Schelling besteht u.E. darin, daß Schelling den Ideen als solchen
die höchste Schönheit zuerkennt, während sie für Solger einzig und allein in der
Erscheinung Schönheit schaffen. — In enger Verbindung mit den Begriffen
des Schönen und Erhabenen stehen bei Solger die Begriffe Symbol und Allegorie,
vielleicht die wichtigsten seiner Ästhetik. Das Symbol ist die Idee in ihrer Er-
scheinung; es i s t das, was es bedeutet: ein bedeutsames Wirkliches und die
Bedeutung als Wirkliches. Da nun, wo wir das Symbol als (restlos erfüllende und
erfüllte) Wirklichkeit der Idee auffassen, liegt das Symbol im engeren Sinne
vor. Da hingegen, wo die Idee noch nicht gänzlich in die Erscheinung aufgegangen
ist, haben wir es mit der Allegorie zu tun. Da diese also die Idee nicht völlig in
der Form der Anschauung vorweist, ist ihr Genuß ein mehr bewußter, gedank-
licher. Der Gegensatz „Symbolisch—Allegorisch" bestimmt die gesamte Solgersche
Kunstbetrachtung; Kunstwerk und Kunstgeschichte, die einzelnen Künste und das
künstlerische Schaffen werden von hier aus unterschieden. Daß Solger damit einen
gewissen Einfluß zumal auf Hegel geübt hat, ist unschwer zu erkennen.
Das Verhältnis von Idee und Erscheinung bestimmt auch Solgers Begriff der
Ironie. Die unendliche und ewige Idee geht (notwendigerweise) in die Erschei-
nung ein, aber diese als endlich und vergänglich geht (ebenso notwendig) zu Grunde
und mit ihr die Idee in ihrer endlichen Verwirklichung, in der sie sozusagen ihre
Entelechie erreicht (keineswegs also — wie in der neuplatonischen Mystik — stofflich
getrübt wird), sodaß das Bestehenbleiben der Idee „an sich" nicht viel mehr
ist als ein Trost. Dieser „dialektische" Widerspruch ist von tragisch-ironi-
scher Art. Solgers Ironiebegriff ist ein objektiv-metaphysischer, kein subjektiv-
psychologischer wie es derjenige Friedrich Schlegels (im Grunde) ist, der das end-
liche Ich dadurch zum All-Ich zu erweitern hoffte, daß er alle jeweiligen Ichinhalte
ironisch vernichtete, um so zur „progressiven" Annäherung an das Absolute zu
gelangen. — Keiner weiß nach Solger mehr als der Künstler um die tragische
Ironie, keiner erlebt mehr als er das Zunichtewerden der Idee in der empirischen
Form (in der Welt wie im Kunstwerk). Seine bejahende Begeisterung ist
daher mit einem erschütternden Gefühl der Verneinung verbunden, die Solger
„künstlerische Ironie" nennt.
Wir sehen in diesem Begriff der Ironie das Interessanteste und Wertvollste
des Solgerschen Gedankenwerks, denn er ist in einem sehr tiefen Sinne „deutsch"
zu nennen. Gleicht doch ihm zufolge der künstlerische Mensch recht eigentlich
der Dürerschen Melancholie, die, das Reich der ewigen Idee wohl schauend, in
tragisch wehmütigem Verzicht die Hände sinken läßt, da ihr keine Hoffnung
bleibt, das Geschaute im Hier und Jetzt endgültig zu bannen.
Berlin. Hans Kern.
Zeitschr. f. Ästhetik u. alle. Kunstwissenschaft. XXIII.
23