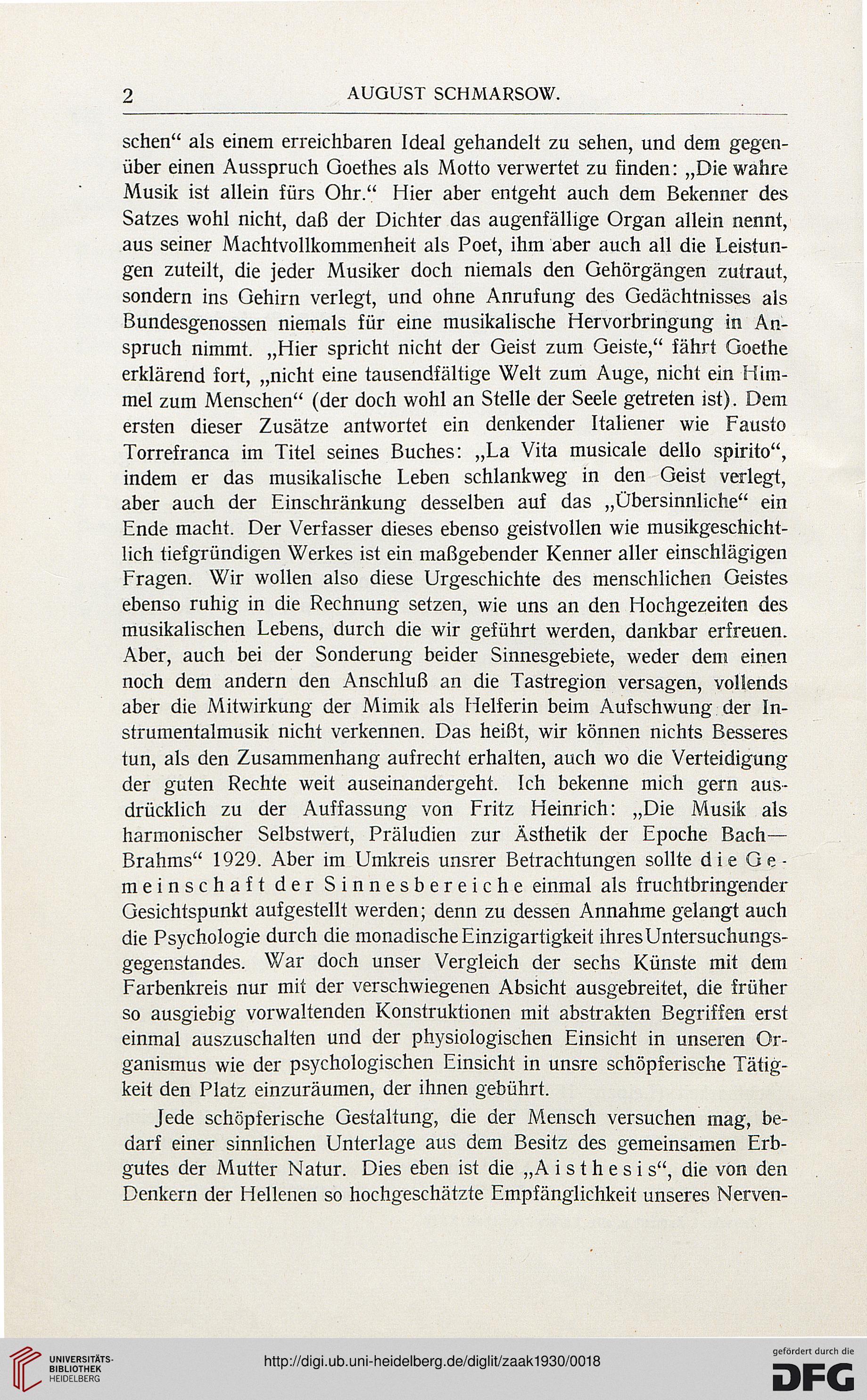2
AUGUST SCHMARSOW.
sehen" als einem erreichbaren Ideal gehandelt zu sehen, und dem gegen-
über einen Ausspruch Goethes als Motto verwertet zu finden: „Die wahre
Musik ist allein fürs Ohr." Hier aber entgeht auch dem Bekenner des
Satzes wohl nicht, daß der Dichter das augenfällige Organ allein nennt,
aus seiner Machtvollkommenheit als Poet, ihm aber auch all die Leistun-
gen zuteilt, die jeder Musiker doch niemals den Gehörgängen zutraut,
sondern ins Gehirn verlegt, und ohne Anrufung des Gedächtnisses als
Bundesgenossen niemals für eine musikalische Hervorbringung in An-
spruch nimmt. „Hier spricht nicht der Geist zum Geiste," fährt Goethe
erklärend fort, „nicht eine tausendfältige Welt zum Auge, nicht ein Him-
mel zum Menschen" (der doch wohl an Stelle der Seele getreten ist). Dem
ersten dieser Zusätze antwortet ein denkender Italiener wie Fausio
Torrefranca im Titel seines Buches: „La Vita musicale dello spirito",
indem er das musikalische Leben schlankweg in den Geist verlegt,
aber auch der Einschränkung desselben auf das „Übersinnliche" ein
Ende macht. Der Verfasser dieses ebenso geistvollen wie musikgeschicht-
lich tiefgründigen Werkes ist ein maßgebender Kenner aller einschlägigen
Fragen. Wir wollen also diese Urgeschichte des menschlichen Geistes
ebenso ruhig in die Rechnung setzen, wie uns an den Flochgezeiten des
musikalischen Lebens, durch die wir geführt werden, dankbar erfreuen.
Aber, auch bei der Sonderung beider Sinnesgebiete, weder dem einen
noch dem andern den Anschluß an die Tastregion versagen, vollends
aber die Mitwirkung der Mimik als Helferin beim Aufschwung der In-
strumentalmusik nicht verkennen. Das heißt, wir können nichts Besseres
tun, als den Zusammenhang aufrecht erhalten, auch wo die Verteidigung
der guten Rechte weit auseinandergeht. Ich bekenne mich gern aus-
drücklich zu der Auffassung von Fritz Heinrich: „Die Musik als
harmonischer Selbstwert, Präludien zur Ästhetik der Epoche Bach—
Brahms" 1929. Aber im Umkreis unsrer Betrachtungen sollte die Ge-
meinschaft der Sinnesbereiche einmal als fruchtbringender
Gesichtspunkt aufgestellt werden; denn zu dessen Annahme gelangt auch
die Psychologie durch die monadische Einzigartigkeit ihres Untersuchungs-
gegenstandes. War doch unser Vergleich der sechs Künste mit dem
Farbenkreis nur mit der verschwiegenen Absicht ausgebreitet, die früher
so ausgiebig vorwaltenden Konstruktionen mit abstrakten Begriffen erst
einmal auszuschalten und der physiologischen Einsicht in unseren Or-
ganismus wie der psychologischen Einsicht in unsre schöpferische Tätig-
keit den Platz einzuräumen, der ihnen gebührt.
Jede schöpferische Gestaltung, die der Mensch versuchen mag, be-
darf einer sinnlichen Unterlage aus dem Besitz des gemeinsamen Erb-
gutes der Mutter Natur. Dies eben ist die „A i s t h e s i s", die von den
Denkern der Hellenen so hochgeschätzte Empfänglichkeit unseres Nerven-
AUGUST SCHMARSOW.
sehen" als einem erreichbaren Ideal gehandelt zu sehen, und dem gegen-
über einen Ausspruch Goethes als Motto verwertet zu finden: „Die wahre
Musik ist allein fürs Ohr." Hier aber entgeht auch dem Bekenner des
Satzes wohl nicht, daß der Dichter das augenfällige Organ allein nennt,
aus seiner Machtvollkommenheit als Poet, ihm aber auch all die Leistun-
gen zuteilt, die jeder Musiker doch niemals den Gehörgängen zutraut,
sondern ins Gehirn verlegt, und ohne Anrufung des Gedächtnisses als
Bundesgenossen niemals für eine musikalische Hervorbringung in An-
spruch nimmt. „Hier spricht nicht der Geist zum Geiste," fährt Goethe
erklärend fort, „nicht eine tausendfältige Welt zum Auge, nicht ein Him-
mel zum Menschen" (der doch wohl an Stelle der Seele getreten ist). Dem
ersten dieser Zusätze antwortet ein denkender Italiener wie Fausio
Torrefranca im Titel seines Buches: „La Vita musicale dello spirito",
indem er das musikalische Leben schlankweg in den Geist verlegt,
aber auch der Einschränkung desselben auf das „Übersinnliche" ein
Ende macht. Der Verfasser dieses ebenso geistvollen wie musikgeschicht-
lich tiefgründigen Werkes ist ein maßgebender Kenner aller einschlägigen
Fragen. Wir wollen also diese Urgeschichte des menschlichen Geistes
ebenso ruhig in die Rechnung setzen, wie uns an den Flochgezeiten des
musikalischen Lebens, durch die wir geführt werden, dankbar erfreuen.
Aber, auch bei der Sonderung beider Sinnesgebiete, weder dem einen
noch dem andern den Anschluß an die Tastregion versagen, vollends
aber die Mitwirkung der Mimik als Helferin beim Aufschwung der In-
strumentalmusik nicht verkennen. Das heißt, wir können nichts Besseres
tun, als den Zusammenhang aufrecht erhalten, auch wo die Verteidigung
der guten Rechte weit auseinandergeht. Ich bekenne mich gern aus-
drücklich zu der Auffassung von Fritz Heinrich: „Die Musik als
harmonischer Selbstwert, Präludien zur Ästhetik der Epoche Bach—
Brahms" 1929. Aber im Umkreis unsrer Betrachtungen sollte die Ge-
meinschaft der Sinnesbereiche einmal als fruchtbringender
Gesichtspunkt aufgestellt werden; denn zu dessen Annahme gelangt auch
die Psychologie durch die monadische Einzigartigkeit ihres Untersuchungs-
gegenstandes. War doch unser Vergleich der sechs Künste mit dem
Farbenkreis nur mit der verschwiegenen Absicht ausgebreitet, die früher
so ausgiebig vorwaltenden Konstruktionen mit abstrakten Begriffen erst
einmal auszuschalten und der physiologischen Einsicht in unseren Or-
ganismus wie der psychologischen Einsicht in unsre schöpferische Tätig-
keit den Platz einzuräumen, der ihnen gebührt.
Jede schöpferische Gestaltung, die der Mensch versuchen mag, be-
darf einer sinnlichen Unterlage aus dem Besitz des gemeinsamen Erb-
gutes der Mutter Natur. Dies eben ist die „A i s t h e s i s", die von den
Denkern der Hellenen so hochgeschätzte Empfänglichkeit unseres Nerven-