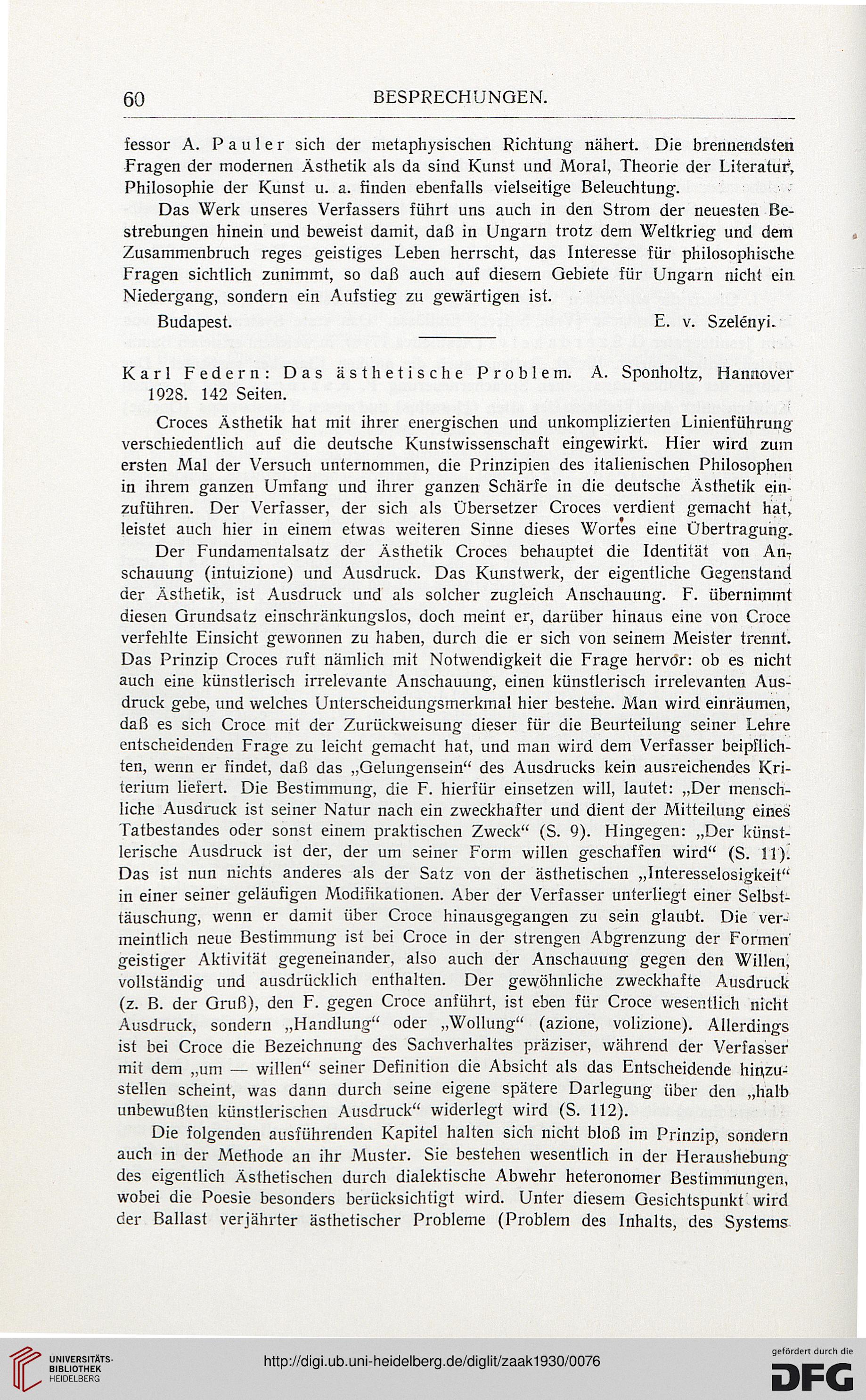60
BESPRECHUNGEN.
fessor A. P a u 1 e r sich der metaphysischen Richtung nähert. Die brennendsten
Fragen der modernen Ästhetik als da sind Kunst und Moral, Theorie der Literatur,
Philosophie der Kunst u. a. rinden ebenfalls vielseitige Beleuchtung.
Das Werk unseres Verfassers führt uns auch in den Strom der neuesten Be-
strebungen hinein und beweist damit, daß in Ungarn trotz dem Weltkrieg und dem
Zusammenbruch reges geistiges Leben herrscht, das Interesse für philosophische
Fragen sichtlich zunimmt, so daß auch auf diesem Gebiete für Ungarn nicht ein
Niedergang, sondern ein Aufstieg zu gewärtigen ist.
Budapest. E. v. Szelenyi.
Karl Federn: Das ästhetische Problem. A. Sponholtz, Hannover
1928. 142 Seiten.
Croces Ästhetik hat mit ihrer energischen und unkomplizierten Linienführung
verschiedentlich auf die deutsche Kunstwissenschaft eingewirkt. Hier wird zum
ersten Mal der Versuch unternommen, die Prinzipien des italienischen Philosophen
in ihrem ganzen Umfang und ihrer ganzen Schärfe in die deutsche Ästhetik ein
zuführen. Der Verfasser, der sich als Übersetzer Croces verdient gemacht hat,
leistet auch hier in einem etwas weiteren Sinne dieses Wortes eine Übertragung.
Der Fundamentalsatz der Ästhetik Croces behauptet die Identität von An7
schauung (intuizione) und Ausdruck. Das Kunstwerk, der eigentliche Gegenstand
der Ästhetik, ist Ausdruck und als solcher zugleich Anschauung. F. übernimmt
diesen Grundsatz einschränkungslos, doch meint er, darüber hinaus eine von Croce
verfehlte Einsicht gewonnen zu haben, durch die er sich von seinem Meister trennt.
Das Prinzip Croces ruft nämlich mit Notwendigkeit die Frage hervor: ob es nicht
auch eine künstlerisch irrelevante Anschauung, einen künstlerisch irrelevanten Aus-
druck gebe, und welches Unterscheidungsmerkmal hier bestehe. Man wird einräumen,
daß es sich Croce mit der Zurückweisung dieser für die Beurteilung seiner Lehre
entscheidenden Frage zu leicht gemacht hat, und man wird dem Verfasser beipflich-
ten, wenn er findet, daß das „Gelungensein" des Ausdrucks kein ausreichendes Kri-
terium liefert. Die Bestimmung, die F. hierfür einsetzen will, lautet: „Der mensch-
liche Ausdruck ist seiner Natur nach ein zweckhafter und dient der Mitteilung eines
Tatbestandes oder sonst einem praktischen Zweck" (S. 9). Hingegen: „Der künst-
lerische Ausdruck ist der, der um seiner Form willen geschaffen wird" (S. 1T)I
Das ist nun nichts anderes als der Satz von der ästhetischen „Interesselosigkeit"
in einer seiner geläufigen Modifikationen. Aber der Verfasser unterliegt einer Selbst-
täuschung, wenn er damit über Croce hinausgegangen zu sein glaubt. Die ver-
meintlich neue Bestimmung ist bei Croce in der strengen Abgrenzung der Formen'
geistiger Aktivität gegeneinander, also auch der Anschauung gegen den Willen,
vollständig und ausdrücklich enthalten. Der gewöhnliche zweckhafte Ausdruck
(z. B. der Gruß), den F. gegen Croce anführt, ist eben für Croce wesentlich nicht
Ausdruck, sondern „Handlung" oder „Wollung" (azione, volizione). Allerdings
ist bei Croce die Bezeichnung des Sachverhaltes präziser, während der Verfasser
mit dem „um — willen" seiner Definition die Absicht als das Entscheidende hinzu-
stellen scheint, was dann durch seine eigene spätere Darlegung über den „halb
unbewußten künstlerischen Ausdruck" widerlegt wird (S. 112).
Die folgenden ausführenden Kapitel halten sich nicht bloß im Prinzip, sondern
auch in der Methode an ihr Muster. Sie bestehen wesentlich in der Heraushebung
des eigentlich Ästhetischen durch dialektische Abwehr heteronomer Bestimmungen,
wobei die Poesie besonders berücksichtigt wird. Unter diesem Gesichtspunkt wird
der Ballast verjährter ästhetischer Probleme (Problem des Inhalts, des Systems
BESPRECHUNGEN.
fessor A. P a u 1 e r sich der metaphysischen Richtung nähert. Die brennendsten
Fragen der modernen Ästhetik als da sind Kunst und Moral, Theorie der Literatur,
Philosophie der Kunst u. a. rinden ebenfalls vielseitige Beleuchtung.
Das Werk unseres Verfassers führt uns auch in den Strom der neuesten Be-
strebungen hinein und beweist damit, daß in Ungarn trotz dem Weltkrieg und dem
Zusammenbruch reges geistiges Leben herrscht, das Interesse für philosophische
Fragen sichtlich zunimmt, so daß auch auf diesem Gebiete für Ungarn nicht ein
Niedergang, sondern ein Aufstieg zu gewärtigen ist.
Budapest. E. v. Szelenyi.
Karl Federn: Das ästhetische Problem. A. Sponholtz, Hannover
1928. 142 Seiten.
Croces Ästhetik hat mit ihrer energischen und unkomplizierten Linienführung
verschiedentlich auf die deutsche Kunstwissenschaft eingewirkt. Hier wird zum
ersten Mal der Versuch unternommen, die Prinzipien des italienischen Philosophen
in ihrem ganzen Umfang und ihrer ganzen Schärfe in die deutsche Ästhetik ein
zuführen. Der Verfasser, der sich als Übersetzer Croces verdient gemacht hat,
leistet auch hier in einem etwas weiteren Sinne dieses Wortes eine Übertragung.
Der Fundamentalsatz der Ästhetik Croces behauptet die Identität von An7
schauung (intuizione) und Ausdruck. Das Kunstwerk, der eigentliche Gegenstand
der Ästhetik, ist Ausdruck und als solcher zugleich Anschauung. F. übernimmt
diesen Grundsatz einschränkungslos, doch meint er, darüber hinaus eine von Croce
verfehlte Einsicht gewonnen zu haben, durch die er sich von seinem Meister trennt.
Das Prinzip Croces ruft nämlich mit Notwendigkeit die Frage hervor: ob es nicht
auch eine künstlerisch irrelevante Anschauung, einen künstlerisch irrelevanten Aus-
druck gebe, und welches Unterscheidungsmerkmal hier bestehe. Man wird einräumen,
daß es sich Croce mit der Zurückweisung dieser für die Beurteilung seiner Lehre
entscheidenden Frage zu leicht gemacht hat, und man wird dem Verfasser beipflich-
ten, wenn er findet, daß das „Gelungensein" des Ausdrucks kein ausreichendes Kri-
terium liefert. Die Bestimmung, die F. hierfür einsetzen will, lautet: „Der mensch-
liche Ausdruck ist seiner Natur nach ein zweckhafter und dient der Mitteilung eines
Tatbestandes oder sonst einem praktischen Zweck" (S. 9). Hingegen: „Der künst-
lerische Ausdruck ist der, der um seiner Form willen geschaffen wird" (S. 1T)I
Das ist nun nichts anderes als der Satz von der ästhetischen „Interesselosigkeit"
in einer seiner geläufigen Modifikationen. Aber der Verfasser unterliegt einer Selbst-
täuschung, wenn er damit über Croce hinausgegangen zu sein glaubt. Die ver-
meintlich neue Bestimmung ist bei Croce in der strengen Abgrenzung der Formen'
geistiger Aktivität gegeneinander, also auch der Anschauung gegen den Willen,
vollständig und ausdrücklich enthalten. Der gewöhnliche zweckhafte Ausdruck
(z. B. der Gruß), den F. gegen Croce anführt, ist eben für Croce wesentlich nicht
Ausdruck, sondern „Handlung" oder „Wollung" (azione, volizione). Allerdings
ist bei Croce die Bezeichnung des Sachverhaltes präziser, während der Verfasser
mit dem „um — willen" seiner Definition die Absicht als das Entscheidende hinzu-
stellen scheint, was dann durch seine eigene spätere Darlegung über den „halb
unbewußten künstlerischen Ausdruck" widerlegt wird (S. 112).
Die folgenden ausführenden Kapitel halten sich nicht bloß im Prinzip, sondern
auch in der Methode an ihr Muster. Sie bestehen wesentlich in der Heraushebung
des eigentlich Ästhetischen durch dialektische Abwehr heteronomer Bestimmungen,
wobei die Poesie besonders berücksichtigt wird. Unter diesem Gesichtspunkt wird
der Ballast verjährter ästhetischer Probleme (Problem des Inhalts, des Systems