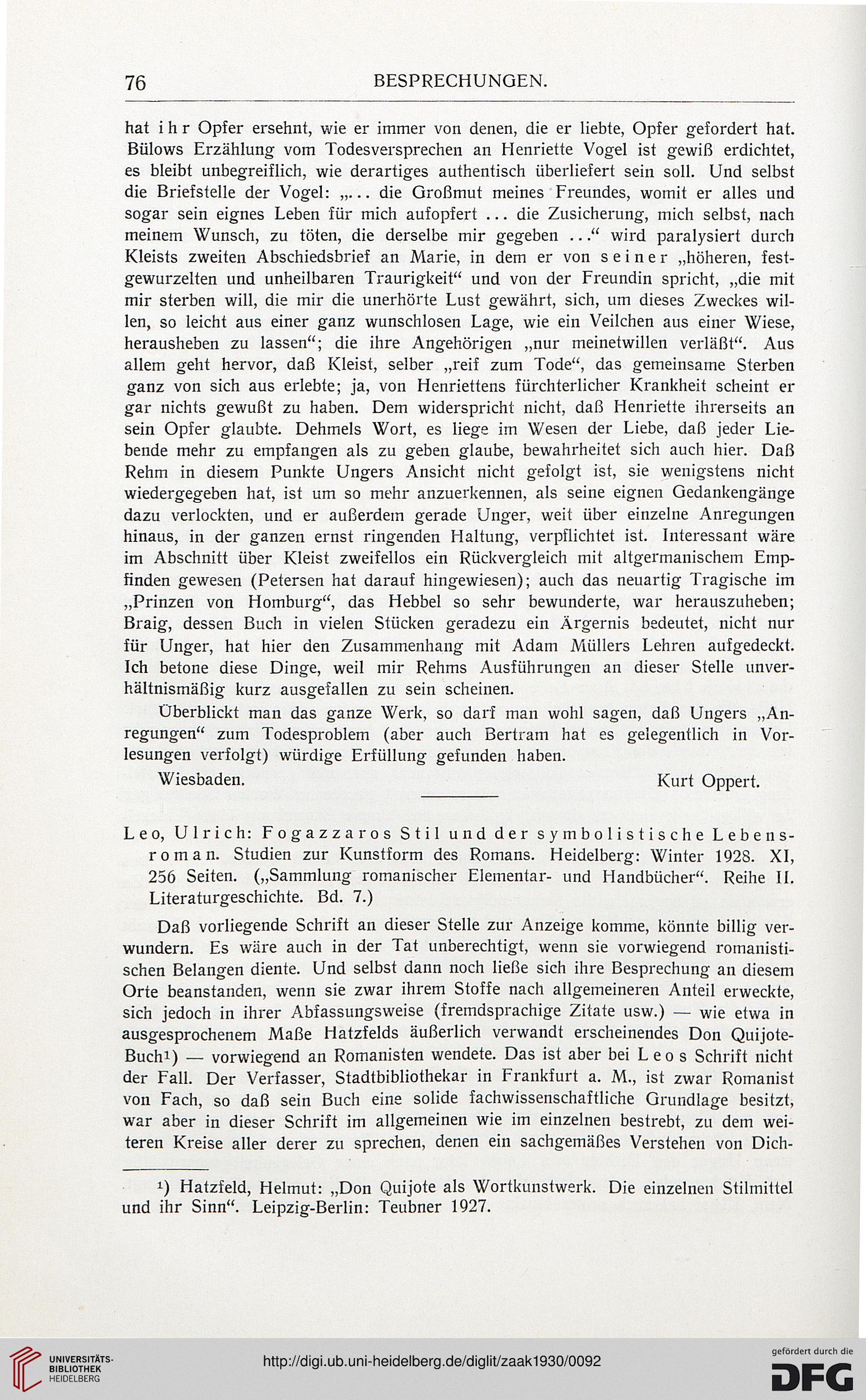76
BESPRECHUNGEN.
hat i h r Opfer ersehnt, wie er immer von denen, die er liebte, Opfer gefordert hat.
Bülows Erzählung vom Todesversprechen an Henriette Vogel ist gewiß erdichtet,
es bleibt unbegreiflich, wie derartiges authentisch überliefert sein soll. Und selbst
die Brief stelle der Vogel: „... die Großmut meines Freundes, womit er alles und
sogar sein eignes Leben für mich aufopfert ... die Zusicherung, mich selbst, nach
meinem Wunsch, zu töten, die derselbe mir gegeben ..." wird paralysiert durch
Kleists zweiten Abschiedsbrief an Marie, in dem er von seiner „höheren, fest-
gewurzelten und unheilbaren Traurigkeit" und von der Freundin spricht, „die mit
mir sterben will, die mir die unerhörte Lust gewährt, sich, um dieses Zweckes wil-
len, so leicht aus einer ganz wunschlosen Lage, wie ein Veilchen aus einer Wiese,
herausheben zu lassen"; die ihre Angehörigen „nur meinetwillen verläßt". Aus
allem geht hervor, daß Kleist, selber „reif zum Tode", das gemeinsame Sterben
ganz von sich aus erlebte; ja, von Henriettens fürchterlicher Krankheit scheint er
gar nichts gewußt zu haben. Dem widerspricht nicht, daß Henriette ihrerseits an
sein Opfer glaubte. Dehmels Wort, es liege im Wesen der Liebe, daß jeder Lie-
bende mehr zu empfangen als zu geben glaube, bewahrheitet sich auch hier. Daß
Rehm in diesem Punkte Ungers Ansicht nicht gefolgt ist, sie wenigstens nicht
wiedergegeben hat, ist um so mehr anzuerkennen, als seine eignen Gedankengänge
dazu verlockten, und er außerdem gerade Unger, weit über einzelne Anregungen
hinaus, in der ganzen ernst ringenden Haltung, verpflichtet ist. Interessant wäre
im Abschnitt über Kleist zweifellos ein Rückvergleich mit altgermanischem Emp-
finden gewesen (Petersen hat darauf hingewiesen); auch das neuartig Tragische im
„Prinzen von Homburg", das Hebbel so sehr bewunderte, war herauszuheben;
Braig, dessen Buch in vielen Stücken geradezu ein Ärgernis bedeutet, nicht nur
für Unger, hat hier den Zusammenhang mit Adam Müllers Lehren aufgedeckt.
Ich betone diese Dinge, weil mir Rehms Ausführungen an dieser Stelle unver-
hältnismäßig kurz ausgefallen zu sein scheinen.
Oberblickt man das ganze Werk, so darf man wohl sagen, daß Ungers „An-
regungen" zum Todesproblem (aber auch Bertram hat es gelegentlich in Vor-
lesungen verfolgt) würdige Erfüllung gefunden haben.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Leo, Ulrich: Fogazzaros Stil und der symbolistische Lebens-
roman. Studien zur Kunstform des Romans. Heidelberg: Winter 1928. XI,
256 Seiten. („Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher". Reihe II.
Literaturgeschichte. Bd. 7.)
Daß vorliegende Schrift an dieser Stelle zur Anzeige komme, könnte billig ver-
wundern. Es wäre auch in der Tat unberechtigt, wenn sie vorwiegend romanisti-
schen Belangen diente. Und selbst dann noch ließe sich ihre Besprechung an diesem
Orte beanstanden, wenn sie zwar ihrem Stoffe nach allgemeineren Anteil erweckte,
sich jedoch in ihrer Abfassungsweise (fremdsprachige Zitate usw.) — wie etwa in
ausgesprochenem Maße Hatzfelds äußerlich verwandt erscheinendes Don Quijote-
Buchi) — vorwiegend an Romanisten wendete. Das ist aber bei Leos Schrift nicht
der Fall. Der Verfasser, Stadtbibliothekar in Frankfurt a. M., ist zwar Romanist
von Fach, so daß sein Buch eine solide fachwissenschaftliche Grundlage besitzt,
war aber in dieser Schrift im allgemeinen wie im einzelnen bestrebt, zu dem wei-
teren Kreise aller derer zu sprechen, denen ein sachgemäßes Verstehen von Dich-
L) Hatzfeld, Helmut: „Don Quijote als Wortkunstwerk. Die einzelnen Stilmittel
und ihr Sinn". Leipzig-Berlin: Teubner 1927.
BESPRECHUNGEN.
hat i h r Opfer ersehnt, wie er immer von denen, die er liebte, Opfer gefordert hat.
Bülows Erzählung vom Todesversprechen an Henriette Vogel ist gewiß erdichtet,
es bleibt unbegreiflich, wie derartiges authentisch überliefert sein soll. Und selbst
die Brief stelle der Vogel: „... die Großmut meines Freundes, womit er alles und
sogar sein eignes Leben für mich aufopfert ... die Zusicherung, mich selbst, nach
meinem Wunsch, zu töten, die derselbe mir gegeben ..." wird paralysiert durch
Kleists zweiten Abschiedsbrief an Marie, in dem er von seiner „höheren, fest-
gewurzelten und unheilbaren Traurigkeit" und von der Freundin spricht, „die mit
mir sterben will, die mir die unerhörte Lust gewährt, sich, um dieses Zweckes wil-
len, so leicht aus einer ganz wunschlosen Lage, wie ein Veilchen aus einer Wiese,
herausheben zu lassen"; die ihre Angehörigen „nur meinetwillen verläßt". Aus
allem geht hervor, daß Kleist, selber „reif zum Tode", das gemeinsame Sterben
ganz von sich aus erlebte; ja, von Henriettens fürchterlicher Krankheit scheint er
gar nichts gewußt zu haben. Dem widerspricht nicht, daß Henriette ihrerseits an
sein Opfer glaubte. Dehmels Wort, es liege im Wesen der Liebe, daß jeder Lie-
bende mehr zu empfangen als zu geben glaube, bewahrheitet sich auch hier. Daß
Rehm in diesem Punkte Ungers Ansicht nicht gefolgt ist, sie wenigstens nicht
wiedergegeben hat, ist um so mehr anzuerkennen, als seine eignen Gedankengänge
dazu verlockten, und er außerdem gerade Unger, weit über einzelne Anregungen
hinaus, in der ganzen ernst ringenden Haltung, verpflichtet ist. Interessant wäre
im Abschnitt über Kleist zweifellos ein Rückvergleich mit altgermanischem Emp-
finden gewesen (Petersen hat darauf hingewiesen); auch das neuartig Tragische im
„Prinzen von Homburg", das Hebbel so sehr bewunderte, war herauszuheben;
Braig, dessen Buch in vielen Stücken geradezu ein Ärgernis bedeutet, nicht nur
für Unger, hat hier den Zusammenhang mit Adam Müllers Lehren aufgedeckt.
Ich betone diese Dinge, weil mir Rehms Ausführungen an dieser Stelle unver-
hältnismäßig kurz ausgefallen zu sein scheinen.
Oberblickt man das ganze Werk, so darf man wohl sagen, daß Ungers „An-
regungen" zum Todesproblem (aber auch Bertram hat es gelegentlich in Vor-
lesungen verfolgt) würdige Erfüllung gefunden haben.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Leo, Ulrich: Fogazzaros Stil und der symbolistische Lebens-
roman. Studien zur Kunstform des Romans. Heidelberg: Winter 1928. XI,
256 Seiten. („Sammlung romanischer Elementar- und Handbücher". Reihe II.
Literaturgeschichte. Bd. 7.)
Daß vorliegende Schrift an dieser Stelle zur Anzeige komme, könnte billig ver-
wundern. Es wäre auch in der Tat unberechtigt, wenn sie vorwiegend romanisti-
schen Belangen diente. Und selbst dann noch ließe sich ihre Besprechung an diesem
Orte beanstanden, wenn sie zwar ihrem Stoffe nach allgemeineren Anteil erweckte,
sich jedoch in ihrer Abfassungsweise (fremdsprachige Zitate usw.) — wie etwa in
ausgesprochenem Maße Hatzfelds äußerlich verwandt erscheinendes Don Quijote-
Buchi) — vorwiegend an Romanisten wendete. Das ist aber bei Leos Schrift nicht
der Fall. Der Verfasser, Stadtbibliothekar in Frankfurt a. M., ist zwar Romanist
von Fach, so daß sein Buch eine solide fachwissenschaftliche Grundlage besitzt,
war aber in dieser Schrift im allgemeinen wie im einzelnen bestrebt, zu dem wei-
teren Kreise aller derer zu sprechen, denen ein sachgemäßes Verstehen von Dich-
L) Hatzfeld, Helmut: „Don Quijote als Wortkunstwerk. Die einzelnen Stilmittel
und ihr Sinn". Leipzig-Berlin: Teubner 1927.