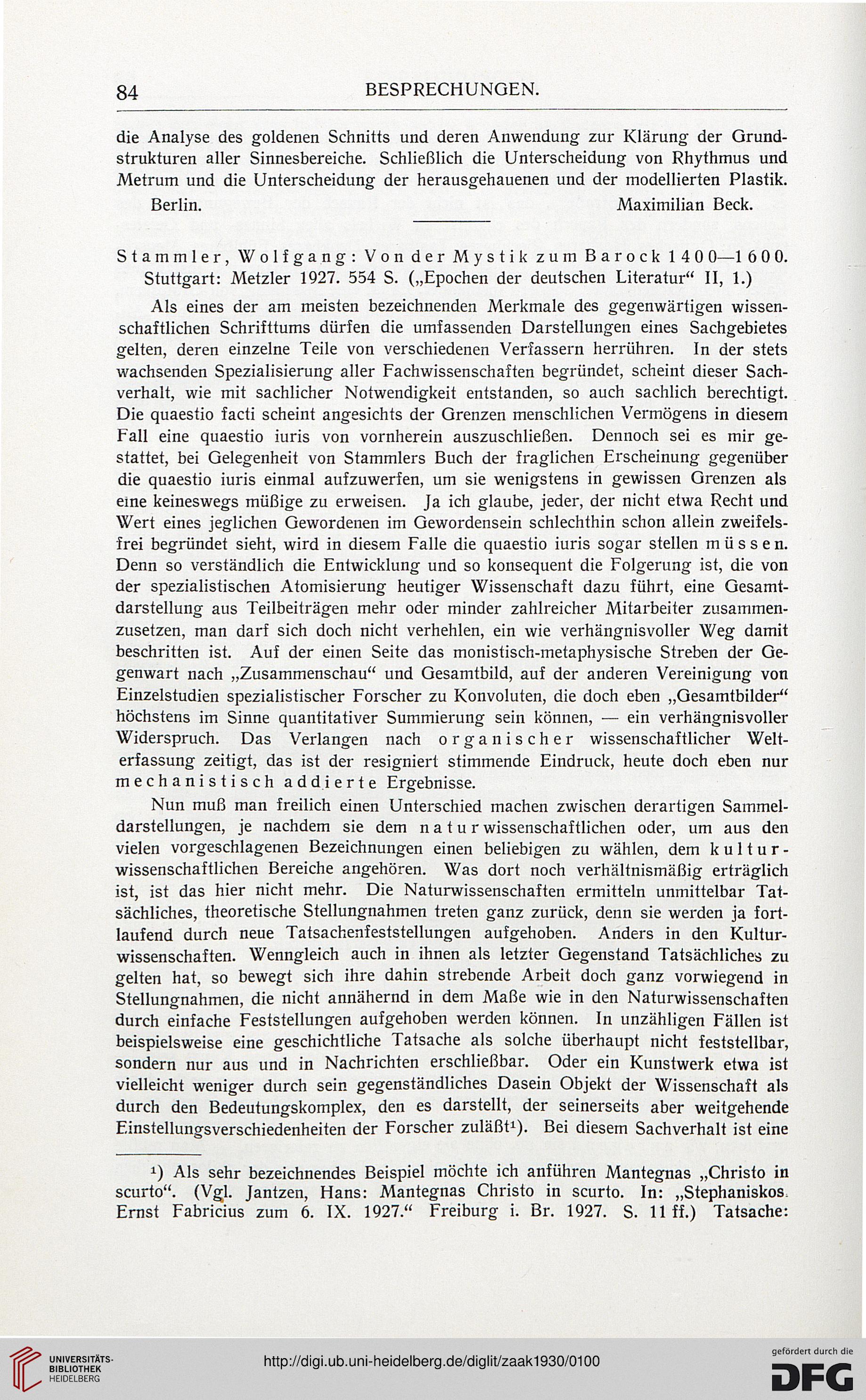84
BESPRECHUNGEN.
die Analyse des goldenen Schnitts und deren Anwendung zur Klärung der Grund-
strukturen aller Sinnesbereiche. Schließlich die Unterscheidung von Rhythmus und
Metrum und die Unterscheidung der herausgehauenen und der modellierten Plastik.
Berlin. Maximilian Beck.
Stammler, Wolfgang: Von der Mystik zum Barock 140 0—1 6 0 0.
Stuttgart: Metzler 1927. 554 S. („Epochen der deutschen Literatur" II, l.j
Als eines der am meisten bezeichnenden Merkmale des gegenwärtigen wissen-
schaftlichen Schrifttums dürfen die umfassenden Darstellungen eines Sachgebietes
gelten, deren einzelne Teile von verschiedenen Verfassern herrühren. In der stets
wachsenden Spezialisierung aller Fachwissenschaften begründet, scheint dieser Sach-
verhalt, wie mit sachlicher Notwendigkeit entstanden, so auch sachlich berechtigt.
Die quaestio facti scheint angesichts der Grenzen menschlichen Vermögens in diesem
Fall eine quaestio iuris von vornherein auszuschließen. Dennoch sei es mir ge-
stattet, bei Gelegenheit von Stammlers Buch der fraglichen Erscheinung gegenüber
die quaestio iuris einmal aufzuwerfen, um sie wenigstens in gewissen Grenzen als
eine keineswegs müßige zu erweisen. Ja ich glaube, jeder, der nicht etwa Recht und
Wert eines jeglichen Gewordenen im Gewordensein schlechthin schon allein zweifels-
frei begründet sieht, wird in diesem Falle die quaestio iuris sogar stellen müssen.
Denn so verständlich die Entwicklung und so konsequent die Folgerung ist, die von
der spezialistischen Atomisierung heutiger Wissenschaft dazu führt, eine Gesamt-
darstellung aus Teilbeiträgen mehr oder minder zahlreicher Mitarbeiter zusammen-
zusetzen, man darf sich doch nicht verhehlen, ein wie verhängnisvoller Weg damit
beschritten ist. Auf der einen Seite das monistisch-metaphysische Streben der Ge-
genwart nach „Zusammenschau" und Gesamtbild, auf der anderen Vereinigung von
Einzelstudien spezialistischer Forscher zu Konvoluten, die doch eben „Gesamtbilder"
höchstens im Sinne quantitativer Summierung sein können, — ein verhängnisvoller
Widerspruch. Das Verlangen nach organischer wissenschaftlicher Welt-
erfassung zeitigt, das ist der resigniert stimmende Eindruck, heute doch eben nur
mechanistisch addierte Ergebnisse.
Nun muß man freilich einen Unterschied machen zwischen derartigen Sammel-
darstellungen, je nachdem sie dem n a t u r wissenschaftlichen oder, um aus den
vielen vorgeschlagenen Bezeichnungen einen beliebigen zu wählen, dem k u 11 u r -
wissenschaftlichen Bereiche angehören. Was dort noch verhältnismäßig erträglich
ist, ist das hier nicht mehr. Die Naturwissenschaften ermitteln unmittelbar Tat-
sächliches, theoretische Stellungnahmen treten ganz zurück, denn sie werden ja fort-
laufend durch neue Tatsachenfeststellungen aufgehoben. Anders in den Kultur-
wissenschaften. Wenngleich auch in ihnen als letzter Gegenstand Tatsächliches zu
gelten hat, so bewegt sich ihre dahin strebende Arbeit doch ganz vorwiegend in
Stellungnahmen, die nicht annähernd in dem Maße wie in den Naturwissenschaften
durch einfache Feststellungen aufgehoben werden können. In unzähligen Fällen ist
beispielsweise eine geschichtliche Tatsache als solche überhaupt nicht feststellbar,
sondern nur aus und in Nachrichten erschließbar. Oder ein Kunstwerk etwa ist
vielleicht weniger durch sein gegenständliches Dasein Objekt der Wissenschaft als
durch den Bedeutungskomplex, den es darstellt, der seinerseits aber weitgehende
Einstellungsverschiedenheiten der Forscher zuläßt1). Bei diesem Sachverhalt ist eine
1) Als sehr bezeichnendes Beispiel möchte ich anführen Mantegnas „Christo in
scurto". (Vgl. Jantzen, Hans: Mantegnas Christo in scurto. In: „Stephaniskos
Ernst Fabricius zum 6. IX. 1927." Freiburg i. Br. 1927. S. 11 ff.) Tatsache:
BESPRECHUNGEN.
die Analyse des goldenen Schnitts und deren Anwendung zur Klärung der Grund-
strukturen aller Sinnesbereiche. Schließlich die Unterscheidung von Rhythmus und
Metrum und die Unterscheidung der herausgehauenen und der modellierten Plastik.
Berlin. Maximilian Beck.
Stammler, Wolfgang: Von der Mystik zum Barock 140 0—1 6 0 0.
Stuttgart: Metzler 1927. 554 S. („Epochen der deutschen Literatur" II, l.j
Als eines der am meisten bezeichnenden Merkmale des gegenwärtigen wissen-
schaftlichen Schrifttums dürfen die umfassenden Darstellungen eines Sachgebietes
gelten, deren einzelne Teile von verschiedenen Verfassern herrühren. In der stets
wachsenden Spezialisierung aller Fachwissenschaften begründet, scheint dieser Sach-
verhalt, wie mit sachlicher Notwendigkeit entstanden, so auch sachlich berechtigt.
Die quaestio facti scheint angesichts der Grenzen menschlichen Vermögens in diesem
Fall eine quaestio iuris von vornherein auszuschließen. Dennoch sei es mir ge-
stattet, bei Gelegenheit von Stammlers Buch der fraglichen Erscheinung gegenüber
die quaestio iuris einmal aufzuwerfen, um sie wenigstens in gewissen Grenzen als
eine keineswegs müßige zu erweisen. Ja ich glaube, jeder, der nicht etwa Recht und
Wert eines jeglichen Gewordenen im Gewordensein schlechthin schon allein zweifels-
frei begründet sieht, wird in diesem Falle die quaestio iuris sogar stellen müssen.
Denn so verständlich die Entwicklung und so konsequent die Folgerung ist, die von
der spezialistischen Atomisierung heutiger Wissenschaft dazu führt, eine Gesamt-
darstellung aus Teilbeiträgen mehr oder minder zahlreicher Mitarbeiter zusammen-
zusetzen, man darf sich doch nicht verhehlen, ein wie verhängnisvoller Weg damit
beschritten ist. Auf der einen Seite das monistisch-metaphysische Streben der Ge-
genwart nach „Zusammenschau" und Gesamtbild, auf der anderen Vereinigung von
Einzelstudien spezialistischer Forscher zu Konvoluten, die doch eben „Gesamtbilder"
höchstens im Sinne quantitativer Summierung sein können, — ein verhängnisvoller
Widerspruch. Das Verlangen nach organischer wissenschaftlicher Welt-
erfassung zeitigt, das ist der resigniert stimmende Eindruck, heute doch eben nur
mechanistisch addierte Ergebnisse.
Nun muß man freilich einen Unterschied machen zwischen derartigen Sammel-
darstellungen, je nachdem sie dem n a t u r wissenschaftlichen oder, um aus den
vielen vorgeschlagenen Bezeichnungen einen beliebigen zu wählen, dem k u 11 u r -
wissenschaftlichen Bereiche angehören. Was dort noch verhältnismäßig erträglich
ist, ist das hier nicht mehr. Die Naturwissenschaften ermitteln unmittelbar Tat-
sächliches, theoretische Stellungnahmen treten ganz zurück, denn sie werden ja fort-
laufend durch neue Tatsachenfeststellungen aufgehoben. Anders in den Kultur-
wissenschaften. Wenngleich auch in ihnen als letzter Gegenstand Tatsächliches zu
gelten hat, so bewegt sich ihre dahin strebende Arbeit doch ganz vorwiegend in
Stellungnahmen, die nicht annähernd in dem Maße wie in den Naturwissenschaften
durch einfache Feststellungen aufgehoben werden können. In unzähligen Fällen ist
beispielsweise eine geschichtliche Tatsache als solche überhaupt nicht feststellbar,
sondern nur aus und in Nachrichten erschließbar. Oder ein Kunstwerk etwa ist
vielleicht weniger durch sein gegenständliches Dasein Objekt der Wissenschaft als
durch den Bedeutungskomplex, den es darstellt, der seinerseits aber weitgehende
Einstellungsverschiedenheiten der Forscher zuläßt1). Bei diesem Sachverhalt ist eine
1) Als sehr bezeichnendes Beispiel möchte ich anführen Mantegnas „Christo in
scurto". (Vgl. Jantzen, Hans: Mantegnas Christo in scurto. In: „Stephaniskos
Ernst Fabricius zum 6. IX. 1927." Freiburg i. Br. 1927. S. 11 ff.) Tatsache: