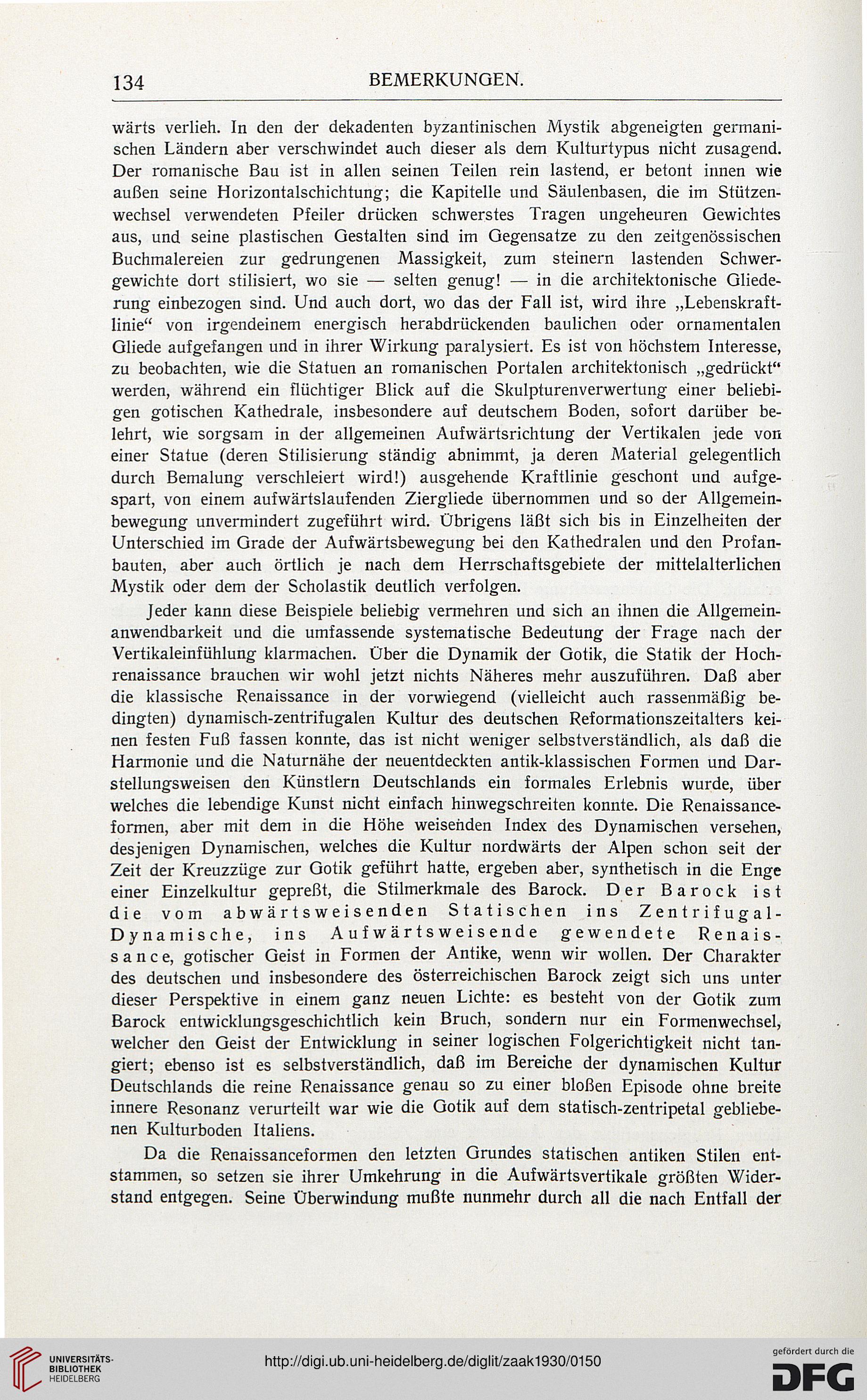134
BEMERKUNGEN.
wärts verlieh. In den der dekadenten byzantinischen Mystik abgeneigten germani-
schen Ländern aber verschwindet auch dieser als dem Kulturtypus nicht zusagend.
Der romanische Bau ist in allen seinen Teilen rein lastend, er betont innen wie
außen seine Horizontalschichtung; die Kapitelle und Säulenbasen, die im Stützen-
wechsel verwendeten Pfeiler drücken schwerstes Tragen ungeheuren Gewichtes
aus, und seine plastischen Gestalten sind im Gegensatze zu den zeitgenössischen
Buchmalereien zur gedrungenen Massigkeit, zum steinern lastenden Schwer-
gewichte dort stilisiert, wo sie — selten genug! — in die architektonische Gliede-
rung einbezogen sind. Und auch dort, wo das der Fall ist, wird ihre „Lebenskraft-
linie" von irgendeinem energisch herabdrückenden baulichen oder ornamentalen
Gliede aufgefangen und in ihrer Wirkung paralysiert. Es ist von höchstem Interesse,
zu beobachten, wie die Statuen an romanischen Portalen architektonisch „gedrückt"
werden, während ein flüchtiger Blick auf die Skulpturenverwertung einer beliebi-
gen gotischen Kathedrale, insbesondere auf deutschem Boden, sofort darüber be-
lehrt, wie sorgsam in der allgemeinen Aufwärtsrichtung der Vertikalen jede von
einer Statue (deren Stilisierung ständig abnimmt, ja deren Material gelegentlich
durch Bemalung verschleiert wird!) ausgehende Kraftlinie geschont und aufge-
spart, von einem aufwärtslaufenden Ziergliede übernommen und so der Allgemein-
bewegung unvermindert zugeführt wird. Übrigens läßt sich bis in Einzelheiten der
Unterschied im Grade der Aufwärtsbewegung bei den Kathedralen und den Profan-
bauten, aber auch örtlich je nach dem Herrschaftsgebiete der mittelalterlichen
Mystik oder dem der Scholastik deutlich verfolgen.
Jeder kann diese Beispiele beliebig vermehren und sich an ihnen die Allgemein-
anwendbarkeit und die umfassende systematische Bedeutung der Frage nach der
Vertikaleinfühlung klarmachen. Über die Dynamik der Gotik, die Statik der Hoch-
renaissance brauchen wir wohl jetzt nichts Näheres mehr auszuführen. Daß aber
die klassische Renaissance in der vorwiegend (vielleicht auch rassenmäßig be-
dingten) dynamisch-zentrifugalen Kultur des deutschen Reformationszeitalters kei-
nen festen Fuß fassen konnte, das ist nicht weniger selbstverständlich, als daß die
Harmonie und die Naturnähe der neuentdeckten antik-klassischen Formen und Dar-
stellungsweisen den Künstlern Deutschlands ein formales Erlebnis wurde, über
welches die lebendige Kunst nicht einfach hinwegschreiten konnte. Die Renaissance-
formen, aber mit dem in die Höhe weisenden Index des Dynamischen versehen,
desjenigen Dynamischen, welches die Kultur nordwärts der Alpen schon seit der
Zeit der Kreuzzüge zur Gotik geführt hatte, ergeben aber, synthetisch in die Enge
einer Einzelkultur gepreßt, die Stilmerkmale des Barock. Der Barock ist
die vom a b w ä r t s w e i s e n d e n Statischen ins Zentrifugal-
Dynamische, ins A u f w ä r t s w ei s end e gewendete Renais-
sance, gotischer Geist in Formen der Antike, wenn wir wollen. Der Charakter
des deutschen und insbesondere des österreichischen Barock zeigt sich uns unter
dieser Perspektive in einem ganz neuen Lichte: es besteht von der Gotik zum
Barock entwicklungsgeschichtlich kein Bruch, sondern nur ein Formenwechsel,
welcher den Geist der Entwicklung in seiner logischen Folgerichtigkeit nicht tan-
giert; ebenso ist es selbstverständlich, daß im Bereiche der dynamischen Kultur
Deutschlands die reine Renaissance genau so zu einer bloßen Episode ohne breite
innere Resonanz verurteilt war wie die Gotik auf dem statisch-zentripetal gebliebe-
nen Kulturboden Italiens.
Da die Renaissanceformen den letzten Grundes statischen antiken Stilen ent-
stammen, so setzen sie ihrer Umkehrung in die Aufwärtsvertikale größten Wider-
stand entgegen. Seine Überwindung mußte nunmehr durch all die nach Entfall der
BEMERKUNGEN.
wärts verlieh. In den der dekadenten byzantinischen Mystik abgeneigten germani-
schen Ländern aber verschwindet auch dieser als dem Kulturtypus nicht zusagend.
Der romanische Bau ist in allen seinen Teilen rein lastend, er betont innen wie
außen seine Horizontalschichtung; die Kapitelle und Säulenbasen, die im Stützen-
wechsel verwendeten Pfeiler drücken schwerstes Tragen ungeheuren Gewichtes
aus, und seine plastischen Gestalten sind im Gegensatze zu den zeitgenössischen
Buchmalereien zur gedrungenen Massigkeit, zum steinern lastenden Schwer-
gewichte dort stilisiert, wo sie — selten genug! — in die architektonische Gliede-
rung einbezogen sind. Und auch dort, wo das der Fall ist, wird ihre „Lebenskraft-
linie" von irgendeinem energisch herabdrückenden baulichen oder ornamentalen
Gliede aufgefangen und in ihrer Wirkung paralysiert. Es ist von höchstem Interesse,
zu beobachten, wie die Statuen an romanischen Portalen architektonisch „gedrückt"
werden, während ein flüchtiger Blick auf die Skulpturenverwertung einer beliebi-
gen gotischen Kathedrale, insbesondere auf deutschem Boden, sofort darüber be-
lehrt, wie sorgsam in der allgemeinen Aufwärtsrichtung der Vertikalen jede von
einer Statue (deren Stilisierung ständig abnimmt, ja deren Material gelegentlich
durch Bemalung verschleiert wird!) ausgehende Kraftlinie geschont und aufge-
spart, von einem aufwärtslaufenden Ziergliede übernommen und so der Allgemein-
bewegung unvermindert zugeführt wird. Übrigens läßt sich bis in Einzelheiten der
Unterschied im Grade der Aufwärtsbewegung bei den Kathedralen und den Profan-
bauten, aber auch örtlich je nach dem Herrschaftsgebiete der mittelalterlichen
Mystik oder dem der Scholastik deutlich verfolgen.
Jeder kann diese Beispiele beliebig vermehren und sich an ihnen die Allgemein-
anwendbarkeit und die umfassende systematische Bedeutung der Frage nach der
Vertikaleinfühlung klarmachen. Über die Dynamik der Gotik, die Statik der Hoch-
renaissance brauchen wir wohl jetzt nichts Näheres mehr auszuführen. Daß aber
die klassische Renaissance in der vorwiegend (vielleicht auch rassenmäßig be-
dingten) dynamisch-zentrifugalen Kultur des deutschen Reformationszeitalters kei-
nen festen Fuß fassen konnte, das ist nicht weniger selbstverständlich, als daß die
Harmonie und die Naturnähe der neuentdeckten antik-klassischen Formen und Dar-
stellungsweisen den Künstlern Deutschlands ein formales Erlebnis wurde, über
welches die lebendige Kunst nicht einfach hinwegschreiten konnte. Die Renaissance-
formen, aber mit dem in die Höhe weisenden Index des Dynamischen versehen,
desjenigen Dynamischen, welches die Kultur nordwärts der Alpen schon seit der
Zeit der Kreuzzüge zur Gotik geführt hatte, ergeben aber, synthetisch in die Enge
einer Einzelkultur gepreßt, die Stilmerkmale des Barock. Der Barock ist
die vom a b w ä r t s w e i s e n d e n Statischen ins Zentrifugal-
Dynamische, ins A u f w ä r t s w ei s end e gewendete Renais-
sance, gotischer Geist in Formen der Antike, wenn wir wollen. Der Charakter
des deutschen und insbesondere des österreichischen Barock zeigt sich uns unter
dieser Perspektive in einem ganz neuen Lichte: es besteht von der Gotik zum
Barock entwicklungsgeschichtlich kein Bruch, sondern nur ein Formenwechsel,
welcher den Geist der Entwicklung in seiner logischen Folgerichtigkeit nicht tan-
giert; ebenso ist es selbstverständlich, daß im Bereiche der dynamischen Kultur
Deutschlands die reine Renaissance genau so zu einer bloßen Episode ohne breite
innere Resonanz verurteilt war wie die Gotik auf dem statisch-zentripetal gebliebe-
nen Kulturboden Italiens.
Da die Renaissanceformen den letzten Grundes statischen antiken Stilen ent-
stammen, so setzen sie ihrer Umkehrung in die Aufwärtsvertikale größten Wider-
stand entgegen. Seine Überwindung mußte nunmehr durch all die nach Entfall der