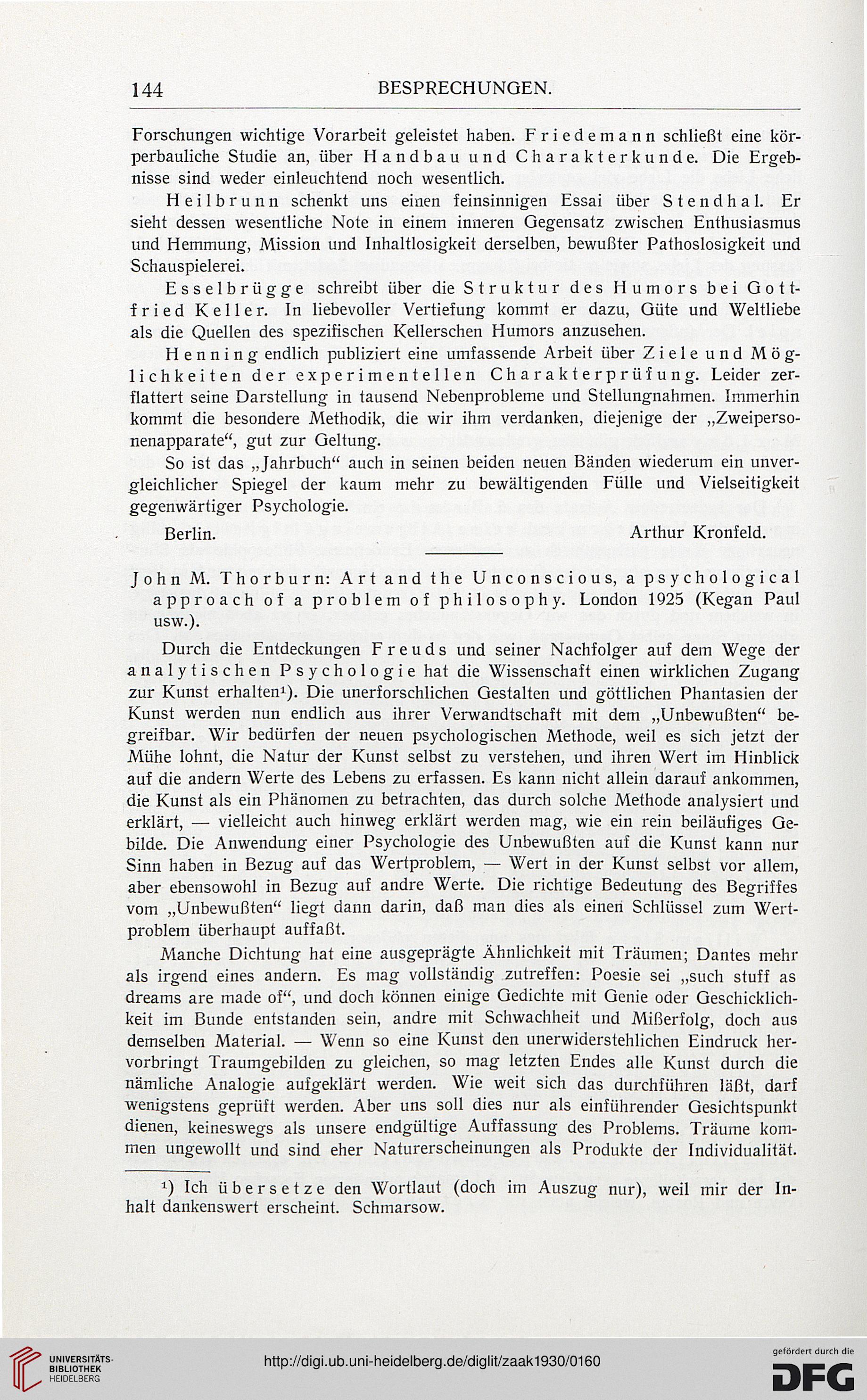144
BESPRECHUNGEN.
Forschungen wichtige Vorarbeit geleistet haben. Friedemann schließt eine kör-
perbauliche Studie an, über Handbau und Charakter künde. Die Ergeb-
nisse sind weder einleuchtend noch wesentlich.
Heilbrunn schenkt uns einen feinsinnigen Essai über Stendhal. Er
sieht dessen wesentliche Note in einem inneren Gegensatz zwischen Enthusiasmus
und Hemmung, Mission und Inhaltlosigkeit derselben, bewußter Pathoslosigkeit und
Schauspielerei.
Esselbrügge schreibt über die Struktur des Humors bei Gott-
fried Keller. In liebevoller Vertiefung kommt er dazu, Güte und Weltliebe
als die Quellen des spezifischen Kellerschen Humors anzusehen.
Henning endlich publiziert eine umfassende Arbeit über Ziele und Mög-
lichkeiten der experimentellen Charakterprüfung. Leider zer-
flattert seine Darstellung in tausend Nebenprobleme und Stellungnahmen. Immerhin
kommt die besondere Methodik, die wir ihm verdanken, diejenige der „Zweiperso-
nenapparate", gut zur Geltung.
So ist das „Jahrbuch" auch in seinen beiden neuen Bänden wiederum ein unver-
gleichlicher Spiegel der kaum mehr zu bewältigenden Fülle und Vielseitigkeit
gegenwärtiger Psychologie.
Berlin. Arthur Kronfeld.
John M. Thorburn: Art and the Unconscious, a psychological
approach of a problem of philosophy. London 1925 (Kegan Paul
usw.).
Durch die Entdeckungen Freuds und seiner Nachfolger auf dem Wege der
analytischen Psychologie hat die Wissenschaft einen wirklichen Zugang
zur Kunst erhalten1). Die unerforschlichen Gestalten und göttlichen Phantasien der
Kunst werden nun endlich aus ihrer Verwandtschaft mit dem „Unbewußten" be-
greifbar. Wir bedürfen der neuen psychologischen Methode, weil es sich jetzt der
Mühe lohnt, die Natur der Kunst selbst zu verstehen, und ihren Wert im Hinblick
auf die andern Werte des Lebens zu erfassen. Es kann nicht allein darauf ankommen,
die Kunst als ein Phänomen zu betrachten, das durch solche Methode analysiert und
erklärt, — vielleicht auch hinweg erklärt werden mag, wie ein rein beiläufiges Ge-
bilde. Die Anwendung einer Psychologie des Unbewußten auf die Kunst kann nur
Sinn haben in Bezug auf das Wertproblem, — Wert in der Kunst selbst vor allem,
aber ebensowohl in Bezug auf andre Werte. Die richtige Bedeutung des Begriffes
vom „Unbewußten" liegt dann darin, daß man dies als einen Schlüssel zum Wert-
problem überhaupt auffaßt.
Manche Dichtung hat eine ausgeprägte Ähnlichkeit mit Träumen; Dantes mehr
als irgend eines andern. Es mag vollständig zutreffen: Poesie sei „such stuff as
dreams are made of", und doch können einige Gedichte mit Genie oder Geschicklich-
keit im Bunde entstanden sein, andre mit Schwachheit und Mißerfolg, doch aus
demselben Material. — Wenn so eine Kunst den unerwiderstehlichen Eindruck her-
vorbringt Traumgebilden zu gleichen, so mag letzten Endes alle Kunst durch die
nämliche Analogie aufgeklärt werden. Wie weit sich das durchführen läßt, darf
wenigstens geprüft werden. Aber uns soll dies nur als einführender Gesichtspunkt
dienen, keineswegs als unsere endgültige Auffassung des Problems. Träume kom-
men ungewollt und sind eher Naturerscheinungen als Produkte der Individualität.
*) Ich übersetze den Wortlaut (doch im Auszug nur), weil mir der In-
halt dankenswert erscheint. Schmarsow.
BESPRECHUNGEN.
Forschungen wichtige Vorarbeit geleistet haben. Friedemann schließt eine kör-
perbauliche Studie an, über Handbau und Charakter künde. Die Ergeb-
nisse sind weder einleuchtend noch wesentlich.
Heilbrunn schenkt uns einen feinsinnigen Essai über Stendhal. Er
sieht dessen wesentliche Note in einem inneren Gegensatz zwischen Enthusiasmus
und Hemmung, Mission und Inhaltlosigkeit derselben, bewußter Pathoslosigkeit und
Schauspielerei.
Esselbrügge schreibt über die Struktur des Humors bei Gott-
fried Keller. In liebevoller Vertiefung kommt er dazu, Güte und Weltliebe
als die Quellen des spezifischen Kellerschen Humors anzusehen.
Henning endlich publiziert eine umfassende Arbeit über Ziele und Mög-
lichkeiten der experimentellen Charakterprüfung. Leider zer-
flattert seine Darstellung in tausend Nebenprobleme und Stellungnahmen. Immerhin
kommt die besondere Methodik, die wir ihm verdanken, diejenige der „Zweiperso-
nenapparate", gut zur Geltung.
So ist das „Jahrbuch" auch in seinen beiden neuen Bänden wiederum ein unver-
gleichlicher Spiegel der kaum mehr zu bewältigenden Fülle und Vielseitigkeit
gegenwärtiger Psychologie.
Berlin. Arthur Kronfeld.
John M. Thorburn: Art and the Unconscious, a psychological
approach of a problem of philosophy. London 1925 (Kegan Paul
usw.).
Durch die Entdeckungen Freuds und seiner Nachfolger auf dem Wege der
analytischen Psychologie hat die Wissenschaft einen wirklichen Zugang
zur Kunst erhalten1). Die unerforschlichen Gestalten und göttlichen Phantasien der
Kunst werden nun endlich aus ihrer Verwandtschaft mit dem „Unbewußten" be-
greifbar. Wir bedürfen der neuen psychologischen Methode, weil es sich jetzt der
Mühe lohnt, die Natur der Kunst selbst zu verstehen, und ihren Wert im Hinblick
auf die andern Werte des Lebens zu erfassen. Es kann nicht allein darauf ankommen,
die Kunst als ein Phänomen zu betrachten, das durch solche Methode analysiert und
erklärt, — vielleicht auch hinweg erklärt werden mag, wie ein rein beiläufiges Ge-
bilde. Die Anwendung einer Psychologie des Unbewußten auf die Kunst kann nur
Sinn haben in Bezug auf das Wertproblem, — Wert in der Kunst selbst vor allem,
aber ebensowohl in Bezug auf andre Werte. Die richtige Bedeutung des Begriffes
vom „Unbewußten" liegt dann darin, daß man dies als einen Schlüssel zum Wert-
problem überhaupt auffaßt.
Manche Dichtung hat eine ausgeprägte Ähnlichkeit mit Träumen; Dantes mehr
als irgend eines andern. Es mag vollständig zutreffen: Poesie sei „such stuff as
dreams are made of", und doch können einige Gedichte mit Genie oder Geschicklich-
keit im Bunde entstanden sein, andre mit Schwachheit und Mißerfolg, doch aus
demselben Material. — Wenn so eine Kunst den unerwiderstehlichen Eindruck her-
vorbringt Traumgebilden zu gleichen, so mag letzten Endes alle Kunst durch die
nämliche Analogie aufgeklärt werden. Wie weit sich das durchführen läßt, darf
wenigstens geprüft werden. Aber uns soll dies nur als einführender Gesichtspunkt
dienen, keineswegs als unsere endgültige Auffassung des Problems. Träume kom-
men ungewollt und sind eher Naturerscheinungen als Produkte der Individualität.
*) Ich übersetze den Wortlaut (doch im Auszug nur), weil mir der In-
halt dankenswert erscheint. Schmarsow.