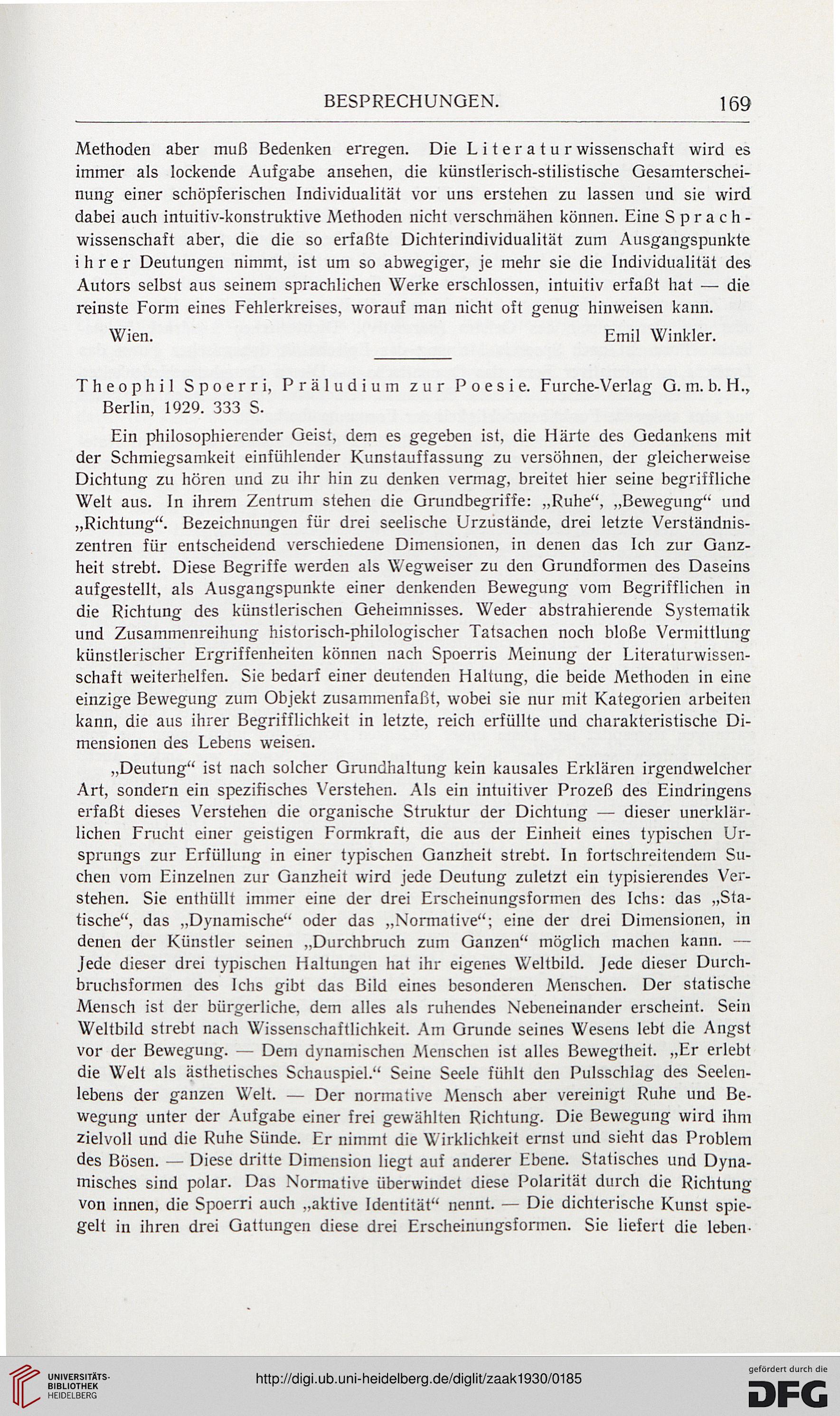BESPRECHUNGEN.
169
Methoden aber muß Bedenken erregen. Die Literatur Wissenschaft wird es
immer als lockende Aufgabe ansehen, die künstlerisch-stilistische Gesamterschei-
nung einer schöpferischen Individualität vor uns erstehen zu lassen und sie wird
dabei auch intuitiv-konstruktive Methoden nicht verschmähen können. Eine Sprach-
wissenschaft aber, die die so erfaßte Dichterindividualität zum Ausgangspunkte
ihrer Deutungen nimmt, ist um so abwegiger, je mehr sie die Individualität des
Autors selbst aus seinem sprachlichen Werke erschlossen, intuitiv erfaßt hat — die
reinste Form eines Fehlerkreises, worauf man nicht oft genug hinweisen kann.
Wien. Emil Winkler.
Theophil Spoerri, Präludium zur Poesie. Furche-Verlag G.m.b.H.,
Berlin, 1929. 333 S.
Ein philosophierender Geist, dem es gegeben ist, die Härte des Gedankens mit
der Schmiegsamkeit einfühlender Kunstauffassung zu versöhnen, der gleicherweise
Dichtung zu hören und zu ihr hin zu denken vermag, breitet hier seine begriffliche
Welt aus. In ihrem Zentrum stehen die Grundbegriffe: „Ruhe", „Bewegung" und
„Richtung". Bezeichnungen für drei seelische Urzustände, drei letzte Verständnis-
zentren für entscheidend verschiedene Dimensionen, in denen das Ich zur Ganz-
heit strebt. Diese Begriffe werden als Wegweiser zu den Grundformen des Daseins
aufgestellt, als Ausgangspunkte einer denkenden Bewegung vom Begrifflichen in
die Richtung des künstlerischen Geheimnisses. Weder abstrahierende Systematik
und Zusammenreihung historisch-philologischer Tatsachen noch bloße Vermittlung
künstlerischer Ergriffenheiten können nach Spoerris Meinung der Literaturwissen-
schaft weiterhelfen. Sie bedarf einer deutenden Haltung, die beide Methoden in eine
einzige Bewegung zum Objekt zusammenfaßt, wobei sie nur mit Kategorien arbeiten
kann, die aus ihrer Begrifflichkeit in letzte, reich erfüllte und charakteristische Di-
mensionen des Lebens weisen.
„Deutung" ist nach solcher Grundhaltung kein kausales Erklären irgendwelcher
Art, sondern ein spezifisches Verstehen. Als ein intuitiver Prozeß des Eindringens
erfaßt dieses Verstehen die organische Struktur der Dichtung — dieser unerklär-
lichen Frucht einer geistigen Formkraft, die aus der Einheit eines typischen Ur-
sprungs zur Erfüllung in einer typischen Ganzheit strebt. In fortschreitendem Su-
chen vom Einzelnen zur Ganzheit wird jede Deutung zuletzt ein typisierendes Ver-
stehen. Sie enthüllt immer eine der drei Erscheinungsformen des Ichs: das „Sta-
tische", das „Dynamische" oder das „Normative"; eine der drei Dimensionen, in
denen der Künstler seinen „Durchbruch zum Ganzen" möglich machen kann. —
Jede dieser drei typischen Haltungen hat ihr eigenes Weltbild. Jede dieser Durch-
bruchsformen des Ichs gibt das Bild eines besonderen Menschen. Der statische
Mensch ist der bürgerliche, dem alles als ruhendes Nebeneinander erscheint. Sein
Weltbild strebt nach Wissenschaftlichkeit. Am Grunde seines Wesens lebt die Angst
vor der Bewegung. — Dem dynamischen Menschen ist alles Bewegtheit. „Er erlebt
die Welt als ästhetisches Schauspiel." Seine Seele fühlt den Pulsschlag des Seelen-
lebens der ganzen Welt. — Der normative Mensch aber vereinigt Ruhe und Be-
wegung unter der Aufgabe einer frei gewählten Richtung. Die Bewegung wird ihm
zielvoll und die Ruhe Sünde. Er nimmt die Wirklichkeit ernst und sieht das Problem
des Bösen. — Diese dritte Dimension liegt auf anderer Ebene. Statisches und Dyna-
misches sind polar. Das Normative überwindet diese Polarität durch die Richtung
von innen, die Spoerri auch „aktive Identität" nennt. — Die dichterische Kunst spie-
gelt in ihren drei Gattungen diese drei Erscheinungsformen. Sie liefert die leben-
169
Methoden aber muß Bedenken erregen. Die Literatur Wissenschaft wird es
immer als lockende Aufgabe ansehen, die künstlerisch-stilistische Gesamterschei-
nung einer schöpferischen Individualität vor uns erstehen zu lassen und sie wird
dabei auch intuitiv-konstruktive Methoden nicht verschmähen können. Eine Sprach-
wissenschaft aber, die die so erfaßte Dichterindividualität zum Ausgangspunkte
ihrer Deutungen nimmt, ist um so abwegiger, je mehr sie die Individualität des
Autors selbst aus seinem sprachlichen Werke erschlossen, intuitiv erfaßt hat — die
reinste Form eines Fehlerkreises, worauf man nicht oft genug hinweisen kann.
Wien. Emil Winkler.
Theophil Spoerri, Präludium zur Poesie. Furche-Verlag G.m.b.H.,
Berlin, 1929. 333 S.
Ein philosophierender Geist, dem es gegeben ist, die Härte des Gedankens mit
der Schmiegsamkeit einfühlender Kunstauffassung zu versöhnen, der gleicherweise
Dichtung zu hören und zu ihr hin zu denken vermag, breitet hier seine begriffliche
Welt aus. In ihrem Zentrum stehen die Grundbegriffe: „Ruhe", „Bewegung" und
„Richtung". Bezeichnungen für drei seelische Urzustände, drei letzte Verständnis-
zentren für entscheidend verschiedene Dimensionen, in denen das Ich zur Ganz-
heit strebt. Diese Begriffe werden als Wegweiser zu den Grundformen des Daseins
aufgestellt, als Ausgangspunkte einer denkenden Bewegung vom Begrifflichen in
die Richtung des künstlerischen Geheimnisses. Weder abstrahierende Systematik
und Zusammenreihung historisch-philologischer Tatsachen noch bloße Vermittlung
künstlerischer Ergriffenheiten können nach Spoerris Meinung der Literaturwissen-
schaft weiterhelfen. Sie bedarf einer deutenden Haltung, die beide Methoden in eine
einzige Bewegung zum Objekt zusammenfaßt, wobei sie nur mit Kategorien arbeiten
kann, die aus ihrer Begrifflichkeit in letzte, reich erfüllte und charakteristische Di-
mensionen des Lebens weisen.
„Deutung" ist nach solcher Grundhaltung kein kausales Erklären irgendwelcher
Art, sondern ein spezifisches Verstehen. Als ein intuitiver Prozeß des Eindringens
erfaßt dieses Verstehen die organische Struktur der Dichtung — dieser unerklär-
lichen Frucht einer geistigen Formkraft, die aus der Einheit eines typischen Ur-
sprungs zur Erfüllung in einer typischen Ganzheit strebt. In fortschreitendem Su-
chen vom Einzelnen zur Ganzheit wird jede Deutung zuletzt ein typisierendes Ver-
stehen. Sie enthüllt immer eine der drei Erscheinungsformen des Ichs: das „Sta-
tische", das „Dynamische" oder das „Normative"; eine der drei Dimensionen, in
denen der Künstler seinen „Durchbruch zum Ganzen" möglich machen kann. —
Jede dieser drei typischen Haltungen hat ihr eigenes Weltbild. Jede dieser Durch-
bruchsformen des Ichs gibt das Bild eines besonderen Menschen. Der statische
Mensch ist der bürgerliche, dem alles als ruhendes Nebeneinander erscheint. Sein
Weltbild strebt nach Wissenschaftlichkeit. Am Grunde seines Wesens lebt die Angst
vor der Bewegung. — Dem dynamischen Menschen ist alles Bewegtheit. „Er erlebt
die Welt als ästhetisches Schauspiel." Seine Seele fühlt den Pulsschlag des Seelen-
lebens der ganzen Welt. — Der normative Mensch aber vereinigt Ruhe und Be-
wegung unter der Aufgabe einer frei gewählten Richtung. Die Bewegung wird ihm
zielvoll und die Ruhe Sünde. Er nimmt die Wirklichkeit ernst und sieht das Problem
des Bösen. — Diese dritte Dimension liegt auf anderer Ebene. Statisches und Dyna-
misches sind polar. Das Normative überwindet diese Polarität durch die Richtung
von innen, die Spoerri auch „aktive Identität" nennt. — Die dichterische Kunst spie-
gelt in ihren drei Gattungen diese drei Erscheinungsformen. Sie liefert die leben-