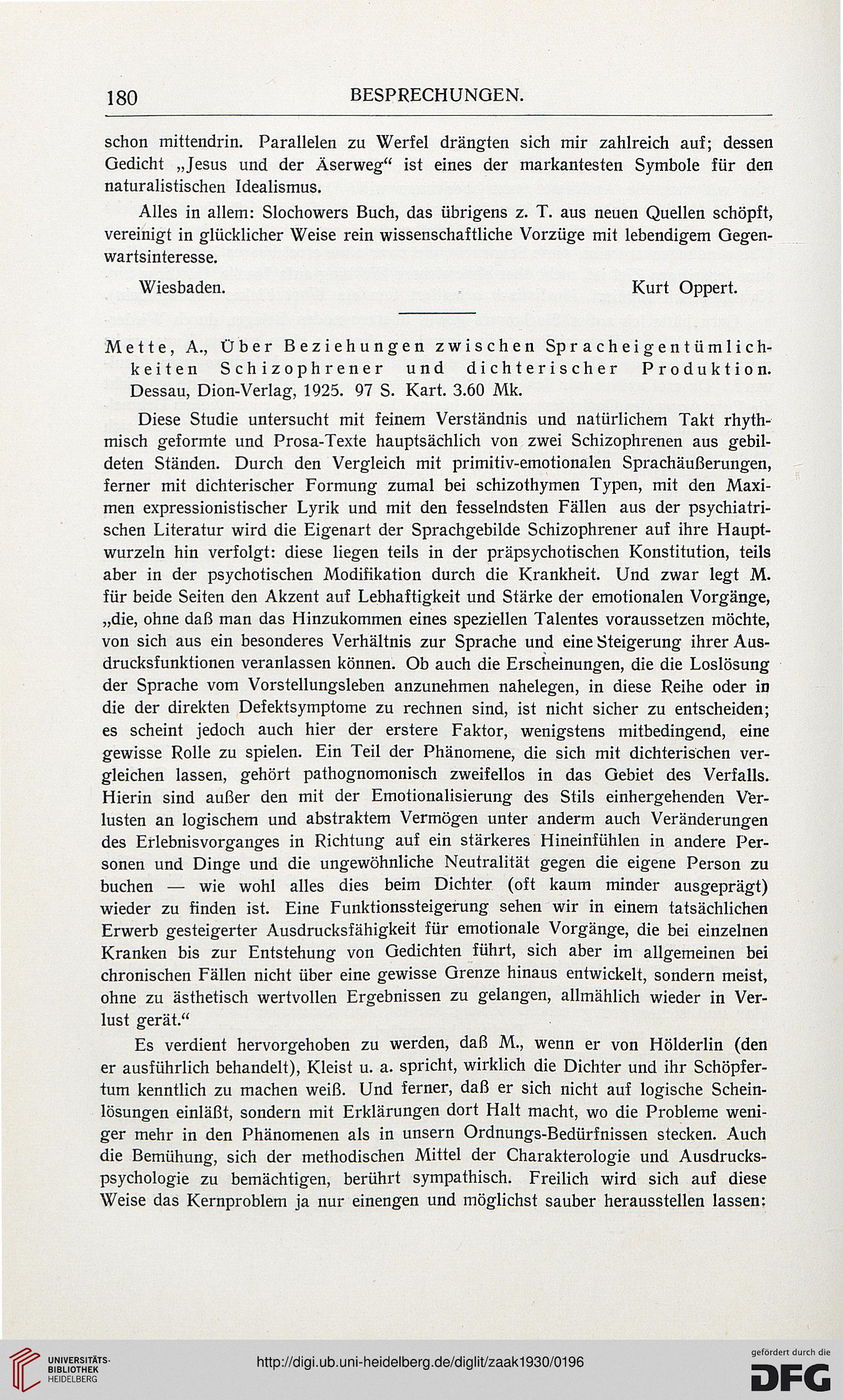180
BESPRECHUNGEN.
schon mittendrin. Parallelen zu Werfel drängten sich mir zahlreich auf; dessen
Gedicht „Jesus und der Äserweg" ist eines der markantesten Symbole für den
naturalistischen Idealismus.
Alles in allem: Slochowers Buch, das übrigens z. T. aus neuen Quellen schöpft,
vereinigt in glücklicher Weise rein wissenschaftliche Vorzüge mit lebendigem Gegen-
wartsinteresse.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Mette, A., Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlich-
keiten Schizophrener und dichterischer Produktion.
Dessau, Dion-Verlag, 1925. 97 S. Kart. 3.60 Mk.
Diese Studie untersucht mit feinem Verständnis und natürlichem Takt rhyth-
misch geformte und Prosa-Texte hauptsächlich von zwei Schizophrenen aus gebil-
deten Ständen. Durch den Vergleich mit primitiv-emotionalen Sprachäußerungen,
ferner mit dichterischer Formung zumal bei schizothymen Typen, mit den Maxi-
men expressionistischer Lyrik und mit den fesselndsten Fällen aus der psychiatri-
schen Literatur wird die Eigenart der Sprachgebilde Schizophrener auf ihre Haupt-
wurzeln hin verfolgt: diese liegen teils in der präpsychotischen Konstitution, teils
aber in der psychotischen Modifikation durch die Krankheit. Und zwar legt M.
für beide Seiten den Akzent auf Lebhaftigkeit und Stärke der emotionalen Vorgänge,
„die, ohne daß man das Hinzukommen eines speziellen Talentes voraussetzen möchte,
von sich aus ein besonderes Verhältnis zur Sprache und eine Steigerung ihrer Aus-
drucksfunktionen veranlassen können. Ob auch die Erscheinungen, die die Loslösung
der Sprache vom Vorstellungsleben anzunehmen nahelegen, in diese Reihe oder in
die der direkten Defektsymptome zu rechnen sind, ist nicht sicher zu entscheiden;
es scheint jedoch auch hier der erstere Faktor, wenigstens mitbedingend, eine
gewisse Rolle zu spielen. Ein Teil der Phänomene, die sich mit dichterischen ver-
gleichen lassen, gehört pathognomonisch zweifellos in das Gebiet des Verfalls.
Hierin sind außer den mit der Emotionalisierung des Stils einhergehenden Ver-
lusten an logischem und abstraktem Vermögen unter anderm auch Veränderungen
des Erlebnisvorganges in Richtung auf ein stärkeres Hineinfühlen in andere Per-
sonen und Dinge und die ungewöhnliche Neutralität gegen die eigene Person zu
buchen — wie wohl alles dies beim Dichter (oft kaum minder ausgeprägt)
wieder zu finden ist. Eine Funktionssteigerung sehen wir in einem tatsächlichen
Erwerb gesteigerter Ausdrucksfähigkeit für emotionale Vorgänge, die bei einzelnen
Kranken bis zur Entstehung von Gedichten führt, sich aber im allgemeinen bei
chronischen Fällen nicht über eine gewisse Grenze hinaus entwickelt, sondern meist,
ohne zu ästhetisch wertvollen Ergebnissen zu gelangen, allmählich wieder in Ver-
lust gerät."
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß M., wenn er von Hölderlin (den
er ausführlich behandelt), Kleist u. a. spricht, wirklich die Dichter und ihr Schöpfer-
tum kenntlich zu machen weiß. Und ferner, daß er sich nicht auf logische Schein-
lösungen einläßt, sondern mit Erklärungen dort Halt macht, wo die Probleme weni-
ger mehr in den Phänomenen als in unsern Ordnungs-Bedürfnissen stecken. Auch
die Bemühung, sich der methodischen Mittel der Charakterologie und Ausdrucks-
psychologie zu bemächtigen, berührt sympathisch. Freilich wird sich auf diese
Weise das Kernproblem ja nur einengen und möglichst sauber herausstellen lassen:
BESPRECHUNGEN.
schon mittendrin. Parallelen zu Werfel drängten sich mir zahlreich auf; dessen
Gedicht „Jesus und der Äserweg" ist eines der markantesten Symbole für den
naturalistischen Idealismus.
Alles in allem: Slochowers Buch, das übrigens z. T. aus neuen Quellen schöpft,
vereinigt in glücklicher Weise rein wissenschaftliche Vorzüge mit lebendigem Gegen-
wartsinteresse.
Wiesbaden. Kurt Oppert.
Mette, A., Über Beziehungen zwischen Spracheigentümlich-
keiten Schizophrener und dichterischer Produktion.
Dessau, Dion-Verlag, 1925. 97 S. Kart. 3.60 Mk.
Diese Studie untersucht mit feinem Verständnis und natürlichem Takt rhyth-
misch geformte und Prosa-Texte hauptsächlich von zwei Schizophrenen aus gebil-
deten Ständen. Durch den Vergleich mit primitiv-emotionalen Sprachäußerungen,
ferner mit dichterischer Formung zumal bei schizothymen Typen, mit den Maxi-
men expressionistischer Lyrik und mit den fesselndsten Fällen aus der psychiatri-
schen Literatur wird die Eigenart der Sprachgebilde Schizophrener auf ihre Haupt-
wurzeln hin verfolgt: diese liegen teils in der präpsychotischen Konstitution, teils
aber in der psychotischen Modifikation durch die Krankheit. Und zwar legt M.
für beide Seiten den Akzent auf Lebhaftigkeit und Stärke der emotionalen Vorgänge,
„die, ohne daß man das Hinzukommen eines speziellen Talentes voraussetzen möchte,
von sich aus ein besonderes Verhältnis zur Sprache und eine Steigerung ihrer Aus-
drucksfunktionen veranlassen können. Ob auch die Erscheinungen, die die Loslösung
der Sprache vom Vorstellungsleben anzunehmen nahelegen, in diese Reihe oder in
die der direkten Defektsymptome zu rechnen sind, ist nicht sicher zu entscheiden;
es scheint jedoch auch hier der erstere Faktor, wenigstens mitbedingend, eine
gewisse Rolle zu spielen. Ein Teil der Phänomene, die sich mit dichterischen ver-
gleichen lassen, gehört pathognomonisch zweifellos in das Gebiet des Verfalls.
Hierin sind außer den mit der Emotionalisierung des Stils einhergehenden Ver-
lusten an logischem und abstraktem Vermögen unter anderm auch Veränderungen
des Erlebnisvorganges in Richtung auf ein stärkeres Hineinfühlen in andere Per-
sonen und Dinge und die ungewöhnliche Neutralität gegen die eigene Person zu
buchen — wie wohl alles dies beim Dichter (oft kaum minder ausgeprägt)
wieder zu finden ist. Eine Funktionssteigerung sehen wir in einem tatsächlichen
Erwerb gesteigerter Ausdrucksfähigkeit für emotionale Vorgänge, die bei einzelnen
Kranken bis zur Entstehung von Gedichten führt, sich aber im allgemeinen bei
chronischen Fällen nicht über eine gewisse Grenze hinaus entwickelt, sondern meist,
ohne zu ästhetisch wertvollen Ergebnissen zu gelangen, allmählich wieder in Ver-
lust gerät."
Es verdient hervorgehoben zu werden, daß M., wenn er von Hölderlin (den
er ausführlich behandelt), Kleist u. a. spricht, wirklich die Dichter und ihr Schöpfer-
tum kenntlich zu machen weiß. Und ferner, daß er sich nicht auf logische Schein-
lösungen einläßt, sondern mit Erklärungen dort Halt macht, wo die Probleme weni-
ger mehr in den Phänomenen als in unsern Ordnungs-Bedürfnissen stecken. Auch
die Bemühung, sich der methodischen Mittel der Charakterologie und Ausdrucks-
psychologie zu bemächtigen, berührt sympathisch. Freilich wird sich auf diese
Weise das Kernproblem ja nur einengen und möglichst sauber herausstellen lassen: