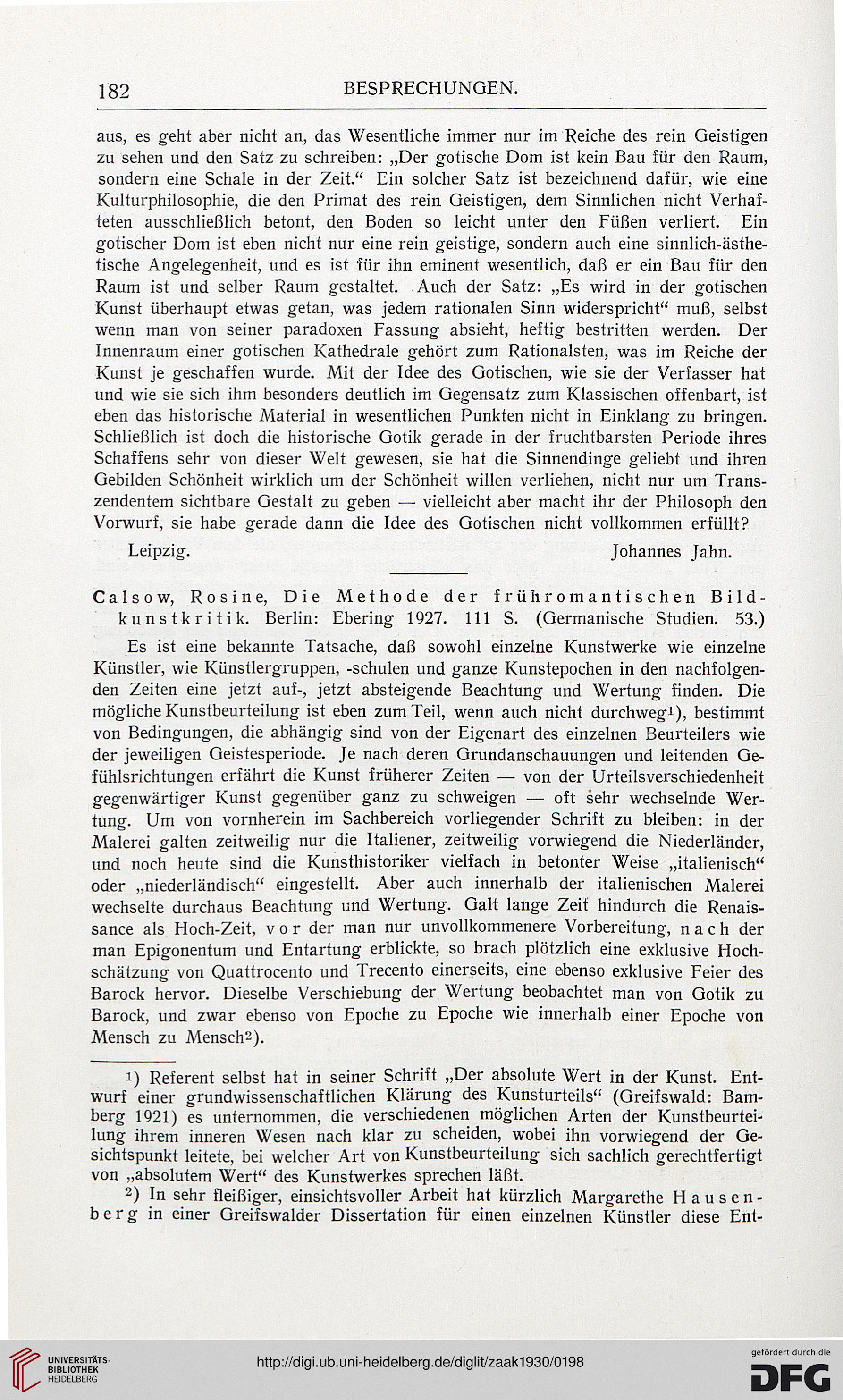182
BESPRECHUNGEN.
aus, es geht aber nicht an, das Wesentliche immer nur im Reiche des rein Geistigen
zu sehen und den Satz zu schreiben: „Der gotische Dom ist kein Bau für den Raum,
sondern eine Schale in der Zeit." Ein solcher Satz ist bezeichnend dafür, wie eine
Kulturphilosophie, die den Primat des rein Geistigen, dem Sinnlichen nicht Verhaf-
teten ausschließlich betont, den Boden so leicht unter den Füßen verliert. Ein
gotischer Dom ist eben nicht nur eine rein geistige, sondern auch eine sinnlich-ästhe-
tische Angelegenheit, und es ist für ihn eminent wesentlich, daß er ein Bau für den
Raum ist und selber Raum gestaltet. Auch der Satz: „Es wird in der gotischen
Kunst überhaupt etwas getan, was jedem rationalen Sinn widerspricht" muß, selbst
wenn man von seiner paradoxen Fassung absieht, heftig bestritten werden. Der
Innenraum einer gotischen Kathedrale gehört zum Rationalsten, was im Reiche der
Kunst je geschaffen wurde. Mit der Idee des Gotischen, wie sie der Verfasser hat
und wie sie sich ihm besonders deutlich im Gegensatz zum Klassischen offenbart, ist
eben das historische Material in wesentlichen Punkten nicht in Einklang zu bringen.
Schließlich ist doch die historische Gotik gerade in der fruchtbarsten Periode ihres
Schaffens sehr von dieser Welt gewesen, sie hat die Sinnendinge geliebt und ihren
Gebilden Schönheit wirklich um der Schönheit willen verliehen, nicht nur um Trans-
zendentem sichtbare Gestalt zu geben — vielleicht aber macht ihr der Philosoph den
Vorwurf, sie habe gerade dann die Idee des Gotischen nicht vollkommen erfüllt?
Leipzig. Johannes Jahn.
Calsow, Rosine, Die Methode der frühromantischen Bild-
kunstkritik. Berlin: Ebering 1927. 111 S. (Germanische Studien. 53.)
Es ist eine bekannte Tatsache, daß sowohl einzelne Kunstwerke wie einzelne
Künstler, wie Künstlergruppen, -schulen und ganze Kunstepochen in den nachfolgen-
den Zeiten eine jetzt auf-, jetzt absteigende Beachtung und Wertung finden. Die
mögliche Kunstbeurteilung ist eben zum Teil, wenn auch nicht durchweg1), bestimmt
von Bedingungen, die abhängig sind von der Eigenart des einzelnen Beurteilers wie
der jeweiligen Geistesperiode. Je nach deren Grundanschauungen und leitenden Ge-
fühlsrichtungen erfährt die Kunst früherer Zeiten — von der Urteilsverschiedenheit
gegenwärtiger Kunst gegenüber ganz zu schweigen — oft sehr wechselnde Wer-
tung. Um von vornherein im Sachbereich vorliegender Schrift zu bleiben: in der
Malerei galten zeitweilig nur die Italiener, zeitweilig vorwiegend die Niederländer,
und noch heute sind die Kunsthistoriker vielfach in betonter Weise „italienisch"
oder „niederländisch" eingestellt. Aber auch innerhalb der italienischen Malerei
wechselte durchaus Beachtung und Wertung. Galt lange Zeit hindurch die Renais-
sance als Hoch-Zeit, vor der man nur unvollkommenere Vorbereitung, nach der
man Epigonentum und Entartung erblickte, so brach plötzlich eine exklusive Hoch-
schätzung von Quattrocento und Trecento einerseits, eine ebenso exklusive Feier des
Barock hervor. Dieselbe Verschiebung der Wertung beobachtet man von Gotik zu
Barock, und zwar ebenso von Epoche zu Epoche wie innerhalb einer Epoche von
Mensch zu Mensch2).
1) Referent selbst hat in seiner Schrift „Der absolute Wert in der Kunst. Ent-
wurf einer grundwissenschaftlichen Klärung des Kunsturteils" (Greifswald: Bam-
berg 1921) es unternommen, die verschiedenen möglichen Arten der Kunstbeurtei-
lung ihrem inneren Wesen nach klar zu scheiden, wobei ihn vorwiegend der Ge-
sichtspunkt leitete, bei welcher Art von Kunstbeurteilung sich sachlich gerechtfertigt
von „absolutem Wert" des Kunstwerkes sprechen läßt.
2) In sehr fleißiger, einsichtsvoller Arbeit hat kürzlich Margarethe Hausen-
berg in einer Greifswalder Dissertation für einen einzelnen Künstler diese Ent-
BESPRECHUNGEN.
aus, es geht aber nicht an, das Wesentliche immer nur im Reiche des rein Geistigen
zu sehen und den Satz zu schreiben: „Der gotische Dom ist kein Bau für den Raum,
sondern eine Schale in der Zeit." Ein solcher Satz ist bezeichnend dafür, wie eine
Kulturphilosophie, die den Primat des rein Geistigen, dem Sinnlichen nicht Verhaf-
teten ausschließlich betont, den Boden so leicht unter den Füßen verliert. Ein
gotischer Dom ist eben nicht nur eine rein geistige, sondern auch eine sinnlich-ästhe-
tische Angelegenheit, und es ist für ihn eminent wesentlich, daß er ein Bau für den
Raum ist und selber Raum gestaltet. Auch der Satz: „Es wird in der gotischen
Kunst überhaupt etwas getan, was jedem rationalen Sinn widerspricht" muß, selbst
wenn man von seiner paradoxen Fassung absieht, heftig bestritten werden. Der
Innenraum einer gotischen Kathedrale gehört zum Rationalsten, was im Reiche der
Kunst je geschaffen wurde. Mit der Idee des Gotischen, wie sie der Verfasser hat
und wie sie sich ihm besonders deutlich im Gegensatz zum Klassischen offenbart, ist
eben das historische Material in wesentlichen Punkten nicht in Einklang zu bringen.
Schließlich ist doch die historische Gotik gerade in der fruchtbarsten Periode ihres
Schaffens sehr von dieser Welt gewesen, sie hat die Sinnendinge geliebt und ihren
Gebilden Schönheit wirklich um der Schönheit willen verliehen, nicht nur um Trans-
zendentem sichtbare Gestalt zu geben — vielleicht aber macht ihr der Philosoph den
Vorwurf, sie habe gerade dann die Idee des Gotischen nicht vollkommen erfüllt?
Leipzig. Johannes Jahn.
Calsow, Rosine, Die Methode der frühromantischen Bild-
kunstkritik. Berlin: Ebering 1927. 111 S. (Germanische Studien. 53.)
Es ist eine bekannte Tatsache, daß sowohl einzelne Kunstwerke wie einzelne
Künstler, wie Künstlergruppen, -schulen und ganze Kunstepochen in den nachfolgen-
den Zeiten eine jetzt auf-, jetzt absteigende Beachtung und Wertung finden. Die
mögliche Kunstbeurteilung ist eben zum Teil, wenn auch nicht durchweg1), bestimmt
von Bedingungen, die abhängig sind von der Eigenart des einzelnen Beurteilers wie
der jeweiligen Geistesperiode. Je nach deren Grundanschauungen und leitenden Ge-
fühlsrichtungen erfährt die Kunst früherer Zeiten — von der Urteilsverschiedenheit
gegenwärtiger Kunst gegenüber ganz zu schweigen — oft sehr wechselnde Wer-
tung. Um von vornherein im Sachbereich vorliegender Schrift zu bleiben: in der
Malerei galten zeitweilig nur die Italiener, zeitweilig vorwiegend die Niederländer,
und noch heute sind die Kunsthistoriker vielfach in betonter Weise „italienisch"
oder „niederländisch" eingestellt. Aber auch innerhalb der italienischen Malerei
wechselte durchaus Beachtung und Wertung. Galt lange Zeit hindurch die Renais-
sance als Hoch-Zeit, vor der man nur unvollkommenere Vorbereitung, nach der
man Epigonentum und Entartung erblickte, so brach plötzlich eine exklusive Hoch-
schätzung von Quattrocento und Trecento einerseits, eine ebenso exklusive Feier des
Barock hervor. Dieselbe Verschiebung der Wertung beobachtet man von Gotik zu
Barock, und zwar ebenso von Epoche zu Epoche wie innerhalb einer Epoche von
Mensch zu Mensch2).
1) Referent selbst hat in seiner Schrift „Der absolute Wert in der Kunst. Ent-
wurf einer grundwissenschaftlichen Klärung des Kunsturteils" (Greifswald: Bam-
berg 1921) es unternommen, die verschiedenen möglichen Arten der Kunstbeurtei-
lung ihrem inneren Wesen nach klar zu scheiden, wobei ihn vorwiegend der Ge-
sichtspunkt leitete, bei welcher Art von Kunstbeurteilung sich sachlich gerechtfertigt
von „absolutem Wert" des Kunstwerkes sprechen läßt.
2) In sehr fleißiger, einsichtsvoller Arbeit hat kürzlich Margarethe Hausen-
berg in einer Greifswalder Dissertation für einen einzelnen Künstler diese Ent-