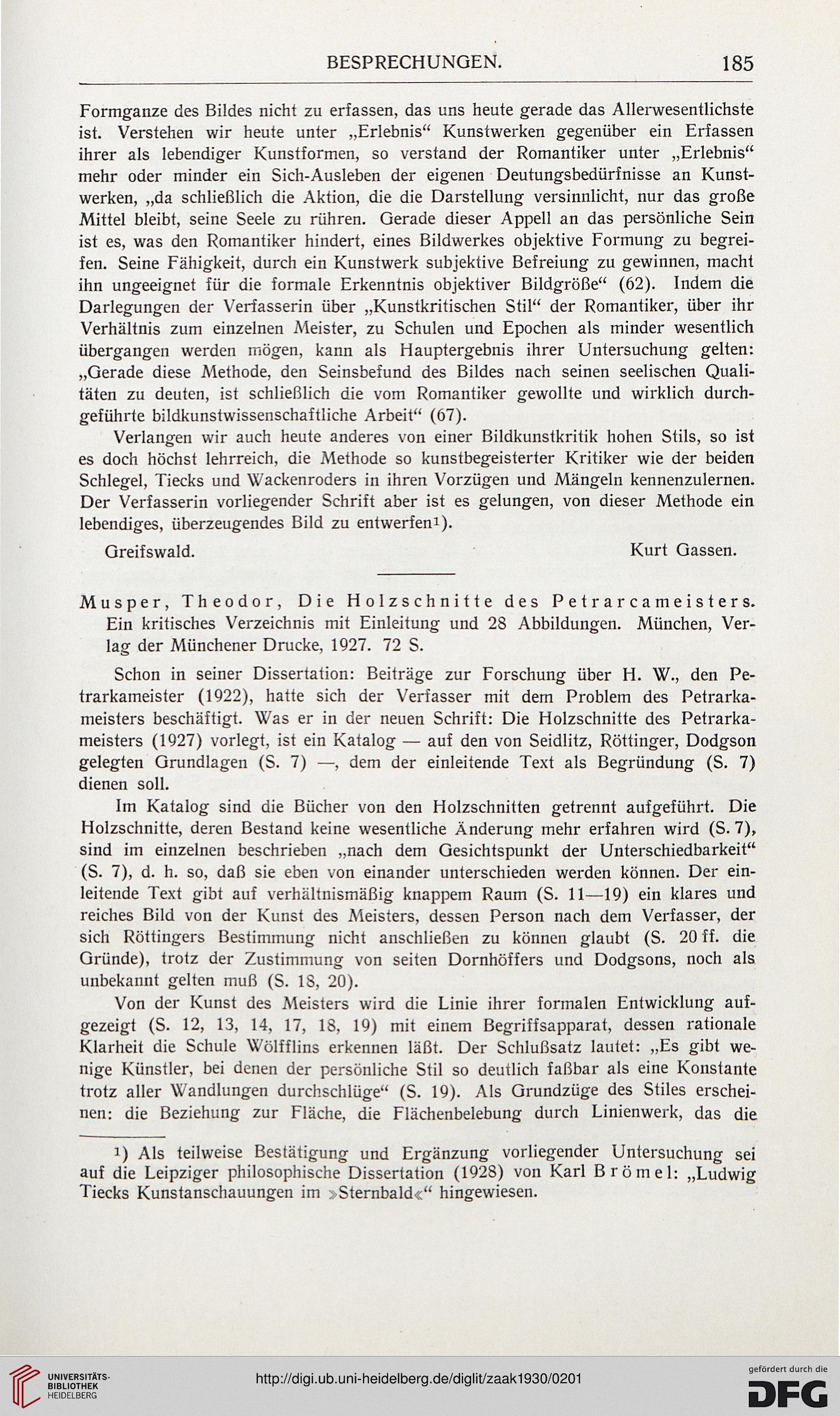BESPRECHUNGEN.
185
Formganze des Bildes nicht zu erfassen, das uns heute gerade das Allerwesentlichste
ist. Verstehen wir heute unter „Erlebnis" Kunstwerken gegenüber ein Erfassen
ihrer als lebendiger Kunstformen, so verstand der Romantiker unter „Erlebnis"
mehr oder minder ein Sich-Ausleben der eigenen Deutungsbedürfnisse an Kunst-
werken, „da schließlich die Aktion, die die Darstellung versinnlicht, nur das große
Mittel bleibt, seine Seele zu rühren. Gerade dieser Appell an das persönliche Sein
ist es, was den Romantiker hindert, eines Bildwerkes objektive Formung zu begrei-
fen. Seine Fähigkeit, durch ein Kunstwerk subjektive Befreiung zu gewinnen, macht
ihn ungeeignet für die formale Erkenntnis objektiver Bildgröße" (62). Indem die
Darlegungen der Verfasserin über „Kunstkritischen Stil" der Romantiker, über ihr
Verhältnis zum einzelnen Meister, zu Schulen und Epochen als minder wesentlich
übergangen werden mögen, kann als Hauptergebnis ihrer Untersuchung gelten:
„Gerade diese Methode, den Seinsbefund des Bildes nach seinen seelischen Quali-
täten zu deuten, ist schließlich die vom Romantiker gewollte und wirklich durch-
geführte bildkunstwissenschaftliche Arbeit" (67).
Verlangen wir auch heute anderes von einer Bildkunstkritik hohen Stils, so ist
es doch höchst lehrreich, die Methode so kunstbegeisterter Kritiker wie der beiden
Schlegel, Tiecks und Wackenroders in ihren Vorzügen und Mängeln kennenzulernen.
Der Verfasserin vorliegender Schrift aber ist es gelungen, von dieser Methode ein
lebendiges, überzeugendes Bild zu entwerfeni).
Greifswald. Kurt Gassen.
Musper, Theodor, Die Holzschnitte des Petrarcameisters.
Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen. München, Ver-
lag der Münchener Drucke, 1927. 72 S.
Schon in seiner Dissertation: Beiträge zur Forschung über H. W., den Pe-
trarkameister (1922), hatte sich der Verfasser mit dem Problem des Petrarka-
meisters beschäftigt. Was er in der neuen Schrift: Die Holzschnitte des Petrarka-
meisters (1927) vorlegt, ist ein Katalog — auf den von Seidlitz, Röttinger, Dodgson
gelegten Grundlagen (S. 7) —, dem der einleitende Text als Begründung (S. 7)
dienen soll.
Im Katalog sind die Bücher von den Holzschnitten getrennt aufgeführt. Die
Holzschnitte, deren Bestand keine wesentliche Änderung mehr erfahren wird (S. 7),
sind im einzelnen beschrieben „nach dem Gesichtspunkt der Unterschiedbarkeit"
(S. 7), d. h. so, daß sie eben von einander unterschieden werden können. Der ein-
leitende Text gibt auf verhältnismäßig knappem Raum (S. 11—19) ein klares und
reiches Bild von der Kunst des Meisters, dessen Person nach dem Verfasser, der
sich Röttingers Bestimmung nicht anschließen zu können glaubt (S. 20 ff. die
Gründe), trotz der Zustimmung von Seiten Dornhöffers und Dodgsons, noch als
unbekannt gelten muß (S. 18, 20).
Von der Kunst des Meisters wird die Linie ihrer formalen Entwicklung auf-
gezeigt (S. 12, 13, 14, 17, 18, 19) mit einem Begriffsapparat, dessen rationale
Klarheit die Schule Wölfflins erkennen läßt. Der Schlußsatz lautet: „Es gibt we-
nige Künstler, bei denen der persönliche Stil so deutlich faßbar als eine Konstante
trotz aller Wandlungen durchschlüge" (S. 19). Als Grundzüge des Stiles erschei-
nen: die Beziehung zur Fläche, die Flächenbelebung durch Linienwerk, das die
!) Als teilweise Bestätigung und Ergänzung vorliegender Untersuchung sei
auf die Leipziger philosophische Dissertation (1928) von Karl Brömel: „Ludwig
Tiecks Kunstanschauungen im ;>Sternbald«" hingewiesen.
185
Formganze des Bildes nicht zu erfassen, das uns heute gerade das Allerwesentlichste
ist. Verstehen wir heute unter „Erlebnis" Kunstwerken gegenüber ein Erfassen
ihrer als lebendiger Kunstformen, so verstand der Romantiker unter „Erlebnis"
mehr oder minder ein Sich-Ausleben der eigenen Deutungsbedürfnisse an Kunst-
werken, „da schließlich die Aktion, die die Darstellung versinnlicht, nur das große
Mittel bleibt, seine Seele zu rühren. Gerade dieser Appell an das persönliche Sein
ist es, was den Romantiker hindert, eines Bildwerkes objektive Formung zu begrei-
fen. Seine Fähigkeit, durch ein Kunstwerk subjektive Befreiung zu gewinnen, macht
ihn ungeeignet für die formale Erkenntnis objektiver Bildgröße" (62). Indem die
Darlegungen der Verfasserin über „Kunstkritischen Stil" der Romantiker, über ihr
Verhältnis zum einzelnen Meister, zu Schulen und Epochen als minder wesentlich
übergangen werden mögen, kann als Hauptergebnis ihrer Untersuchung gelten:
„Gerade diese Methode, den Seinsbefund des Bildes nach seinen seelischen Quali-
täten zu deuten, ist schließlich die vom Romantiker gewollte und wirklich durch-
geführte bildkunstwissenschaftliche Arbeit" (67).
Verlangen wir auch heute anderes von einer Bildkunstkritik hohen Stils, so ist
es doch höchst lehrreich, die Methode so kunstbegeisterter Kritiker wie der beiden
Schlegel, Tiecks und Wackenroders in ihren Vorzügen und Mängeln kennenzulernen.
Der Verfasserin vorliegender Schrift aber ist es gelungen, von dieser Methode ein
lebendiges, überzeugendes Bild zu entwerfeni).
Greifswald. Kurt Gassen.
Musper, Theodor, Die Holzschnitte des Petrarcameisters.
Ein kritisches Verzeichnis mit Einleitung und 28 Abbildungen. München, Ver-
lag der Münchener Drucke, 1927. 72 S.
Schon in seiner Dissertation: Beiträge zur Forschung über H. W., den Pe-
trarkameister (1922), hatte sich der Verfasser mit dem Problem des Petrarka-
meisters beschäftigt. Was er in der neuen Schrift: Die Holzschnitte des Petrarka-
meisters (1927) vorlegt, ist ein Katalog — auf den von Seidlitz, Röttinger, Dodgson
gelegten Grundlagen (S. 7) —, dem der einleitende Text als Begründung (S. 7)
dienen soll.
Im Katalog sind die Bücher von den Holzschnitten getrennt aufgeführt. Die
Holzschnitte, deren Bestand keine wesentliche Änderung mehr erfahren wird (S. 7),
sind im einzelnen beschrieben „nach dem Gesichtspunkt der Unterschiedbarkeit"
(S. 7), d. h. so, daß sie eben von einander unterschieden werden können. Der ein-
leitende Text gibt auf verhältnismäßig knappem Raum (S. 11—19) ein klares und
reiches Bild von der Kunst des Meisters, dessen Person nach dem Verfasser, der
sich Röttingers Bestimmung nicht anschließen zu können glaubt (S. 20 ff. die
Gründe), trotz der Zustimmung von Seiten Dornhöffers und Dodgsons, noch als
unbekannt gelten muß (S. 18, 20).
Von der Kunst des Meisters wird die Linie ihrer formalen Entwicklung auf-
gezeigt (S. 12, 13, 14, 17, 18, 19) mit einem Begriffsapparat, dessen rationale
Klarheit die Schule Wölfflins erkennen läßt. Der Schlußsatz lautet: „Es gibt we-
nige Künstler, bei denen der persönliche Stil so deutlich faßbar als eine Konstante
trotz aller Wandlungen durchschlüge" (S. 19). Als Grundzüge des Stiles erschei-
nen: die Beziehung zur Fläche, die Flächenbelebung durch Linienwerk, das die
!) Als teilweise Bestätigung und Ergänzung vorliegender Untersuchung sei
auf die Leipziger philosophische Dissertation (1928) von Karl Brömel: „Ludwig
Tiecks Kunstanschauungen im ;>Sternbald«" hingewiesen.