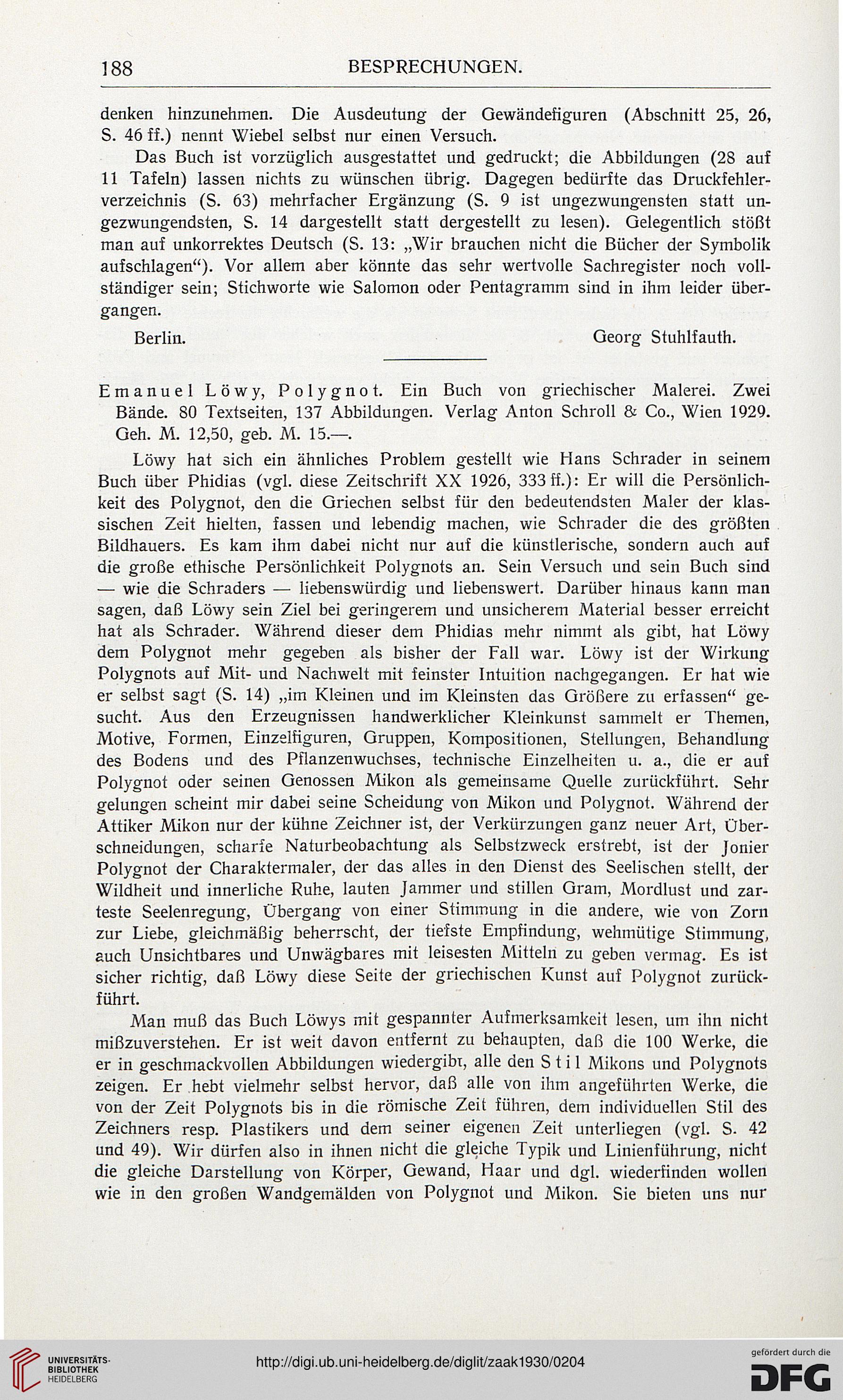188
BESPRECHUNGEN.
denken hinzunehmen. Die Ausdeutung der Gewändefiguren (Abschnitt 25, 26,
S. 46 ff.) nennt Wiebel selbst nur einen Versuch.
Das Buch ist vorzüglich ausgestattet und gedruckt; die Abbildungen (28 auf
11 Tafeln) lassen nichts zu wünschen übrig. Dagegen bedürfte das Druckfehler-
verzeichnis (S. 63) mehrfacher Ergänzung (S. 9 ist ungezwungensten statt un-
gezwungendsten, S. 14 dargestellt statt dergestellt zu lesen). Gelegentlich stößt
man auf unkorrektes Deutsch (S. 13: „Wir brauchen nicht die Bücher der Symbolik
aufschlagen"). Vor allem aber könnte das sehr wertvolle Sachregister noch voll-
ständiger sein; Stichworte wie Salomon oder Pentagramm sind in ihm leider über-
gangen.
Berlin. Georg Stuhlfauth.
Emanuel Löwy, Polygnot. Ein Buch von griechischer Malerei. Zwei
Bände. 80 Textseiten, 137 Abbildungen. Verlag Anton Schroll & Co., Wien 1929.
Geh. M. 12,50, geb. M. 15.—.
Löwy hat sich ein ähnliches Problem gestellt wie Hans Schräder in seinem
Buch über Phidias (vgl. diese Zeitschrift XX 1926, 333 ff.): Er will die Persönlich-
keit des Polygnot, den die Griechen selbst für den bedeutendsten Maler der klas-
sischen Zeit hielten, fassen und lebendig machen, wie Schräder die des größten
Bildhauers. Es kam ihm dabei nicht nur auf die künstlerische, sondern auch auf
die große ethische Persönlichkeit Polygnots an. Sein Versuch und sein Buch sind
— wie die Schräders — liebenswürdig und liebenswert. Darüber hinaus kann man
sagen, daß Löwy sein Ziel bei geringerem und unsicherem Material besser erreicht
hat als Schräder. Während dieser dem Phidias mehr nimmt als gibt, hat Löwy
dem Polygnot mehr gegeben als bisher der Fall war. Löwy ist der Wirkung
Polygnots auf Mit- und Nachwelt mit feinster Intuition nachgegangen. Er hat wie
er selbst sagt (S. 14) „im Kleinen und im Kleinsten das Größere zu erfassen" ge-
sucht. Aus den Erzeugnissen handwerklicher Kleinkunst sammelt er Themen,
Motive, Formen, Einzelfiguren, Gruppen, Kompositionen, Stellungen, Behandlung
des Bodens und des Pflanzenwuchses, technische Einzelheiten u. a., die er auf
Polygnot oder seinen Genossen Mikon als gemeinsame Quelle zurückführt. Sehr
gelungen scheint mir dabei seine Scheidung von Mikon und Polygnot. Während der
Attiker Mikon nur der kühne Zeichner ist, der Verkürzungen ganz neuer Art, Über-
schneidungen, scharfe Naturbeobachtung als Selbstzweck erstrebt, ist der Jonier
Polygnot der Charaktermaler, der das alles in den Dienst des Seelischen stellt, der
Wildheit und innerliche Ruhe, lauten Jammer und stillen Gram, Mordlust und zar-
teste Seelenregung, Übergang von einer Stimmung in die andere, wie von Zorn
zur Liebe, gleichmäßig beherrscht, der tiefste Empfindung, wehmütige Stimmung,
auch Unsichtbares und Unwägbares mit leisesten Mitteln zu geben vermag. Es ist
sicher richtig, daß Löwy diese Seite der griechischen Kunst auf Polygnot zurück-
führt.
Man muß das Buch Löwys mit gespannter Aufmerksamkeit lesen, um ihn nicht
mißzuverstehen. Er ist weit davon entfernt zu behaupten, daß die 100 Werke, die
er in geschmackvollen Abbildungen wiedergibt, alle den Stil Mikons und Polygnots
zeigen. Er hebt vielmehr selbst hervor, daß alle von ihm angeführten Werke, die
von der Zeit Polygnots bis in die römische Zeit führen, dem individuellen Stil des
Zeichners resp. Plastikers und dem seiner eigenen Zeit unterliegen (vgl. S- 42
und 49). Wir dürfen also in ihnen nicht die gleiche Typik und Linienführung, nicht
die gleiche Darstellung von Körper, Gewand, Haar und dgl. wiederfinden wollen
wie in den großen Wandgemälden von Polygnot und Mikon. Sie bieten uns nur
BESPRECHUNGEN.
denken hinzunehmen. Die Ausdeutung der Gewändefiguren (Abschnitt 25, 26,
S. 46 ff.) nennt Wiebel selbst nur einen Versuch.
Das Buch ist vorzüglich ausgestattet und gedruckt; die Abbildungen (28 auf
11 Tafeln) lassen nichts zu wünschen übrig. Dagegen bedürfte das Druckfehler-
verzeichnis (S. 63) mehrfacher Ergänzung (S. 9 ist ungezwungensten statt un-
gezwungendsten, S. 14 dargestellt statt dergestellt zu lesen). Gelegentlich stößt
man auf unkorrektes Deutsch (S. 13: „Wir brauchen nicht die Bücher der Symbolik
aufschlagen"). Vor allem aber könnte das sehr wertvolle Sachregister noch voll-
ständiger sein; Stichworte wie Salomon oder Pentagramm sind in ihm leider über-
gangen.
Berlin. Georg Stuhlfauth.
Emanuel Löwy, Polygnot. Ein Buch von griechischer Malerei. Zwei
Bände. 80 Textseiten, 137 Abbildungen. Verlag Anton Schroll & Co., Wien 1929.
Geh. M. 12,50, geb. M. 15.—.
Löwy hat sich ein ähnliches Problem gestellt wie Hans Schräder in seinem
Buch über Phidias (vgl. diese Zeitschrift XX 1926, 333 ff.): Er will die Persönlich-
keit des Polygnot, den die Griechen selbst für den bedeutendsten Maler der klas-
sischen Zeit hielten, fassen und lebendig machen, wie Schräder die des größten
Bildhauers. Es kam ihm dabei nicht nur auf die künstlerische, sondern auch auf
die große ethische Persönlichkeit Polygnots an. Sein Versuch und sein Buch sind
— wie die Schräders — liebenswürdig und liebenswert. Darüber hinaus kann man
sagen, daß Löwy sein Ziel bei geringerem und unsicherem Material besser erreicht
hat als Schräder. Während dieser dem Phidias mehr nimmt als gibt, hat Löwy
dem Polygnot mehr gegeben als bisher der Fall war. Löwy ist der Wirkung
Polygnots auf Mit- und Nachwelt mit feinster Intuition nachgegangen. Er hat wie
er selbst sagt (S. 14) „im Kleinen und im Kleinsten das Größere zu erfassen" ge-
sucht. Aus den Erzeugnissen handwerklicher Kleinkunst sammelt er Themen,
Motive, Formen, Einzelfiguren, Gruppen, Kompositionen, Stellungen, Behandlung
des Bodens und des Pflanzenwuchses, technische Einzelheiten u. a., die er auf
Polygnot oder seinen Genossen Mikon als gemeinsame Quelle zurückführt. Sehr
gelungen scheint mir dabei seine Scheidung von Mikon und Polygnot. Während der
Attiker Mikon nur der kühne Zeichner ist, der Verkürzungen ganz neuer Art, Über-
schneidungen, scharfe Naturbeobachtung als Selbstzweck erstrebt, ist der Jonier
Polygnot der Charaktermaler, der das alles in den Dienst des Seelischen stellt, der
Wildheit und innerliche Ruhe, lauten Jammer und stillen Gram, Mordlust und zar-
teste Seelenregung, Übergang von einer Stimmung in die andere, wie von Zorn
zur Liebe, gleichmäßig beherrscht, der tiefste Empfindung, wehmütige Stimmung,
auch Unsichtbares und Unwägbares mit leisesten Mitteln zu geben vermag. Es ist
sicher richtig, daß Löwy diese Seite der griechischen Kunst auf Polygnot zurück-
führt.
Man muß das Buch Löwys mit gespannter Aufmerksamkeit lesen, um ihn nicht
mißzuverstehen. Er ist weit davon entfernt zu behaupten, daß die 100 Werke, die
er in geschmackvollen Abbildungen wiedergibt, alle den Stil Mikons und Polygnots
zeigen. Er hebt vielmehr selbst hervor, daß alle von ihm angeführten Werke, die
von der Zeit Polygnots bis in die römische Zeit führen, dem individuellen Stil des
Zeichners resp. Plastikers und dem seiner eigenen Zeit unterliegen (vgl. S- 42
und 49). Wir dürfen also in ihnen nicht die gleiche Typik und Linienführung, nicht
die gleiche Darstellung von Körper, Gewand, Haar und dgl. wiederfinden wollen
wie in den großen Wandgemälden von Polygnot und Mikon. Sie bieten uns nur