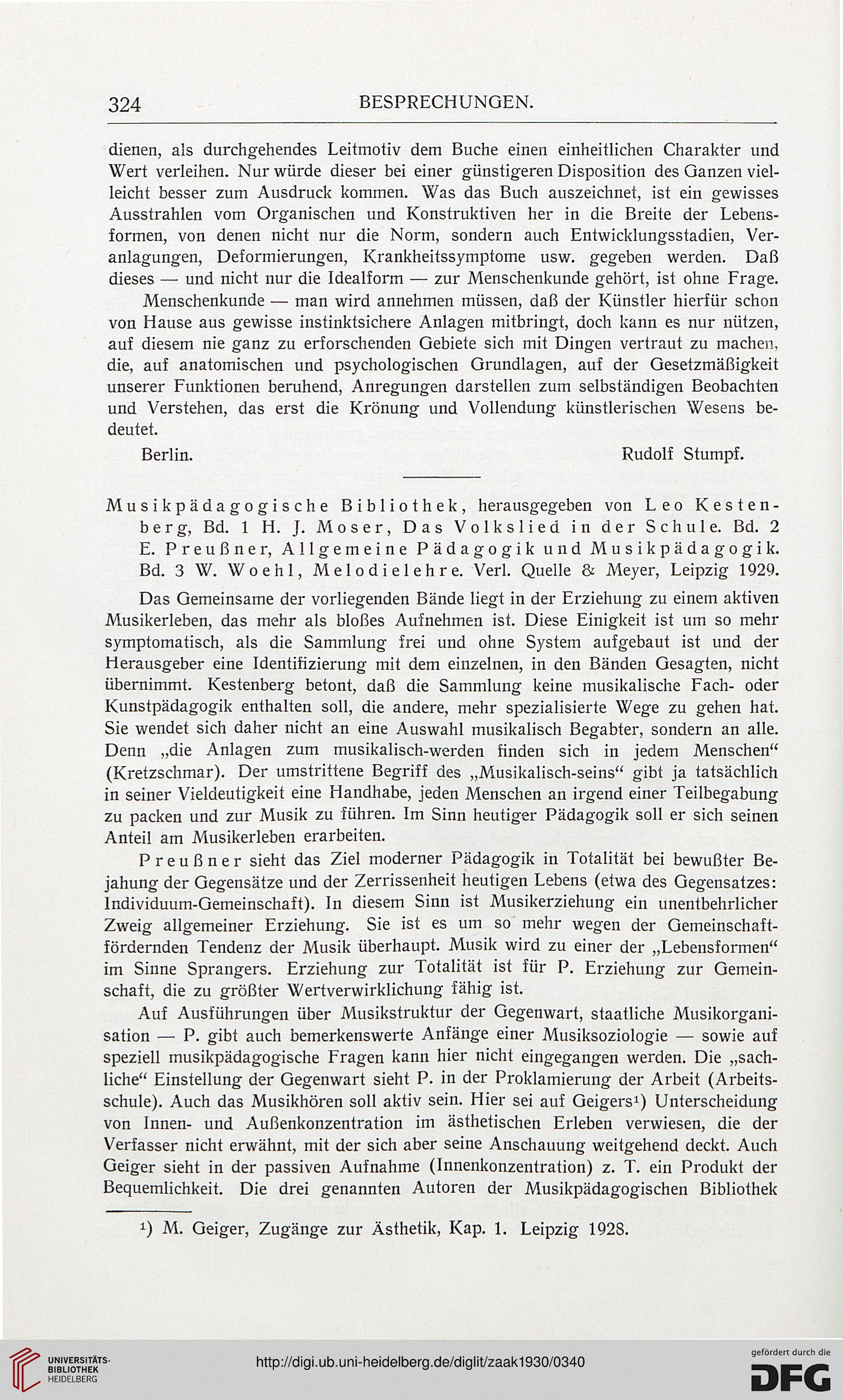324
BESPRECHUNGEN.
dienen, als durchgehendes Leitmotiv dem Buche einen einheitlichen Charakter und
Wert verleihen. Nur würde dieser bei einer günstigeren Disposition des Ganzen viel-
leicht besser zum Ausdruck kommen. Was das Buch auszeichnet, ist ein gewisses
Ausstrahlen vom Organischen und Konstruktiven her in die Breite der Lebens-
formen, von denen nicht nur die Norm, sondern auch Entwicklungsstadien, Ver-
anlagungen, Deformierungen, Krankheitssymptome usw. gegeben werden. Daß
dieses — und nicht nur die Idealform — zur Menschenkunde gehört, ist ohne Frage.
Menschenkunde — man wird annehmen müssen, daß der Künstler hierfür schon
von Hause aus gewisse instinktsichere Anlagen mitbringt, doch kann es nur nützen,
auf diesem nie ganz zu erforschenden Gebiete sich mit Dingen vertraut zu machen,
die, auf anatomischen und psychologischen Grundlagen, auf der Gesetzmäßigkeit
unserer Funktionen beruhend, Anregungen darstellen zum selbständigen Beobachten
und Verstehen, das erst die Krönung und Vollendung künstlerischen Wesens be-
deutet.
Berlin. Rudolf Stumpf.
Musikpädagogische Bibliothek, herausgegeben von Leo Kesten-
berg, Bd. 1 H. J. Moser, Das Volkslied in der Schule. Bd. 2
E. Preußner, Allgemeine Pädagogik und Musikpädagogik.
Bd. 3 W. Woehl, Melodielehre. Verl. Quelle & Meyer, Leipzig 1920.
Das Gemeinsame der vorliegenden Bände liegt in der Erziehung zu einem aktiven
Musikerleben, das mehr als bloßes Aufnehmen ist. Diese Einigkeit ist um so mehr
symptomatisch, als die Sammlung frei und ohne System aufgebaut ist und der
Herausgeber eine Identifizierung mit dem einzelnen, in den Bänden Gesagten, nicht
übernimmt. Kestenberg betont, daß die Sammlung keine musikalische Fach- oder
Kunstpädagogik enthalten soll, die andere, mehr spezialisierte Wege zu gehen hat.
Sie wendet sich daher nicht an eine Auswahl musikalisch Begabter, sondern an alle.
Denn „die Anlagen zum musikalisch-werden finden sich in jedem Menschen"
(Kretzschmar). Der umstrittene Begriff des „Musikalisch-seins" gibt ja tatsächlich
in seiner Vieldeutigkeit eine Handhabe, jeden Menschen an irgend einer Teilbegabung
zu packen und zur Musik zu führen. Im Sinn heutiger Pädagogik soll er sich seinen
Anteil am Musikerleben erarbeiten.
Preußner sieht das Ziel moderner Pädagogik in Totalität bei bewußter Be-
jahung der Gegensätze und der Zerrissenheit heutigen Lebens (etwa des Gegensatzes:
Individuum-Gemeinschaft). In diesem Sinn ist Musikerziehung ein unentbehrlicher
Zweig allgemeiner Erziehung. Sie ist es um so mehr wegen der Gemeinschaft-
fördernden Tendenz der Musik überhaupt. Musik wird zu einer der „Lebensformen"
im Sinne Sprangers. Erziehung zur Totalität ist für P. Erziehung zur Gemein-
schaft, die zu größter Wertverwirklichung fähig ist.
Auf Ausführungen über Musikstruktur der Gegenwart, staatliche Musikorgani-
sation — P. gibt auch bemerkenswerte Anfänge einer Musiksoziologie — sowie auf
speziell musikpädagogische Fragen kann hier nicht eingegangen werden. Die „sach-
liche" Einstellung der Gegenwart sieht P. in der Proklamierung der Arbeit (Arbeits-
schule). Auch das Musikhören soll aktiv sein. Hier sei auf Geigers1) Unterscheidung
von Innen- und Außenkonzentration im ästhetischen Erleben verwiesen, die der
Verfasser nicht erwähnt, mit der sich aber seine Anschauung weitgehend deckt. Auch
Geiger sieht in der passiven Aufnahme (Innenkonzentration) z. T. ein Produkt der
Bequemlichkeit. Die drei genannten Autoren der Musikpädagogischen Bibliothek
1) M. Geiger, Zugänge zur Ästhetik, Kap. 1. Leipzig 1928.
BESPRECHUNGEN.
dienen, als durchgehendes Leitmotiv dem Buche einen einheitlichen Charakter und
Wert verleihen. Nur würde dieser bei einer günstigeren Disposition des Ganzen viel-
leicht besser zum Ausdruck kommen. Was das Buch auszeichnet, ist ein gewisses
Ausstrahlen vom Organischen und Konstruktiven her in die Breite der Lebens-
formen, von denen nicht nur die Norm, sondern auch Entwicklungsstadien, Ver-
anlagungen, Deformierungen, Krankheitssymptome usw. gegeben werden. Daß
dieses — und nicht nur die Idealform — zur Menschenkunde gehört, ist ohne Frage.
Menschenkunde — man wird annehmen müssen, daß der Künstler hierfür schon
von Hause aus gewisse instinktsichere Anlagen mitbringt, doch kann es nur nützen,
auf diesem nie ganz zu erforschenden Gebiete sich mit Dingen vertraut zu machen,
die, auf anatomischen und psychologischen Grundlagen, auf der Gesetzmäßigkeit
unserer Funktionen beruhend, Anregungen darstellen zum selbständigen Beobachten
und Verstehen, das erst die Krönung und Vollendung künstlerischen Wesens be-
deutet.
Berlin. Rudolf Stumpf.
Musikpädagogische Bibliothek, herausgegeben von Leo Kesten-
berg, Bd. 1 H. J. Moser, Das Volkslied in der Schule. Bd. 2
E. Preußner, Allgemeine Pädagogik und Musikpädagogik.
Bd. 3 W. Woehl, Melodielehre. Verl. Quelle & Meyer, Leipzig 1920.
Das Gemeinsame der vorliegenden Bände liegt in der Erziehung zu einem aktiven
Musikerleben, das mehr als bloßes Aufnehmen ist. Diese Einigkeit ist um so mehr
symptomatisch, als die Sammlung frei und ohne System aufgebaut ist und der
Herausgeber eine Identifizierung mit dem einzelnen, in den Bänden Gesagten, nicht
übernimmt. Kestenberg betont, daß die Sammlung keine musikalische Fach- oder
Kunstpädagogik enthalten soll, die andere, mehr spezialisierte Wege zu gehen hat.
Sie wendet sich daher nicht an eine Auswahl musikalisch Begabter, sondern an alle.
Denn „die Anlagen zum musikalisch-werden finden sich in jedem Menschen"
(Kretzschmar). Der umstrittene Begriff des „Musikalisch-seins" gibt ja tatsächlich
in seiner Vieldeutigkeit eine Handhabe, jeden Menschen an irgend einer Teilbegabung
zu packen und zur Musik zu führen. Im Sinn heutiger Pädagogik soll er sich seinen
Anteil am Musikerleben erarbeiten.
Preußner sieht das Ziel moderner Pädagogik in Totalität bei bewußter Be-
jahung der Gegensätze und der Zerrissenheit heutigen Lebens (etwa des Gegensatzes:
Individuum-Gemeinschaft). In diesem Sinn ist Musikerziehung ein unentbehrlicher
Zweig allgemeiner Erziehung. Sie ist es um so mehr wegen der Gemeinschaft-
fördernden Tendenz der Musik überhaupt. Musik wird zu einer der „Lebensformen"
im Sinne Sprangers. Erziehung zur Totalität ist für P. Erziehung zur Gemein-
schaft, die zu größter Wertverwirklichung fähig ist.
Auf Ausführungen über Musikstruktur der Gegenwart, staatliche Musikorgani-
sation — P. gibt auch bemerkenswerte Anfänge einer Musiksoziologie — sowie auf
speziell musikpädagogische Fragen kann hier nicht eingegangen werden. Die „sach-
liche" Einstellung der Gegenwart sieht P. in der Proklamierung der Arbeit (Arbeits-
schule). Auch das Musikhören soll aktiv sein. Hier sei auf Geigers1) Unterscheidung
von Innen- und Außenkonzentration im ästhetischen Erleben verwiesen, die der
Verfasser nicht erwähnt, mit der sich aber seine Anschauung weitgehend deckt. Auch
Geiger sieht in der passiven Aufnahme (Innenkonzentration) z. T. ein Produkt der
Bequemlichkeit. Die drei genannten Autoren der Musikpädagogischen Bibliothek
1) M. Geiger, Zugänge zur Ästhetik, Kap. 1. Leipzig 1928.