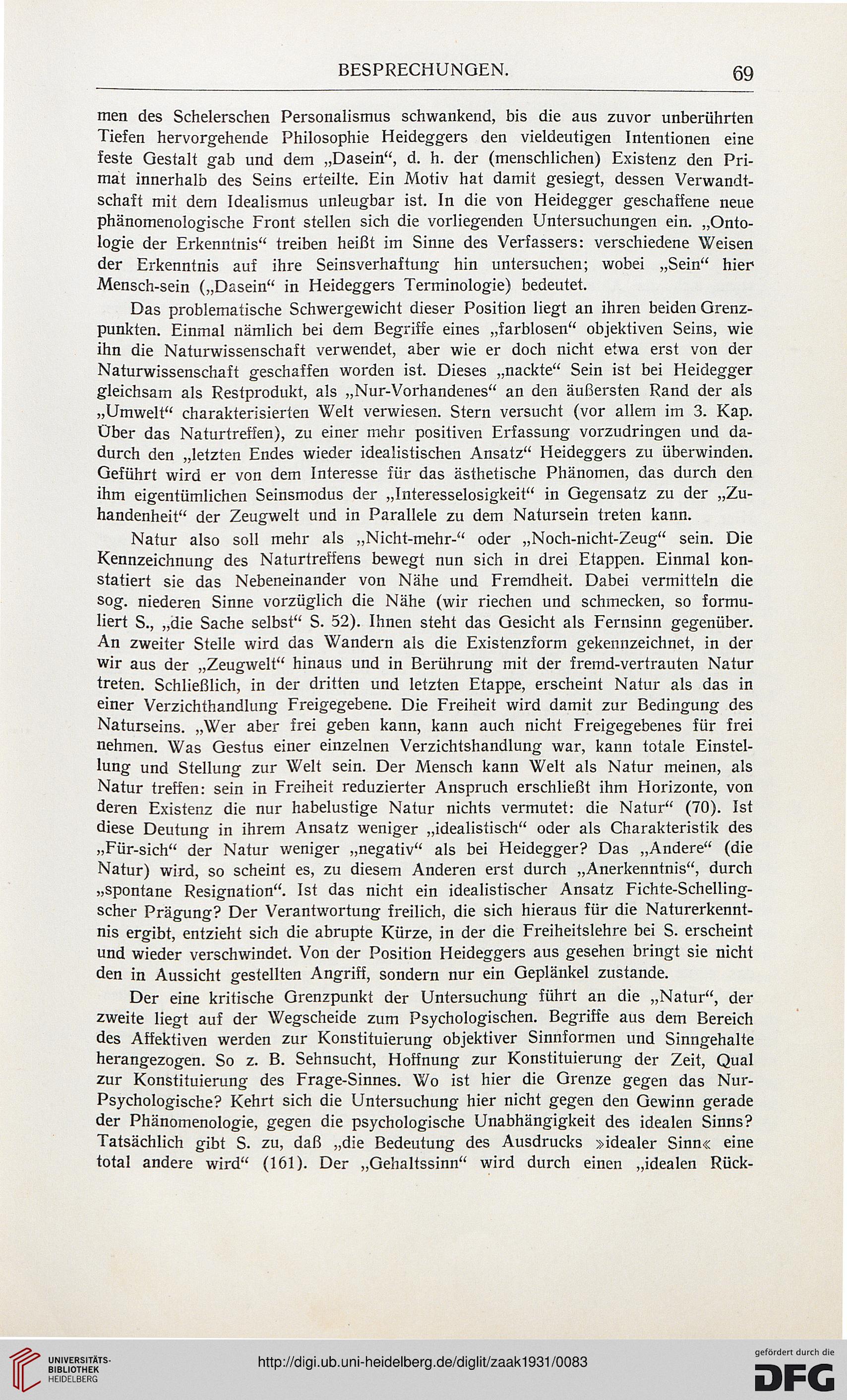BESPRECHUNGEN.
69
men des Schelerschen Personalismus schwankend, bis die aus zuvor unberührten
Tiefen hervorgehende Philosophie Heideggers den vieldeutigen Intentionen eine
feste Gestalt gab und dem „Dasein", d. h. der (menschlichen) Existenz den Pri-
mat innerhalb des Seins erteilte. Ein Motiv hat damit gesiegt, dessen Verwandt-
schaft mit dem Idealismus unleugbar ist. In die von Heidegger geschaffene neue
phänomenologische Front stellen sich die vorliegenden Untersuchungen ein. „Onto-
togie der Erkenntnis" treiben heißt im Sinne des Verfassers: verschiedene Weisen
der Erkenntnis auf ihre Seinsverhaftung hin untersuchen; wobei „Sein" hier
Mensch-sein („Dasein" in Heideggers Terminologie) bedeutet.
Das problematische Schwergewicht dieser Position liegt an ihren beiden Grenz-
punkten. Einmal nämlich bei dem Begriffe eines „farblosen" objektiven Seins, wie
ihn die Naturwissenschaft verwendet, aber wie er doch nicht etwa erst von der
Naturwissenschaft geschaffen worden ist. Dieses „nackte" Sein ist bei Heidegger
gleichsam als Restprodukt, als „Nur-Vorhandenes" an den äußersten Rand der als
„Umwelt" charakterisierten Welt verwiesen. Stern versucht (vor allem im 3. Kap.
Über das Naturtreffen), zu einer mehr positiven Erfassung vorzudringen und da-
durch den „letzten Endes wieder idealistischen Ansatz" Heideggers zu überwinden.
Geführt wird er von dem Interesse für das ästhetische Phänomen, das durch den
ihm eigentümlichen Seinsmodus der „Interesselosigkeit" in Gegensatz zu der „Zu-
handenheit" der Zeugwelt und in Parallele zu dem Natursein treten kann.
Natur also soll mehr als „Nicht-mehr-" oder „Noch-nicht-Zeug" sein. Die
Kennzeichnung des Naturtreffens bewegt nun sich in drei Etappen. Einmal kon-
statiert sie das Nebeneinander von Nähe und Fremdheit. Dabei vermitteln die
sog. niederen Sinne vorzüglich die Nähe (wir riechen und schmecken, so formu-
liert S., „die Sache selbst" S. 52). Ihnen steht das Gesicht als Fernsinn gegenüber.
An zweiter Stelle wird das Wandern als die Existenzform gekennzeichnet, in der
wir aus der „Zeugwelt" hinaus und in Berührung mit der fremd-vertrauten Natur
treten. Schließlich, in der dritten und letzten Etappe, erscheint Natur als das in
einer Verzichthandlung Freigegebene. Die Freiheit wird damit zur Bedingung des
Naturseins. „Wer aber frei geben kann, kann auch nicht Freigegebenes für frei
nehmen. Was Gestus einer einzelnen Verzichtshandlung war, kann totale Einstel-
lung und Stellung zur Welt sein. Der Mensch kann Welt als Natur meinen, als
Natur treffen: sein in Freiheit reduzierter Anspruch erschließt ihm Horizonte, von
deren Existenz die nur habelustige Natur nichts vermutet: die Natur" (70). Ist
diese Deutung in ihrem Ansatz weniger „idealistisch" oder als Charakteristik des
„Für-sich" der Natur weniger „negativ" als bei Heidegger? Das „Andere" (die
Natur) wird, so scheint es, zu diesem Anderen erst durch „Anerkenntnis", durch
»spontane Resignation". Ist das nicht ein idealistischer Ansatz Fichte-Schelling-
scher Prägung? Der Verantwortung freilich, die sich hieraus für die Naturerkennt-
nis ergibt, entzieht sich die abrupte Kürze, in der die Freiheitslehre bei S. erscheint
und wieder verschwindet. Von der Position Heideggers aus gesehen bringt sie nicht
den in Aussicht gestellten Angriff, sondern nur ein Geplänkel zustande.
Der eine kritische Grenzpunkt der Untersuchung führt an die „Natur", der
zweite liegt auf der Wegscheide zum Psychologischen. Begriffe aus dem Bereich
des Affektiven werden zur Konstituierung objektiver Sinnformen und Sinngehalte
herangezogen. So z. B. Sehnsucht, Hoffnung zur Konstituierung der Zeit, Qual
zur Konstituierung des Frage-Sinnes. Wo ist hier die Grenze gegen das Nur-
Psychologische? Kehrt sich die Untersuchung hier nicht gegen den Gewinn gerade
der Phänomenologie, gegen die psychologische Unabhängigkeit des idealen Sinns?
Tatsächlich gibt S. zu, daß „die Bedeutung des Ausdrucks »idealer Sinn« eine
total andere wird" (161). Der „Gehaltssinn" wird durch einen „idealen Rück-
69
men des Schelerschen Personalismus schwankend, bis die aus zuvor unberührten
Tiefen hervorgehende Philosophie Heideggers den vieldeutigen Intentionen eine
feste Gestalt gab und dem „Dasein", d. h. der (menschlichen) Existenz den Pri-
mat innerhalb des Seins erteilte. Ein Motiv hat damit gesiegt, dessen Verwandt-
schaft mit dem Idealismus unleugbar ist. In die von Heidegger geschaffene neue
phänomenologische Front stellen sich die vorliegenden Untersuchungen ein. „Onto-
togie der Erkenntnis" treiben heißt im Sinne des Verfassers: verschiedene Weisen
der Erkenntnis auf ihre Seinsverhaftung hin untersuchen; wobei „Sein" hier
Mensch-sein („Dasein" in Heideggers Terminologie) bedeutet.
Das problematische Schwergewicht dieser Position liegt an ihren beiden Grenz-
punkten. Einmal nämlich bei dem Begriffe eines „farblosen" objektiven Seins, wie
ihn die Naturwissenschaft verwendet, aber wie er doch nicht etwa erst von der
Naturwissenschaft geschaffen worden ist. Dieses „nackte" Sein ist bei Heidegger
gleichsam als Restprodukt, als „Nur-Vorhandenes" an den äußersten Rand der als
„Umwelt" charakterisierten Welt verwiesen. Stern versucht (vor allem im 3. Kap.
Über das Naturtreffen), zu einer mehr positiven Erfassung vorzudringen und da-
durch den „letzten Endes wieder idealistischen Ansatz" Heideggers zu überwinden.
Geführt wird er von dem Interesse für das ästhetische Phänomen, das durch den
ihm eigentümlichen Seinsmodus der „Interesselosigkeit" in Gegensatz zu der „Zu-
handenheit" der Zeugwelt und in Parallele zu dem Natursein treten kann.
Natur also soll mehr als „Nicht-mehr-" oder „Noch-nicht-Zeug" sein. Die
Kennzeichnung des Naturtreffens bewegt nun sich in drei Etappen. Einmal kon-
statiert sie das Nebeneinander von Nähe und Fremdheit. Dabei vermitteln die
sog. niederen Sinne vorzüglich die Nähe (wir riechen und schmecken, so formu-
liert S., „die Sache selbst" S. 52). Ihnen steht das Gesicht als Fernsinn gegenüber.
An zweiter Stelle wird das Wandern als die Existenzform gekennzeichnet, in der
wir aus der „Zeugwelt" hinaus und in Berührung mit der fremd-vertrauten Natur
treten. Schließlich, in der dritten und letzten Etappe, erscheint Natur als das in
einer Verzichthandlung Freigegebene. Die Freiheit wird damit zur Bedingung des
Naturseins. „Wer aber frei geben kann, kann auch nicht Freigegebenes für frei
nehmen. Was Gestus einer einzelnen Verzichtshandlung war, kann totale Einstel-
lung und Stellung zur Welt sein. Der Mensch kann Welt als Natur meinen, als
Natur treffen: sein in Freiheit reduzierter Anspruch erschließt ihm Horizonte, von
deren Existenz die nur habelustige Natur nichts vermutet: die Natur" (70). Ist
diese Deutung in ihrem Ansatz weniger „idealistisch" oder als Charakteristik des
„Für-sich" der Natur weniger „negativ" als bei Heidegger? Das „Andere" (die
Natur) wird, so scheint es, zu diesem Anderen erst durch „Anerkenntnis", durch
»spontane Resignation". Ist das nicht ein idealistischer Ansatz Fichte-Schelling-
scher Prägung? Der Verantwortung freilich, die sich hieraus für die Naturerkennt-
nis ergibt, entzieht sich die abrupte Kürze, in der die Freiheitslehre bei S. erscheint
und wieder verschwindet. Von der Position Heideggers aus gesehen bringt sie nicht
den in Aussicht gestellten Angriff, sondern nur ein Geplänkel zustande.
Der eine kritische Grenzpunkt der Untersuchung führt an die „Natur", der
zweite liegt auf der Wegscheide zum Psychologischen. Begriffe aus dem Bereich
des Affektiven werden zur Konstituierung objektiver Sinnformen und Sinngehalte
herangezogen. So z. B. Sehnsucht, Hoffnung zur Konstituierung der Zeit, Qual
zur Konstituierung des Frage-Sinnes. Wo ist hier die Grenze gegen das Nur-
Psychologische? Kehrt sich die Untersuchung hier nicht gegen den Gewinn gerade
der Phänomenologie, gegen die psychologische Unabhängigkeit des idealen Sinns?
Tatsächlich gibt S. zu, daß „die Bedeutung des Ausdrucks »idealer Sinn« eine
total andere wird" (161). Der „Gehaltssinn" wird durch einen „idealen Rück-