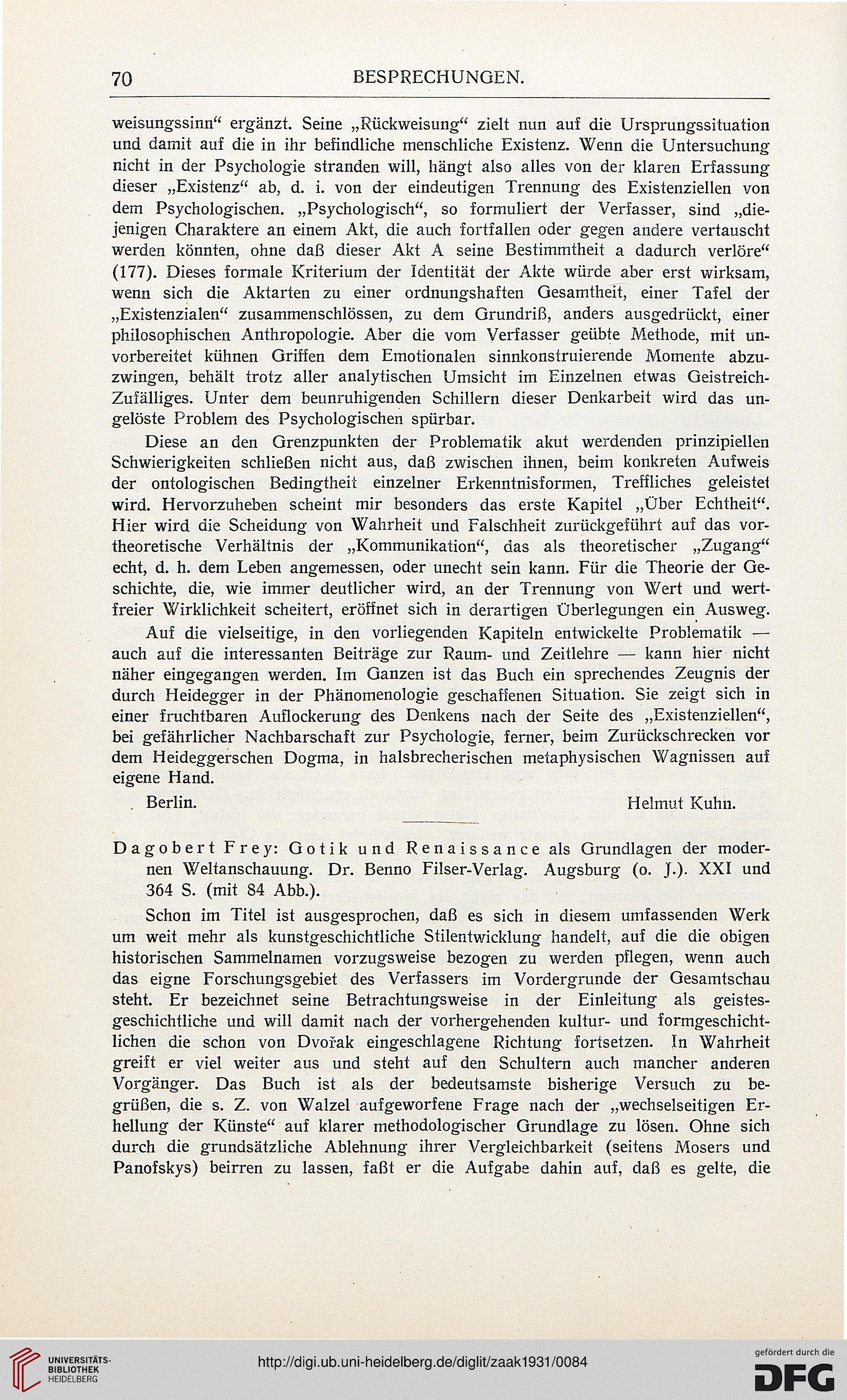70
BESPRECHUNGEN.
weisungssinn" ergänzt. Seine „Rückweisung" zielt nun auf die Ursprungssituation
und damit auf die in ihr befindliche menschliche Existenz. Wenn die Untersuchung
nicht in der Psychologie stranden will, hängt also alles von der klaren Erfassung
dieser „Existenz" ab, d. i. von der eindeutigen Trennung des Existenziellen von
dem Psychologischen. „Psychologisch", so formuliert der Verfasser, sind „die-
jenigen Charaktere an einem Akt, die auch fortfallen oder gegen andere vertauscht
werden könnten, ohne daß dieser Akt A seine Bestimmtheit a dadurch verlöre"
(177). Dieses formale Kriterium der Identität der Akte würde aber erst wirksam,
wenn sich die Aktarten zu einer ordnungshaften Gesamtheit, einer Tafel der
„Existenzialen" zusammenschlössen, zu dem Grundriß, anders ausgedrückt, einer
philosophischen Anthropologie. Aber die vom Verfasser geübte Methode, mit un-
vorbereitet kühnen Griffen dem Emotionalen sinnkonstruierende Momente abzu-
zwingen, behält trotz aller analytischen Umsicht im Einzelnen etwas Geistreich-
Zufälliges. Unter dem beunruhigenden Schillern dieser Denkarbeit wird das un-
gelöste Problem des Psychologischen spürbar.
Diese an den Grenzpunkten der Problematik akut werdenden prinzipiellen
Schwierigkeiten schließen nicht aus, daß zwischen ihnen, beim konkreten Aufweis
der ontologischen Bedingtheit einzelner Erkenntnisformen, Treffliches geleistet
wird. Hervorzuheben scheint mir besonders das erste Kapitel „Über Echtheit".
Hier wird die Scheidung von Wahrheit und Falschheit zurückgeführt auf das vor-
theoretische Verhältnis der „Kommunikation", das als theoretischer „Zugang"
echt, d. h. dem Leben angemessen, oder unecht sein kann. Für die Theorie der Ge-
schichte, die, wie immer deutlicher wird, an der Trennung von Wert und wert-
freier Wirklichkeit scheitert, eröffnet sich in derartigen Überlegungen ein Ausweg.
Auf die vielseitige, in den vorliegenden Kapiteln entwickelte Problematik —
auch auf die interessanten Beiträge zur Raum- und Zeitlehre — kann hier nicht
näher eingegangen werden. Im Ganzen ist das Buch ein sprechendes Zeugnis der
durch Heidegger in der Phänomenologie geschaffenen Situation. Sie zeigt sich in
einer fruchtbaren Auflockerung des Denkens nach der Seite des „Existenziellen",
bei gefährlicher Nachbarschaft zur Psychologie, ferner, beim Zurückschrecken vor
dem Heideggerschen Dogma, in halsbrecherischen metaphysischen Wagnissen auf
eigene Hand.
. Berlin. Helmut Kuhn.
Dagobert Frey: Gotik und Renaissance als Grundlagen der moder-
nen Weltanschauung. Dr. Benno Filser-Verlag. Augsburg (o. J.). XXI und
364 S. (mit 84 Abb.).
Schon im Titel ist ausgesprochen, daß es sich in diesem umfassenden Werk
um weit mehr als kunstgeschichtliche Stilentwicklung handelt, auf die die obigen
historischen Sammelnamen vorzugsweise bezogen zu werden pflegen, wenn auch
das eigne Forschungsgebiet des Verfassers im Vordergrunde der Gesamtschau
steht. Er bezeichnet seine Betrachtungsweise in der Einleitung als geistes-
geschichtliche und will damit nach der vorhergehenden kultur- und formgeschicht-
lichen die schon von Dvofak eingeschlagene Richtung fortsetzen. In Wahrheit
greift er viel weiter aus und steht auf den Schultern auch mancher anderen
Vorgänger. Das Buch ist als der bedeutsamste bisherige Versuch zu be-
grüßen, die s. Z. von Walzel aufgeworfene Frage nach der „wechselseitigen Er-
hellung der Künste" auf klarer methodologischer Grundlage zu lösen. Ohne sich
durch die grundsätzliche Ablehnung ihrer Vergleichbarkeit (seitens Mosers und
Panofskys) beirren zu lassen, faßt er die Aufgabe dahin auf, daß es gelte, die
BESPRECHUNGEN.
weisungssinn" ergänzt. Seine „Rückweisung" zielt nun auf die Ursprungssituation
und damit auf die in ihr befindliche menschliche Existenz. Wenn die Untersuchung
nicht in der Psychologie stranden will, hängt also alles von der klaren Erfassung
dieser „Existenz" ab, d. i. von der eindeutigen Trennung des Existenziellen von
dem Psychologischen. „Psychologisch", so formuliert der Verfasser, sind „die-
jenigen Charaktere an einem Akt, die auch fortfallen oder gegen andere vertauscht
werden könnten, ohne daß dieser Akt A seine Bestimmtheit a dadurch verlöre"
(177). Dieses formale Kriterium der Identität der Akte würde aber erst wirksam,
wenn sich die Aktarten zu einer ordnungshaften Gesamtheit, einer Tafel der
„Existenzialen" zusammenschlössen, zu dem Grundriß, anders ausgedrückt, einer
philosophischen Anthropologie. Aber die vom Verfasser geübte Methode, mit un-
vorbereitet kühnen Griffen dem Emotionalen sinnkonstruierende Momente abzu-
zwingen, behält trotz aller analytischen Umsicht im Einzelnen etwas Geistreich-
Zufälliges. Unter dem beunruhigenden Schillern dieser Denkarbeit wird das un-
gelöste Problem des Psychologischen spürbar.
Diese an den Grenzpunkten der Problematik akut werdenden prinzipiellen
Schwierigkeiten schließen nicht aus, daß zwischen ihnen, beim konkreten Aufweis
der ontologischen Bedingtheit einzelner Erkenntnisformen, Treffliches geleistet
wird. Hervorzuheben scheint mir besonders das erste Kapitel „Über Echtheit".
Hier wird die Scheidung von Wahrheit und Falschheit zurückgeführt auf das vor-
theoretische Verhältnis der „Kommunikation", das als theoretischer „Zugang"
echt, d. h. dem Leben angemessen, oder unecht sein kann. Für die Theorie der Ge-
schichte, die, wie immer deutlicher wird, an der Trennung von Wert und wert-
freier Wirklichkeit scheitert, eröffnet sich in derartigen Überlegungen ein Ausweg.
Auf die vielseitige, in den vorliegenden Kapiteln entwickelte Problematik —
auch auf die interessanten Beiträge zur Raum- und Zeitlehre — kann hier nicht
näher eingegangen werden. Im Ganzen ist das Buch ein sprechendes Zeugnis der
durch Heidegger in der Phänomenologie geschaffenen Situation. Sie zeigt sich in
einer fruchtbaren Auflockerung des Denkens nach der Seite des „Existenziellen",
bei gefährlicher Nachbarschaft zur Psychologie, ferner, beim Zurückschrecken vor
dem Heideggerschen Dogma, in halsbrecherischen metaphysischen Wagnissen auf
eigene Hand.
. Berlin. Helmut Kuhn.
Dagobert Frey: Gotik und Renaissance als Grundlagen der moder-
nen Weltanschauung. Dr. Benno Filser-Verlag. Augsburg (o. J.). XXI und
364 S. (mit 84 Abb.).
Schon im Titel ist ausgesprochen, daß es sich in diesem umfassenden Werk
um weit mehr als kunstgeschichtliche Stilentwicklung handelt, auf die die obigen
historischen Sammelnamen vorzugsweise bezogen zu werden pflegen, wenn auch
das eigne Forschungsgebiet des Verfassers im Vordergrunde der Gesamtschau
steht. Er bezeichnet seine Betrachtungsweise in der Einleitung als geistes-
geschichtliche und will damit nach der vorhergehenden kultur- und formgeschicht-
lichen die schon von Dvofak eingeschlagene Richtung fortsetzen. In Wahrheit
greift er viel weiter aus und steht auf den Schultern auch mancher anderen
Vorgänger. Das Buch ist als der bedeutsamste bisherige Versuch zu be-
grüßen, die s. Z. von Walzel aufgeworfene Frage nach der „wechselseitigen Er-
hellung der Künste" auf klarer methodologischer Grundlage zu lösen. Ohne sich
durch die grundsätzliche Ablehnung ihrer Vergleichbarkeit (seitens Mosers und
Panofskys) beirren zu lassen, faßt er die Aufgabe dahin auf, daß es gelte, die