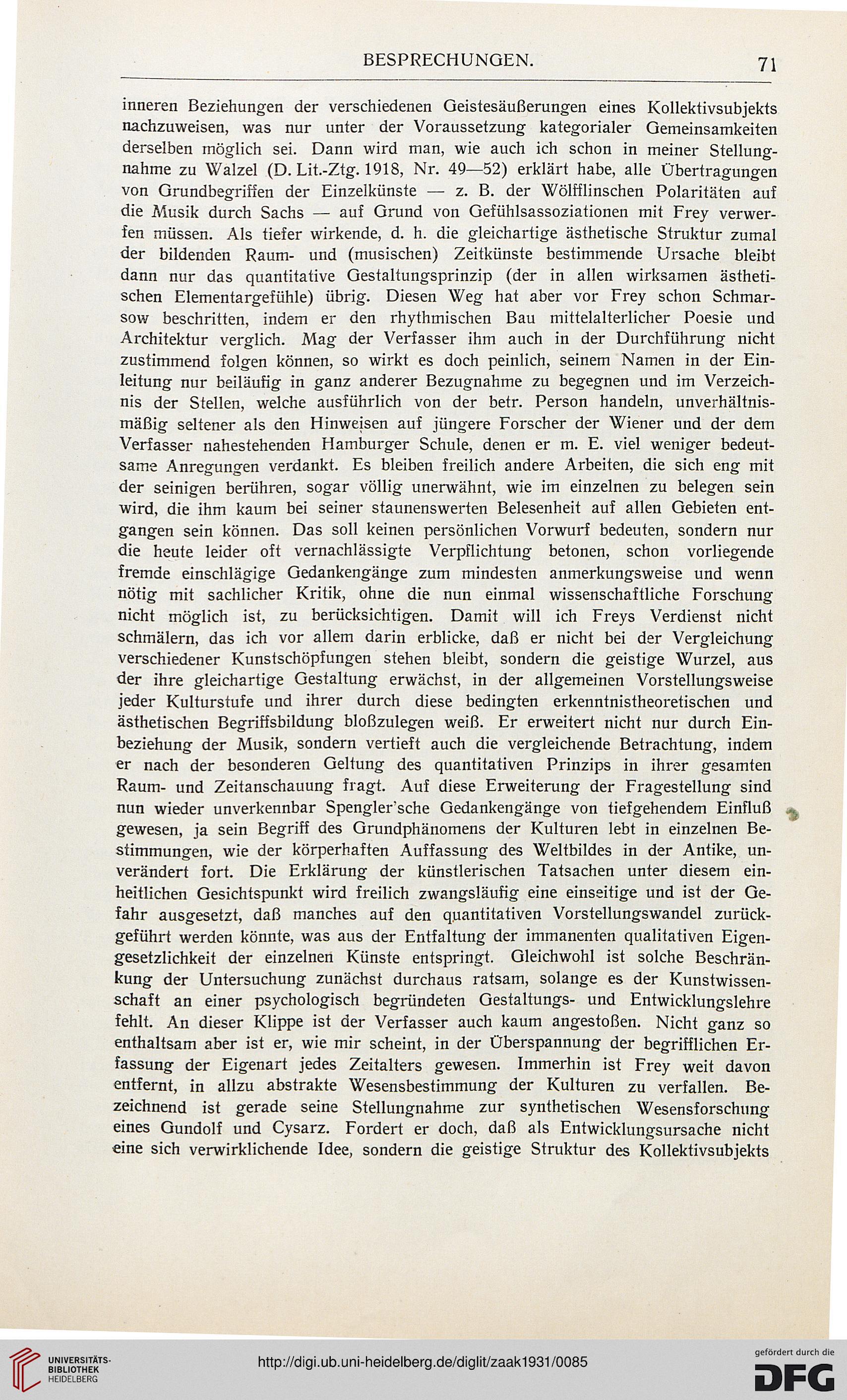BESPRECHUNGEN.
71
inneren Beziehungen der verschiedenen Geistesäußerungen eines Kollektivsubjekts
nachzuweisen, was nur unter der Voraussetzung kategorialer Gemeinsamkeiten
derselben möglich sei. Dann wird man, wie auch ich schon in meiner Stellung-
nahme zu Walzel (D. Lit.-Ztg. 1918, Nr. 49—52) erklärt habe, alle Übertragungen
von Grundbegriffen der Einzelkünste — z. B. der Wölfflinschen Polaritäten auf
die Musik durch Sachs — auf Grund von Gefühlsassoziationen mit Frey verwer-
fen müssen. Als tiefer wirkende, d. h. die gleichartige ästhetische Struktur zumal
der bildenden Raum- und (musischen) Zeitkünste bestimmende Ursache bleibt
dann nur das quantitative Gestaltungsprinzip (der in allen wirksamen ästheti-
schen Elementargefühle) übrig. Diesen Weg hat aber vor Frey schon Schmar-
sow beschritten, indem er den rhythmischen Bau mittelalterlicher Poesie und
Architektur verglich. Mag der Verfasser ihm auch in der Durchführung nicht
zustimmend folgen können, so wirkt es doch peinlich, seinem Namen in der Ein-
leitung nur beiläufig in ganz anderer Bezugnahme zu begegnen und im Verzeich-
nis der Stellen, welche ausführlich von der betr. Person handeln, unverhältnis-
mäßig seltener als den Hinweisen auf jüngere Forscher der Wiener und der dem
Verfasser nahestehenden Hamburger Schule, denen er m. E. viel weniger bedeut-
same Anregungen verdankt. Es bleiben freilich andere Arbeiten, die sich eng mit
der seinigen berühren, sogar völlig unerwähnt, wie im einzelnen zu belegen sein
wird, die ihm kaum bei seiner staunenswerten Belesenheit auf allen Gebieten ent-
gangen sein können. Das soll keinen persönlichen Vorwurf bedeuten, sondern nur
die heute leider oft vernachlässigte Verpflichtung betonen, schon vorliegende
fremde einschlägige Gedankengänge zum mindesten anmerkungsweise und wenn
nötig mit sachlicher Kritik, ohne die nun einmal wissenschaftliche Forschung
nicht möglich ist, zu berücksichtigen. Damit will ich Freys Verdienst nicht
schmälern, das ich vor allem darin erblicke, daß er nicht bei der Vergleichung
verschiedener Kunstschöpfungen stehen bleibt, sondern die geistige Wurzel, aus
der ihre gleichartige Gestaltung erwächst, in der allgemeinen Vorstellungsweise
jeder Kulturstufe und ihrer durch diese bedingten erkenntnistheoretischen und
ästhetischen Begriffsbildung bloßzulegen weiß. Er erweitert nicht nur durch Ein-
beziehung der Musik, sondern vertieft auch die vergleichende Betrachtung, indem
er nach der besonderen Geltung des quantitativen Prinzips in ihrer gesamten
Raum- und Zeitanschauung fragt. Auf diese Erweiterung der Fragestellung sind
nun wieder unverkennbar Spengler'sche Gedankengänge von tiefgehendem Einfluß
gewesen, ja sein Begriff des Grundphänomens der Kulturen lebt in einzelnen Be-
stimmungen, wie der körperhaften Auffassung des Weltbildes in der Antike, un-
verändert fort. Die Erklärung der künstlerischen Tatsachen unter diesem ein-
heitlichen Gesichtspunkt wird freilich zwangsläufig eine einseitige und ist der Ge-
fahr ausgesetzt, daß manches auf den quantitativen Vorstellungswandel zurück-
geführt werden könnte, was aus der Entfaltung der immanenten qualitativen Eigen-
gesetzlichkeit der einzelnen Künste entspringt. Gleichwohl ist solche Beschrän-
kung der Untersuchung zunächst durchaus ratsam, solange es der Kunstwissen-
schaft an einer psychologisch begründeten Gestaltungs- und Entwicklungslehre
fehlt. An dieser Klippe ist der Verfasser auch kaum angestoßen. Nicht ganz so
enthaltsam aber ist er, wie mir scheint, in der Oberspannung der begrifflichen Er-
fassung der Eigenart jedes Zeitalters gewesen. Immerhin ist Frey weit davon
entfernt, in allzu abstrakte Wesensbestimmung der Kulturen zu verfallen. Be-
zeichnend ist gerade seine Stellungnahme zur synthetischen Wesensforschung
eines Gundolf und Cysarz. Fordert er doch, daß als Entwicklungsursache nicht
eine sich verwirklichende Idee, sondern die geistige Struktur des Kollektivsubjekts
71
inneren Beziehungen der verschiedenen Geistesäußerungen eines Kollektivsubjekts
nachzuweisen, was nur unter der Voraussetzung kategorialer Gemeinsamkeiten
derselben möglich sei. Dann wird man, wie auch ich schon in meiner Stellung-
nahme zu Walzel (D. Lit.-Ztg. 1918, Nr. 49—52) erklärt habe, alle Übertragungen
von Grundbegriffen der Einzelkünste — z. B. der Wölfflinschen Polaritäten auf
die Musik durch Sachs — auf Grund von Gefühlsassoziationen mit Frey verwer-
fen müssen. Als tiefer wirkende, d. h. die gleichartige ästhetische Struktur zumal
der bildenden Raum- und (musischen) Zeitkünste bestimmende Ursache bleibt
dann nur das quantitative Gestaltungsprinzip (der in allen wirksamen ästheti-
schen Elementargefühle) übrig. Diesen Weg hat aber vor Frey schon Schmar-
sow beschritten, indem er den rhythmischen Bau mittelalterlicher Poesie und
Architektur verglich. Mag der Verfasser ihm auch in der Durchführung nicht
zustimmend folgen können, so wirkt es doch peinlich, seinem Namen in der Ein-
leitung nur beiläufig in ganz anderer Bezugnahme zu begegnen und im Verzeich-
nis der Stellen, welche ausführlich von der betr. Person handeln, unverhältnis-
mäßig seltener als den Hinweisen auf jüngere Forscher der Wiener und der dem
Verfasser nahestehenden Hamburger Schule, denen er m. E. viel weniger bedeut-
same Anregungen verdankt. Es bleiben freilich andere Arbeiten, die sich eng mit
der seinigen berühren, sogar völlig unerwähnt, wie im einzelnen zu belegen sein
wird, die ihm kaum bei seiner staunenswerten Belesenheit auf allen Gebieten ent-
gangen sein können. Das soll keinen persönlichen Vorwurf bedeuten, sondern nur
die heute leider oft vernachlässigte Verpflichtung betonen, schon vorliegende
fremde einschlägige Gedankengänge zum mindesten anmerkungsweise und wenn
nötig mit sachlicher Kritik, ohne die nun einmal wissenschaftliche Forschung
nicht möglich ist, zu berücksichtigen. Damit will ich Freys Verdienst nicht
schmälern, das ich vor allem darin erblicke, daß er nicht bei der Vergleichung
verschiedener Kunstschöpfungen stehen bleibt, sondern die geistige Wurzel, aus
der ihre gleichartige Gestaltung erwächst, in der allgemeinen Vorstellungsweise
jeder Kulturstufe und ihrer durch diese bedingten erkenntnistheoretischen und
ästhetischen Begriffsbildung bloßzulegen weiß. Er erweitert nicht nur durch Ein-
beziehung der Musik, sondern vertieft auch die vergleichende Betrachtung, indem
er nach der besonderen Geltung des quantitativen Prinzips in ihrer gesamten
Raum- und Zeitanschauung fragt. Auf diese Erweiterung der Fragestellung sind
nun wieder unverkennbar Spengler'sche Gedankengänge von tiefgehendem Einfluß
gewesen, ja sein Begriff des Grundphänomens der Kulturen lebt in einzelnen Be-
stimmungen, wie der körperhaften Auffassung des Weltbildes in der Antike, un-
verändert fort. Die Erklärung der künstlerischen Tatsachen unter diesem ein-
heitlichen Gesichtspunkt wird freilich zwangsläufig eine einseitige und ist der Ge-
fahr ausgesetzt, daß manches auf den quantitativen Vorstellungswandel zurück-
geführt werden könnte, was aus der Entfaltung der immanenten qualitativen Eigen-
gesetzlichkeit der einzelnen Künste entspringt. Gleichwohl ist solche Beschrän-
kung der Untersuchung zunächst durchaus ratsam, solange es der Kunstwissen-
schaft an einer psychologisch begründeten Gestaltungs- und Entwicklungslehre
fehlt. An dieser Klippe ist der Verfasser auch kaum angestoßen. Nicht ganz so
enthaltsam aber ist er, wie mir scheint, in der Oberspannung der begrifflichen Er-
fassung der Eigenart jedes Zeitalters gewesen. Immerhin ist Frey weit davon
entfernt, in allzu abstrakte Wesensbestimmung der Kulturen zu verfallen. Be-
zeichnend ist gerade seine Stellungnahme zur synthetischen Wesensforschung
eines Gundolf und Cysarz. Fordert er doch, daß als Entwicklungsursache nicht
eine sich verwirklichende Idee, sondern die geistige Struktur des Kollektivsubjekts