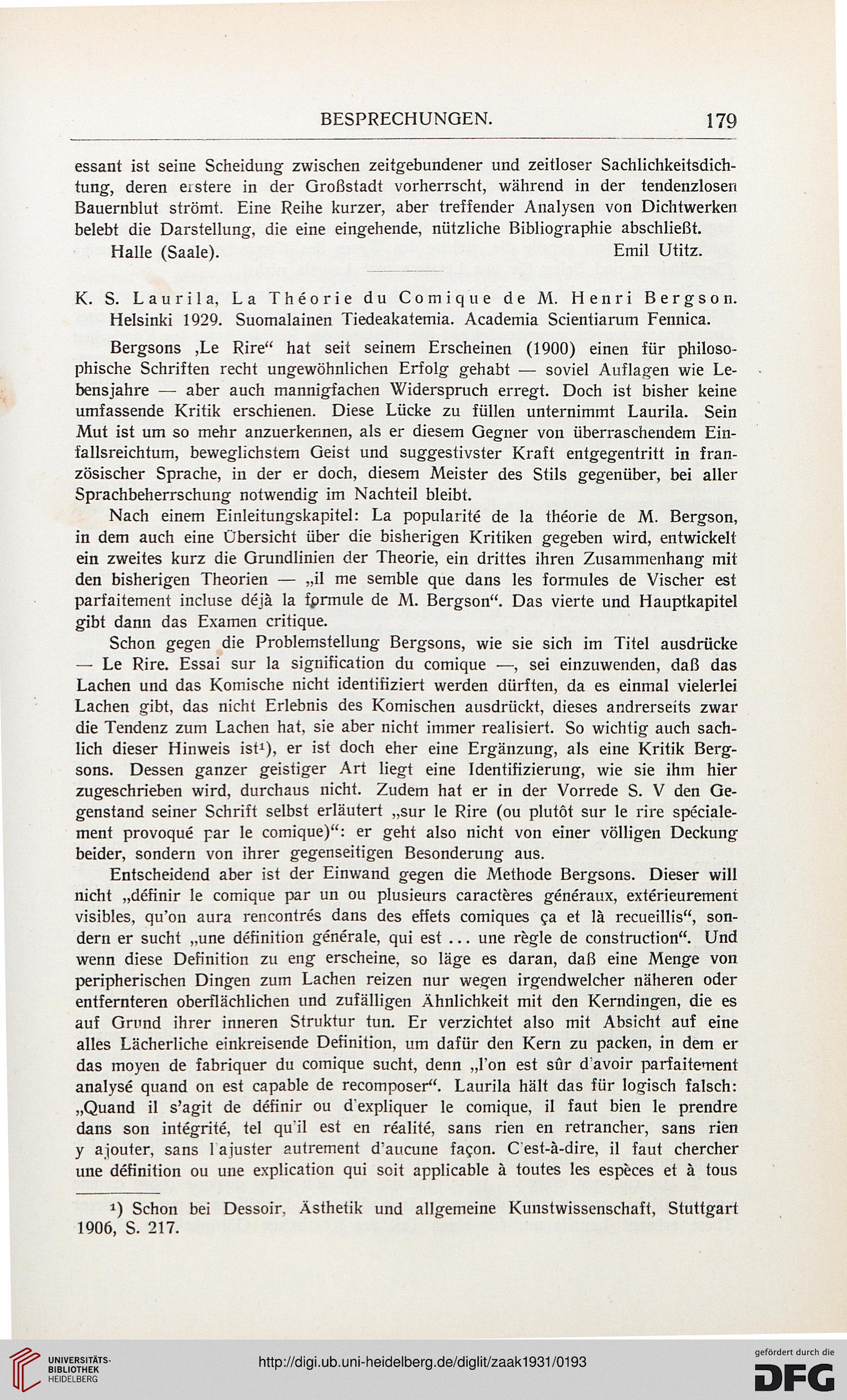BESPRECHUNGEN.
179
essant ist seine Scheidung zwischen zeitgebundener und zeitloser Sachlichkeitsdich-
tung, deren eistere in der Großstadt vorherrscht, während in der tendenziösen
Bauernblut strömt. Eine Reihe kurzer, aber treffender Analysen von Dichtwerken
belebt die Darstellung, die eine eingehende, nützliche Bibliographie abschließt.
Halle (Saale). Emil Utitz.
K. S. Laurila, La Theorie du Comique de M. Henri Bergson.
Helsinki 1929. Suomalainen Tiedeakatemia. Academia Scientiarum Fennica.
Bergsons ,Le Rire" hat seit seinem Erscheinen (1900) einen für philoso-
phische Schriften recht ungewöhnlichen Erfolg gehabt — soviel Auflagen wie Le-
bensjahre — aber auch mannigfachen Widerspruch erregt. Doch ist bisher keine
umfassende Kritik erschienen. Diese Lücke zu füllen unternimmt Laurila. Sein
Mut ist um so mehr anzuerkennen, als er diesem Gegner von überraschendem Ein-
fallsreichtum, beweglichstem Geist und suggestivster Kraft entgegentritt in fran-
zösischer Sprache, in der er doch, diesem Meister des Stils gegenüber, bei aller
Sprachbeherrschung notwendig im Nachteil bleibt.
Nach einem Einleitungskapitel: La popularite de la theorie de M. Bergson,
in dem auch eine Übersicht über die bisherigen Kritiken gegeben wird, entwickelt
ein zweites kurz die Grundlinien der Theorie, ein drittes ihren Zusammenhang mit
den bisherigen Theorien — „il me semble que dans les formules de Vischer est
parfaitement incluse dejä la fprmule de M. Bergson". Das vierte und Hauptkapitel
gibt dann das Examen critique.
Schon gegen die Problemstellung Bergsons, wie sie sich im Titel ausdrücke
— Le Rire. Essai sur la signification du comique —, sei einzuwenden, daß das
Lachen und das Komische nicht identifiziert werden dürften, da es einmal vielerlei
Lachen gibt, das nicht Erlebnis des Komischen ausdrückt, dieses andrerseits zwar
die Tendenz zum Lachen hat, sie aber nicht immer realisiert. So wichtig auch sach-
lich dieser Hinweis ist1), er ist doch eher eine Ergänzung, als eine Kritik Berg-
sons. Dessen ganzer geistiger Art liegt eine Identifizierung, wie sie ihm hier
zugeschrieben wird, durchaus nicht. Zudem hat er in der Vorrede S. V den Ge-
genstand seiner Schrift selbst erläutert „sur le Rire (ou plutöt sur le rire speciale-
ment provoque par le comique)": er geht also nicht von einer völligen Deckung
beider, sondern von ihrer gegenseitigen Besonderung aus.
Entscheidend aber ist der Einwand gegen die Methode Bergsons. Dieser will
nicht „definir le comique par un ou plusieurs caracteres generaux, exterieurement
visibles, qu'on aura rencontres dans des effets comiques ca et lä recueillis", son-
dern er sucht „une definition generale, qui est ... une regle de construction". Und
wenn diese Definition zu eng erscheine, so läge es daran, daß eine Menge von
peripherischen Dingen zum Lachen reizen nur wegen irgendwelcher näheren oder
entfernteren oberflächlichen und zufälligen Ähnlichkeit mit den Kerndingen, die es
auf Grund ihrer inneren Struktur tun. Er verzichtet also mit Absicht auf eine
alles Lächerliche einkreisende Definition, um dafür den Kern zu packen, in dem er
das moyen de fabriquer du comique sucht, denn „l'on est sür d'avoir parfaitement
analyse quand on est capable de recomposer". Laurila hält das für logisch falsch:
„Quand il s'agit de definir ou d'expliquer le comique, il faut bien le prendre
dans son integrite, tel qu'il est en realite, sans rien en retrancher, sans rien
y ajouter, sans 1 ajuster autrement d'aucune fagon. C'est-ä-dire, il faut chercher
une definition ou une explication qui soit applicable ä toutes les especes et ä tous
!) Schon bei Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart
1906, S. 217.
179
essant ist seine Scheidung zwischen zeitgebundener und zeitloser Sachlichkeitsdich-
tung, deren eistere in der Großstadt vorherrscht, während in der tendenziösen
Bauernblut strömt. Eine Reihe kurzer, aber treffender Analysen von Dichtwerken
belebt die Darstellung, die eine eingehende, nützliche Bibliographie abschließt.
Halle (Saale). Emil Utitz.
K. S. Laurila, La Theorie du Comique de M. Henri Bergson.
Helsinki 1929. Suomalainen Tiedeakatemia. Academia Scientiarum Fennica.
Bergsons ,Le Rire" hat seit seinem Erscheinen (1900) einen für philoso-
phische Schriften recht ungewöhnlichen Erfolg gehabt — soviel Auflagen wie Le-
bensjahre — aber auch mannigfachen Widerspruch erregt. Doch ist bisher keine
umfassende Kritik erschienen. Diese Lücke zu füllen unternimmt Laurila. Sein
Mut ist um so mehr anzuerkennen, als er diesem Gegner von überraschendem Ein-
fallsreichtum, beweglichstem Geist und suggestivster Kraft entgegentritt in fran-
zösischer Sprache, in der er doch, diesem Meister des Stils gegenüber, bei aller
Sprachbeherrschung notwendig im Nachteil bleibt.
Nach einem Einleitungskapitel: La popularite de la theorie de M. Bergson,
in dem auch eine Übersicht über die bisherigen Kritiken gegeben wird, entwickelt
ein zweites kurz die Grundlinien der Theorie, ein drittes ihren Zusammenhang mit
den bisherigen Theorien — „il me semble que dans les formules de Vischer est
parfaitement incluse dejä la fprmule de M. Bergson". Das vierte und Hauptkapitel
gibt dann das Examen critique.
Schon gegen die Problemstellung Bergsons, wie sie sich im Titel ausdrücke
— Le Rire. Essai sur la signification du comique —, sei einzuwenden, daß das
Lachen und das Komische nicht identifiziert werden dürften, da es einmal vielerlei
Lachen gibt, das nicht Erlebnis des Komischen ausdrückt, dieses andrerseits zwar
die Tendenz zum Lachen hat, sie aber nicht immer realisiert. So wichtig auch sach-
lich dieser Hinweis ist1), er ist doch eher eine Ergänzung, als eine Kritik Berg-
sons. Dessen ganzer geistiger Art liegt eine Identifizierung, wie sie ihm hier
zugeschrieben wird, durchaus nicht. Zudem hat er in der Vorrede S. V den Ge-
genstand seiner Schrift selbst erläutert „sur le Rire (ou plutöt sur le rire speciale-
ment provoque par le comique)": er geht also nicht von einer völligen Deckung
beider, sondern von ihrer gegenseitigen Besonderung aus.
Entscheidend aber ist der Einwand gegen die Methode Bergsons. Dieser will
nicht „definir le comique par un ou plusieurs caracteres generaux, exterieurement
visibles, qu'on aura rencontres dans des effets comiques ca et lä recueillis", son-
dern er sucht „une definition generale, qui est ... une regle de construction". Und
wenn diese Definition zu eng erscheine, so läge es daran, daß eine Menge von
peripherischen Dingen zum Lachen reizen nur wegen irgendwelcher näheren oder
entfernteren oberflächlichen und zufälligen Ähnlichkeit mit den Kerndingen, die es
auf Grund ihrer inneren Struktur tun. Er verzichtet also mit Absicht auf eine
alles Lächerliche einkreisende Definition, um dafür den Kern zu packen, in dem er
das moyen de fabriquer du comique sucht, denn „l'on est sür d'avoir parfaitement
analyse quand on est capable de recomposer". Laurila hält das für logisch falsch:
„Quand il s'agit de definir ou d'expliquer le comique, il faut bien le prendre
dans son integrite, tel qu'il est en realite, sans rien en retrancher, sans rien
y ajouter, sans 1 ajuster autrement d'aucune fagon. C'est-ä-dire, il faut chercher
une definition ou une explication qui soit applicable ä toutes les especes et ä tous
!) Schon bei Dessoir, Ästhetik und allgemeine Kunstwissenschaft, Stuttgart
1906, S. 217.