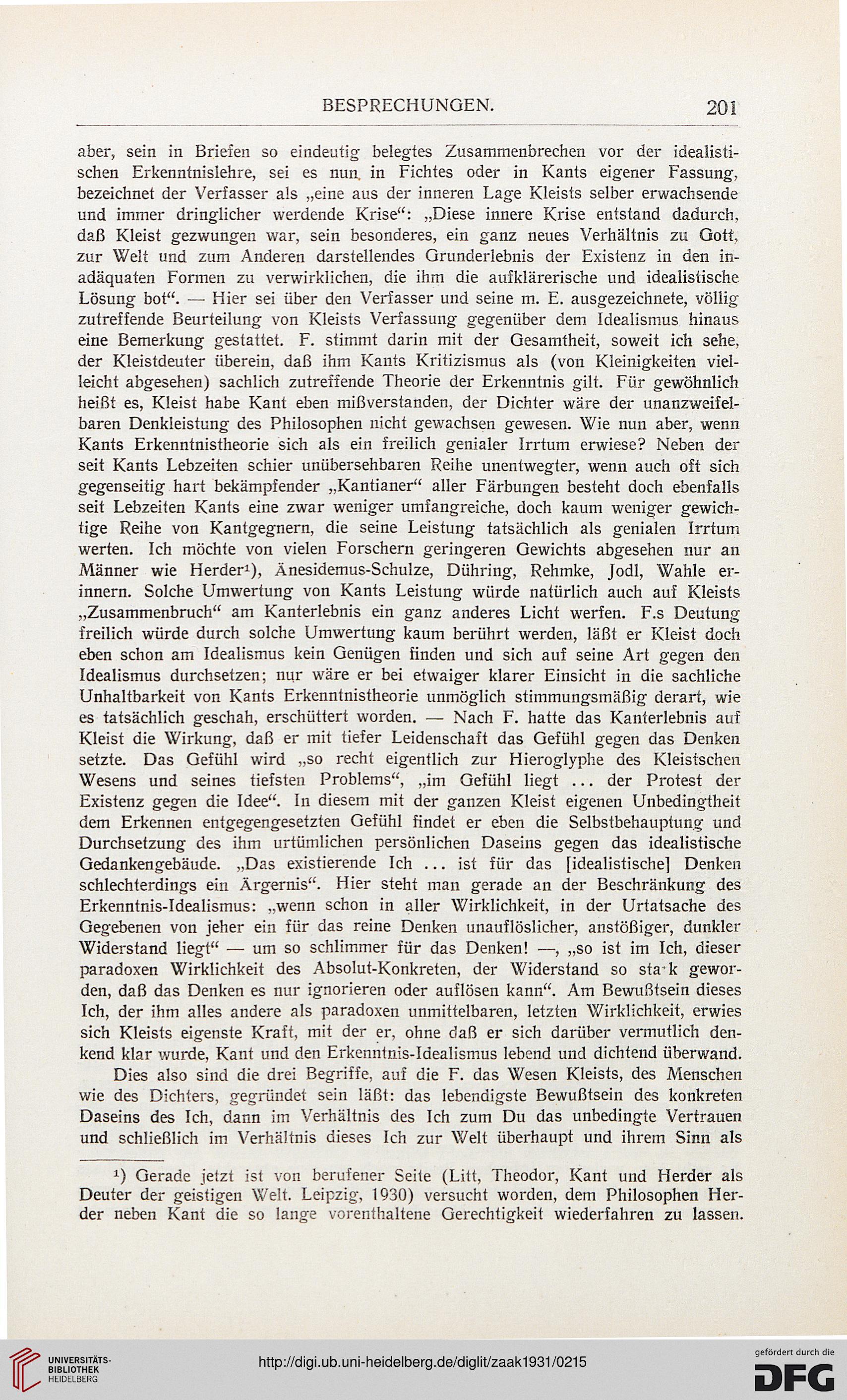BESPRECHUNGEN.
201
aber, sein in Briefen so eindeutig belegtes Zusammenbrechen vor der idealisti-
schen Erkenntnislehre, sei es nun. in Fichtes oder in Kants eigener Fassung,
bezeichnet der Verfasser als „eine aus der inneren Lage Kleists selber erwachsende
und immer dringlicher werdende Krise": „Diese innere Krise entstand dadurch,
daß Kleist gezwungen war, sein besonderes, ein ganz neues Verhältnis zu Gott,
zur Welt und zum Anderen darstellendes Grunderlebnis der Existenz in den in-
adäquaten Formen zu verwirklichen, die ihm die aufklärerische und idealistische
Lösung bot". — Hier sei über den Verfasser und seine m. E. ausgezeichnete, völlig
zutreffende Beurteilung von Kleists Verfassung gegenüber dem Idealismus hinaus
eine Bemerkung gestattet. F. stimmt darin mit der Gesamtheit, soweit ich sehe,
der Kleistdeuter überein, daß ihm Kants Kritizismus als (von Kleinigkeiten viel-
leicht abgesehen) sachlich zutreffende Theorie der Erkenntnis gilt. Für gewöhnlich
heißt es, Kleist habe Kant eben mißverstanden, der Dichter wäre der unanzweifel-
baren Denkleistung des Philosophen nicht gewachsen gewesen. Wie nun aber, wenn
Kants Erkenntnistheorie sich als ein freilich genialer Irrtum erwiese? Neben der
seit Kants Lebzeiten schier unübersehbaren Reihe unentwegter, wenn auch oft sich
gegenseitig hart bekämpfender „Kantianer" aller Färbungen besteht doch ebenfalls
seit Lebzeiten Kants eine zwar weniger umfangreiche, doch kaum weniger gewich-
tige Reihe von Kantgegnern, die seine Leistung tatsächlich als genialen Irrtum
werten. Ich möchte von vielen Forschern geringeren Gewichts abgesehen nur an
Männer wie Herder1), Änesidemus-Schulze, Dühring, Rehmke, Jodl, Wahle er-
innern. Solche Umwertung von Kants Leistung würde natürlich auch auf Kleists
„Zusammenbruch" am Kanterlebnis ein ganz anderes Licht werfen. F.s Deutung
freilich würde durch solche Umwertung kaum berührt werden, läßt er Kleist doch
eben schon am Idealismus kein Genügen finden und sich auf seine Art gegen den
Idealismus durchsetzen; nur wäre er bei etwaiger klarer Einsicht in die sachliche
Unhaltbarkeit von Kants Erkenntnistheorie unmöglich stimmungsmäßig derart, wie
es tatsächlich geschah, erschüttert worden. — Nach F. hatte das Kanterlebnis auf
Kleist die Wirkung, daß er mit tiefer Leidenschaft das Gefühl gegen das Denken
setzte. Das Gefühl wird „so recht eigentlich zur Hieroglyphe des Kleistschen
Wesens und seines tiefsten Problems", „im Gefühl liegt ... der Protest der
Existenz gegen die Idee". In diesem mit der ganzen Kleist eigenen Unbedingtheit
dem Erkennen entgegengesetzten Gefühl findet er eben die Selbstbehauptung und
Durchsetzung des ihm urtümlichen persönlichen Daseins gegen das idealistische
Gedankengebäude. „Das existierende Ich ... ist für das [idealistische] Denken
schlechterdings ein Ärgernis". Hier steht mau gerade an der Beschränkung des
Erkenntnis-Idealismus: „wenn schon in aller Wirklichkeit, in der Urtatsache des
Gegebenen von jeher ein für das reine Denken unauflöslicher, anstößiger, dunkler
Widerstand liegt" — um so schlimmer für das Denken! —, „so ist im Ich, dieser
paradoxen Wirklichkeit des Absolut-Konkreten, der Widerstand so sta-k gewor-
den, daß das Denken es nur ignorieren oder auflösen kann". Am Bewußtsein dieses
Ich, der ihm alles andere als paradoxen unmittelbaren, letzten Wirklichkeit, erwies
sich Kleists eigenste Kraft, mit der er, ohne daß er sich darüber vermutlich den-
kend klar wurde, Kant und den Erkenntnis-Idealismus lebend und dichtend überwand.
Dies also sind die drei Begriffe, auf die F. das Wesen Kleists, des Menschen
wie des Dichters, gegründet sein läßt: das lebendigste Bewußtsein des konkreten
Daseins des Ich, dann im Verhältnis des Ich zum Du das unbedingte Vertrauen
und schließlich im Verhältnis dieses Ich zur Welt überhaupt und ihrem Sinn als
l) Gerade jetzt ist von berufener Seite (Litt, Theodor, Kant und Herder als
Deuter der geistigen Welt. Leipzig, 1930) versucht worden, dem Philosophen Her-
der neben Kant die so lange vorenthaltene Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.
201
aber, sein in Briefen so eindeutig belegtes Zusammenbrechen vor der idealisti-
schen Erkenntnislehre, sei es nun. in Fichtes oder in Kants eigener Fassung,
bezeichnet der Verfasser als „eine aus der inneren Lage Kleists selber erwachsende
und immer dringlicher werdende Krise": „Diese innere Krise entstand dadurch,
daß Kleist gezwungen war, sein besonderes, ein ganz neues Verhältnis zu Gott,
zur Welt und zum Anderen darstellendes Grunderlebnis der Existenz in den in-
adäquaten Formen zu verwirklichen, die ihm die aufklärerische und idealistische
Lösung bot". — Hier sei über den Verfasser und seine m. E. ausgezeichnete, völlig
zutreffende Beurteilung von Kleists Verfassung gegenüber dem Idealismus hinaus
eine Bemerkung gestattet. F. stimmt darin mit der Gesamtheit, soweit ich sehe,
der Kleistdeuter überein, daß ihm Kants Kritizismus als (von Kleinigkeiten viel-
leicht abgesehen) sachlich zutreffende Theorie der Erkenntnis gilt. Für gewöhnlich
heißt es, Kleist habe Kant eben mißverstanden, der Dichter wäre der unanzweifel-
baren Denkleistung des Philosophen nicht gewachsen gewesen. Wie nun aber, wenn
Kants Erkenntnistheorie sich als ein freilich genialer Irrtum erwiese? Neben der
seit Kants Lebzeiten schier unübersehbaren Reihe unentwegter, wenn auch oft sich
gegenseitig hart bekämpfender „Kantianer" aller Färbungen besteht doch ebenfalls
seit Lebzeiten Kants eine zwar weniger umfangreiche, doch kaum weniger gewich-
tige Reihe von Kantgegnern, die seine Leistung tatsächlich als genialen Irrtum
werten. Ich möchte von vielen Forschern geringeren Gewichts abgesehen nur an
Männer wie Herder1), Änesidemus-Schulze, Dühring, Rehmke, Jodl, Wahle er-
innern. Solche Umwertung von Kants Leistung würde natürlich auch auf Kleists
„Zusammenbruch" am Kanterlebnis ein ganz anderes Licht werfen. F.s Deutung
freilich würde durch solche Umwertung kaum berührt werden, läßt er Kleist doch
eben schon am Idealismus kein Genügen finden und sich auf seine Art gegen den
Idealismus durchsetzen; nur wäre er bei etwaiger klarer Einsicht in die sachliche
Unhaltbarkeit von Kants Erkenntnistheorie unmöglich stimmungsmäßig derart, wie
es tatsächlich geschah, erschüttert worden. — Nach F. hatte das Kanterlebnis auf
Kleist die Wirkung, daß er mit tiefer Leidenschaft das Gefühl gegen das Denken
setzte. Das Gefühl wird „so recht eigentlich zur Hieroglyphe des Kleistschen
Wesens und seines tiefsten Problems", „im Gefühl liegt ... der Protest der
Existenz gegen die Idee". In diesem mit der ganzen Kleist eigenen Unbedingtheit
dem Erkennen entgegengesetzten Gefühl findet er eben die Selbstbehauptung und
Durchsetzung des ihm urtümlichen persönlichen Daseins gegen das idealistische
Gedankengebäude. „Das existierende Ich ... ist für das [idealistische] Denken
schlechterdings ein Ärgernis". Hier steht mau gerade an der Beschränkung des
Erkenntnis-Idealismus: „wenn schon in aller Wirklichkeit, in der Urtatsache des
Gegebenen von jeher ein für das reine Denken unauflöslicher, anstößiger, dunkler
Widerstand liegt" — um so schlimmer für das Denken! —, „so ist im Ich, dieser
paradoxen Wirklichkeit des Absolut-Konkreten, der Widerstand so sta-k gewor-
den, daß das Denken es nur ignorieren oder auflösen kann". Am Bewußtsein dieses
Ich, der ihm alles andere als paradoxen unmittelbaren, letzten Wirklichkeit, erwies
sich Kleists eigenste Kraft, mit der er, ohne daß er sich darüber vermutlich den-
kend klar wurde, Kant und den Erkenntnis-Idealismus lebend und dichtend überwand.
Dies also sind die drei Begriffe, auf die F. das Wesen Kleists, des Menschen
wie des Dichters, gegründet sein läßt: das lebendigste Bewußtsein des konkreten
Daseins des Ich, dann im Verhältnis des Ich zum Du das unbedingte Vertrauen
und schließlich im Verhältnis dieses Ich zur Welt überhaupt und ihrem Sinn als
l) Gerade jetzt ist von berufener Seite (Litt, Theodor, Kant und Herder als
Deuter der geistigen Welt. Leipzig, 1930) versucht worden, dem Philosophen Her-
der neben Kant die so lange vorenthaltene Gerechtigkeit wiederfahren zu lassen.