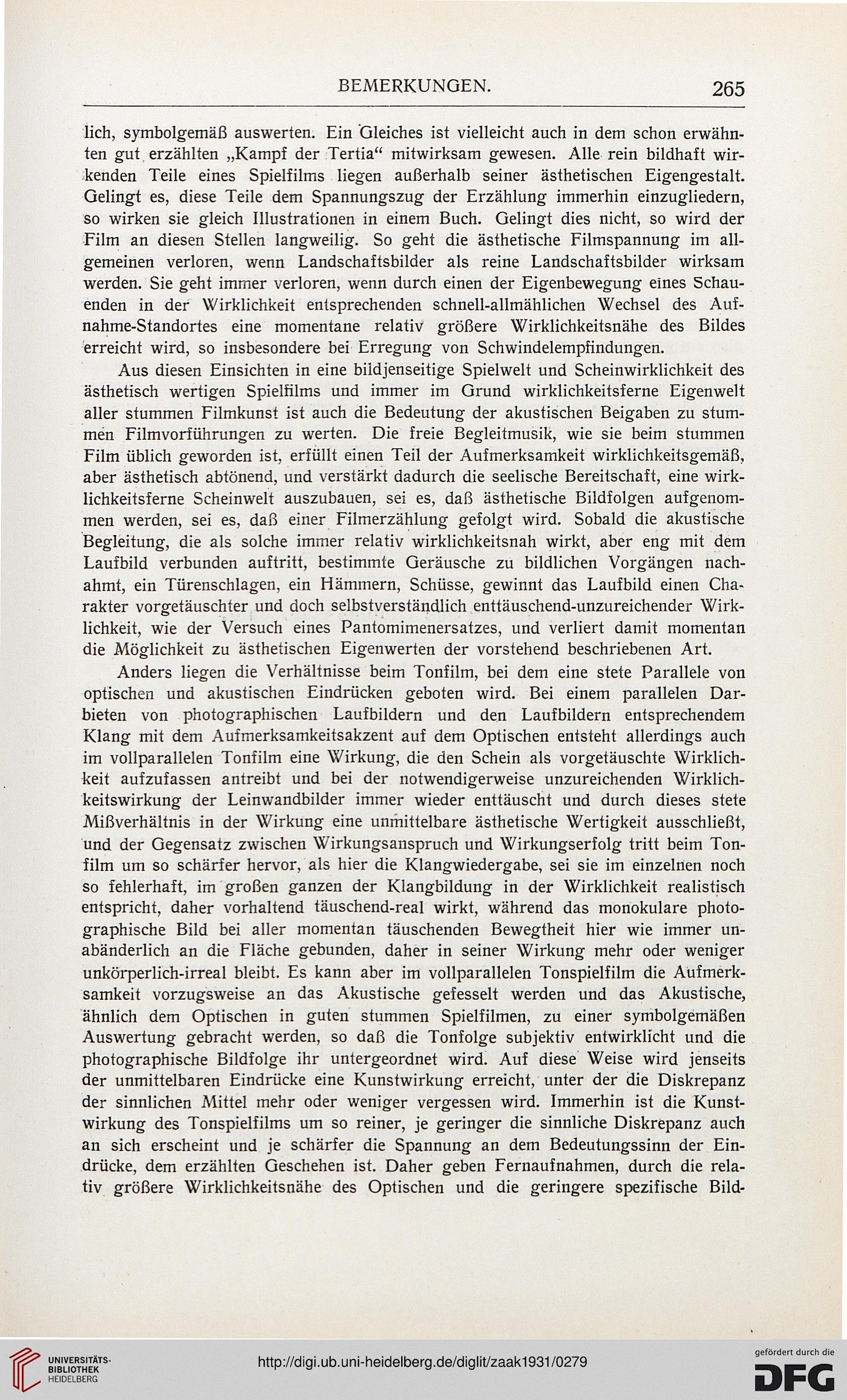BEMERKUNGEN.
265
lieh, symbolgemäß auswerten. Ein Gleiches ist vielleicht auch in dem schon erwähn-
ten gut erzählten „Kampf der Tertia" mitwirksam gewesen. Alle rein bildhaft wir-
kenden Teile eines Spielfilms liegen außerhalb seiner ästhetischen Eigengestalt.
Gelingt es, diese Teile dem Spannungszug der Erzählung immerhin einzugliedern,
so wirken sie gleich Illustrationen in einem Buch. Gelingt dies nicht, so wird der
Film an diesen Stellen langweilig. So geht die ästhetische Filmspannung im all-
gemeinen verloren, wenn Landschaftsbilder als reine Landschaftsbilder wirksam
werden. Sie geht immer verloren, wenn durch einen der Eigenbewegung eines Schau-
enden in der Wirklichkeit entsprechenden schnell-allmählichen Wechsel des Auf-
nahme-Standortes eine momentane relativ größere Wirklichkeitsnähe des Bildes
erreicht wird, so insbesondere bei Erregung von Schwiiidelempfindungen.
Aus diesen Einsichten in eine biidjenseitige Spielwelt und Scheinwirklichkeit des
ästhetisch wertigen Spielfilms und immer im Grund wirklichkeitsferne Eigen weit
aller stummen Filmkunst ist auch die Bedeutung der akustischen Beigaben zu stum-
men Filmvorführungen zu werten. Die freie Begleitmusik, wie sie beim stummen
Film üblich geworden ist, erfüllt einen Teil der Aufmerksamkeit wirklichkeitsgemäß,
aber ästhetisch abtönend, und verstärkt dadurch die seelische Bereitschaft, eine wirk-
lichkeitsferne Scheinwelt auszubauen, sei es, daß ästhetische Bildfolgen aufgenom-
men werden, sei es, daß einer Filmerzählung gefolgt wird. Sobald die akustische
Begleitung, die als solche immer relativ wirklichkeitsnah wirkt, aber eng mit dem
Laufbild verbunden auftritt, bestimmte Geräusche zu bildlichen Vorgängen nach-
ahmt, ein Türenschlagen, ein Hämmern, Schüsse, gewinnt das Laufbild einen Cha-
rakter vorgetäuschter und doch selbstverständlich enttäuschend-unzureichender Wirk-
lichkeit, wie der Versuch eines Pantomimenersatzes, und verliert damit momentan
die Möglichkeit zu ästhetischen Eigenwerten der vorstehend beschriebenen Art.
Anders liegen die Verhältnisse beim Tonfilm, bei dem eine stete Parallele von
optischen und akustischen Eindrücken geboten wird. Bei einem parallelen Dar-
bieten von photographischen Laufbildern und den Laufbildern entsprechendem
Klang mit dem Aufmerksamkeitsakzent auf dem Optischen entsteht allerdings auch
im vollparallelen Tonfilm eine Wirkung, die den Schein als vorgetäuschte Wirklich-
keit aufzufassen antreibt und bei der notwendigerweise unzureichenden Wirklich-
keitswirkung der Leinwandbilder immer wieder enttäuscht und durch dieses stete
Mißverhältnis in der Wirkung eine unmittelbare ästhetische Wertigkeit ausschließt,
und der Gegensatz zwischen Wirkungsanspruch und Wirkungserfolg tritt beim Ton-
film um so schärfer hervor, als hier die Klangwiedergabe, sei sie im einzelnen noch
so fehlerhaft, im großen ganzen der Klangbildung in der Wirklichkeit realistisch
entspricht, daher vorhaltend täuschend-real wirkt, während das monokulare photo-
graphische Bild bei aller momentan täuschenden Bewegtheit hier wie immer un-
abänderlich an die Fläche gebunden, daher in seiner Wirkung mehr oder weniger
unkörperlich-irreal bleibt. Es kann aber im vollparallelen Tonspielfilm die Aufmerk-
samkeit vorzugsweise an das Akustische gefesselt werden und das Akustische,
ähnlich dem Optischen in guten stummen Spielfilmen, zu einer symbolgemäßen
Auswertung gebracht werden, so daß die Tonfolge subjektiv entwirklicht und die
photographische Bildfolge ihr untergeordnet wird. Auf diese Weise wird jenseits
der unmittelbaren Eindrücke eine Kunstwirkung erreicht, unter der die Diskrepanz
der sinnlichen Mittel mehr oder weniger vergessen wird. Immerhin ist die Kunst-
wirkung des Tonspielfilms um so reiner, je geringer die sinnliche Diskrepanz auch
an sich erscheint und je schärfer die Spannung an dem Bedeutungssinn der Ein-
drücke, dem erzählten Geschehen ist. Daher geben Fernaufnahmen, durch die rela-
tiv größere Wirklichkeitsnähe des Optischen und die geringere spezifische Bild-
265
lieh, symbolgemäß auswerten. Ein Gleiches ist vielleicht auch in dem schon erwähn-
ten gut erzählten „Kampf der Tertia" mitwirksam gewesen. Alle rein bildhaft wir-
kenden Teile eines Spielfilms liegen außerhalb seiner ästhetischen Eigengestalt.
Gelingt es, diese Teile dem Spannungszug der Erzählung immerhin einzugliedern,
so wirken sie gleich Illustrationen in einem Buch. Gelingt dies nicht, so wird der
Film an diesen Stellen langweilig. So geht die ästhetische Filmspannung im all-
gemeinen verloren, wenn Landschaftsbilder als reine Landschaftsbilder wirksam
werden. Sie geht immer verloren, wenn durch einen der Eigenbewegung eines Schau-
enden in der Wirklichkeit entsprechenden schnell-allmählichen Wechsel des Auf-
nahme-Standortes eine momentane relativ größere Wirklichkeitsnähe des Bildes
erreicht wird, so insbesondere bei Erregung von Schwiiidelempfindungen.
Aus diesen Einsichten in eine biidjenseitige Spielwelt und Scheinwirklichkeit des
ästhetisch wertigen Spielfilms und immer im Grund wirklichkeitsferne Eigen weit
aller stummen Filmkunst ist auch die Bedeutung der akustischen Beigaben zu stum-
men Filmvorführungen zu werten. Die freie Begleitmusik, wie sie beim stummen
Film üblich geworden ist, erfüllt einen Teil der Aufmerksamkeit wirklichkeitsgemäß,
aber ästhetisch abtönend, und verstärkt dadurch die seelische Bereitschaft, eine wirk-
lichkeitsferne Scheinwelt auszubauen, sei es, daß ästhetische Bildfolgen aufgenom-
men werden, sei es, daß einer Filmerzählung gefolgt wird. Sobald die akustische
Begleitung, die als solche immer relativ wirklichkeitsnah wirkt, aber eng mit dem
Laufbild verbunden auftritt, bestimmte Geräusche zu bildlichen Vorgängen nach-
ahmt, ein Türenschlagen, ein Hämmern, Schüsse, gewinnt das Laufbild einen Cha-
rakter vorgetäuschter und doch selbstverständlich enttäuschend-unzureichender Wirk-
lichkeit, wie der Versuch eines Pantomimenersatzes, und verliert damit momentan
die Möglichkeit zu ästhetischen Eigenwerten der vorstehend beschriebenen Art.
Anders liegen die Verhältnisse beim Tonfilm, bei dem eine stete Parallele von
optischen und akustischen Eindrücken geboten wird. Bei einem parallelen Dar-
bieten von photographischen Laufbildern und den Laufbildern entsprechendem
Klang mit dem Aufmerksamkeitsakzent auf dem Optischen entsteht allerdings auch
im vollparallelen Tonfilm eine Wirkung, die den Schein als vorgetäuschte Wirklich-
keit aufzufassen antreibt und bei der notwendigerweise unzureichenden Wirklich-
keitswirkung der Leinwandbilder immer wieder enttäuscht und durch dieses stete
Mißverhältnis in der Wirkung eine unmittelbare ästhetische Wertigkeit ausschließt,
und der Gegensatz zwischen Wirkungsanspruch und Wirkungserfolg tritt beim Ton-
film um so schärfer hervor, als hier die Klangwiedergabe, sei sie im einzelnen noch
so fehlerhaft, im großen ganzen der Klangbildung in der Wirklichkeit realistisch
entspricht, daher vorhaltend täuschend-real wirkt, während das monokulare photo-
graphische Bild bei aller momentan täuschenden Bewegtheit hier wie immer un-
abänderlich an die Fläche gebunden, daher in seiner Wirkung mehr oder weniger
unkörperlich-irreal bleibt. Es kann aber im vollparallelen Tonspielfilm die Aufmerk-
samkeit vorzugsweise an das Akustische gefesselt werden und das Akustische,
ähnlich dem Optischen in guten stummen Spielfilmen, zu einer symbolgemäßen
Auswertung gebracht werden, so daß die Tonfolge subjektiv entwirklicht und die
photographische Bildfolge ihr untergeordnet wird. Auf diese Weise wird jenseits
der unmittelbaren Eindrücke eine Kunstwirkung erreicht, unter der die Diskrepanz
der sinnlichen Mittel mehr oder weniger vergessen wird. Immerhin ist die Kunst-
wirkung des Tonspielfilms um so reiner, je geringer die sinnliche Diskrepanz auch
an sich erscheint und je schärfer die Spannung an dem Bedeutungssinn der Ein-
drücke, dem erzählten Geschehen ist. Daher geben Fernaufnahmen, durch die rela-
tiv größere Wirklichkeitsnähe des Optischen und die geringere spezifische Bild-