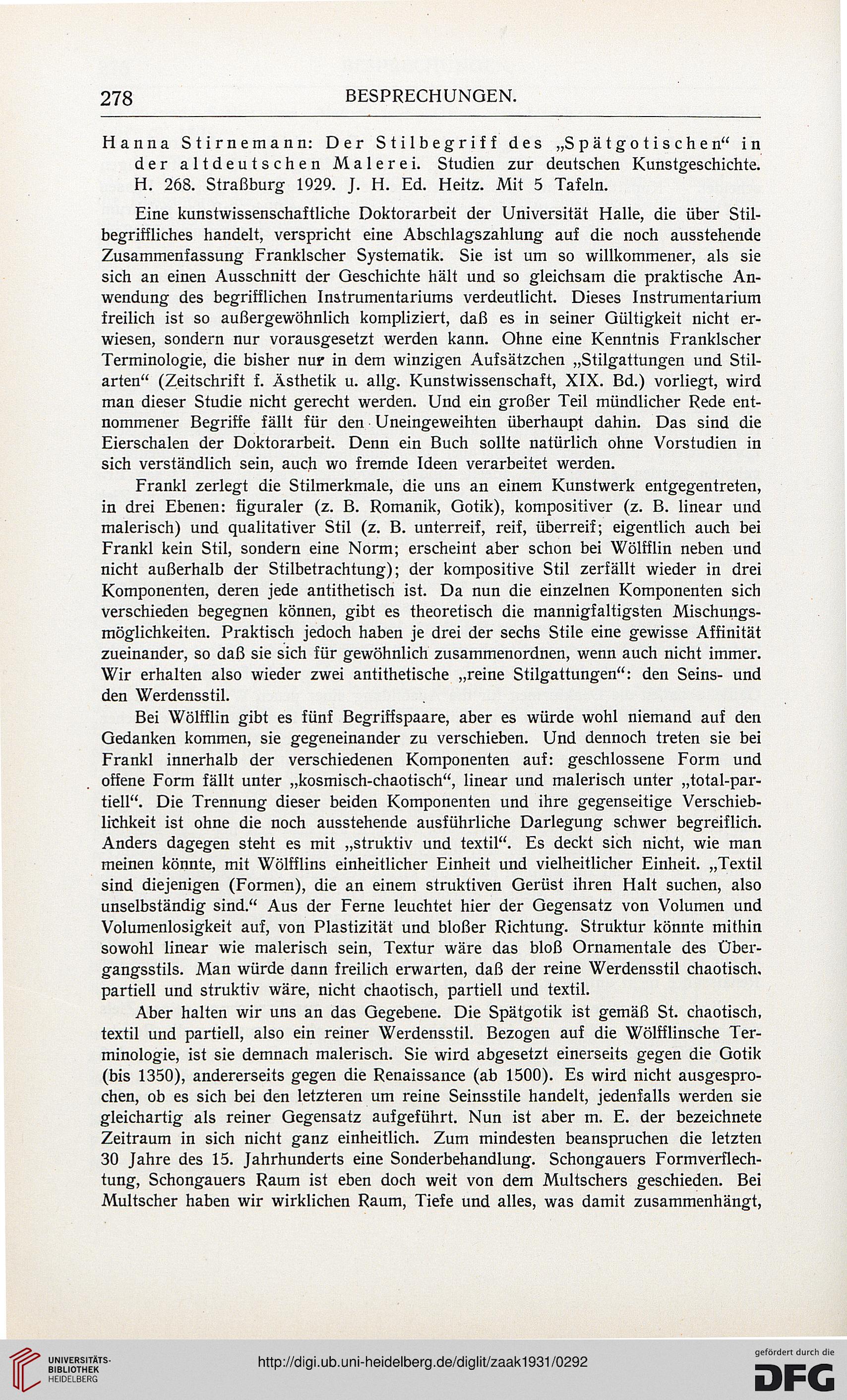278
BESPRECHUNGEN.
Hanna Stirnemann: Der Stilbegriff des „Spätgotischen" in
der altdeutschen Malerei. Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
H. 268. Straßburg 1929. J. H. Ed. Heitz. Mit 5 Tafeln.
Eine kunstwissenschaftliche Doktorarbeit der Universität Halle, die über Stil-
begriffliches handelt, verspricht eine Abschlagszahlung auf die noch ausstehende
Zusammenfassung Frankischer Systematik. Sie ist um so willkommener, als sie
sich an einen Ausschnitt der Geschichte hält und so gleichsam die praktische An-
wendung des begrifflichen Instrumentariums verdeutlicht. Dieses Instrumentarium
freilich ist so außergewöhnlich kompliziert, daß es in seiner Gültigkeit nicht er-
wiesen, sondern nur vorausgesetzt werden kann. Ohne eine Kenntnis Frankischer
Terminologie, die bisher nur in dem winzigen Aufsätzchen „Stilgattungen und Stil-
arten" (Zeitschrift f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft, XIX. Bd.) vorliegt, wird
man dieser Studie nicht gerecht werden. Und ein großer Teil mündlicher Rede ent-
nommener Begriffe fällt für den Uneingeweihten überhaupt dahin. Das sind die
Eierschalen der Doktorarbeit. Denn ein Buch sollte natürlich ohne Vorstudien in
sich verständlich sein, auch wo fremde Ideen verarbeitet werden.
Frankl zerlegt die Stilmerkmale, die uns an einem Kunstwerk entgegentreten,
in drei Ebenen: figuraler (z. B. Romanik, Gotik), kompositiver (z. B. linear und
malerisch) und qualitativer Stil (z. B. unterreif, reif, überreif; eigentlich auch bei
Frankl kein Stil, sondern eine Norm; erscheint aber schon bei Wölfflin neben und
nicht außerhalb der Stilbetrachtung); der kompositive Stil zerfällt wieder in drei
Komponenten, deren jede antithetisch ist. Da nun die einzelnen Komponenten sich
verschieden begegnen können, gibt es theoretisch die mannigfaltigsten Mischungs-
möglichkeiten. Praktisch jedoch haben je drei der sechs Stile eine gewisse Affinität
zueinander, so daß sie sich für gewöhnlich zusammenordnen, wenn auch nicht immer.
Wir erhalten also wieder zwei antithetische „reine Stilgattungen": den Seins- und
den Werdensstil.
Bei Wölfflin gibt es fünf Begriffspaare, aber es würde wohl niemand auf den
Gedanken kommen, sie gegeneinander zu verschieben. Und dennoch treten sie bei
Frankl innerhalb der verschiedenen Komponenten auf: geschlossene Form und
offene Form fällt unter „kosmisch-chaotisch", linear und malerisch unter „total-par-
tiell". Die Trennung dieser beiden Komponenten und ihre gegenseitige Verschieb-
lichkeit ist ohne die noch ausstehende ausführliche Darlegung schwer begreiflich.
Anders dagegen steht es mit „struktiv und textil". Es deckt sich nicht, wie man
meinen könnte, mit Wölfflins einheitlicher Einheit und vielheitlicher Einheit. „Textil
sind diejenigen (Formen), die an einem struktiven Gerüst ihren Halt suchen, also
unselbständig sind." Aus der Ferne leuchtet hier der Gegensatz von Volumen und
Volumenlosigkeit auf, von Plastizität und bloßer Richtung. Struktur könnte mithin
sowohl linear wie malerisch sein, Textur wäre das bloß Ornamentale des Über-
gangsstils. Man würde dann freilich erwarten, daß der reine Werdensstil chaotisch,
partiell und struktiv wäre, nicht chaotisch, partiell und textil.
Aber halten wir uns an das Gegebene. Die Spätgotik ist gemäß St. chaotisch,
textil und partiell, also ein reiner Werdensstil. Bezogen auf die Wölfflinsche Ter-
minologie, ist sie demnach malerisch. Sie wird abgesetzt einerseits gegen die Gotik
(bis 1350), andererseits gegen die Renaissance (ab 1500). Es wird nicht ausgespro-
chen, ob es sich bei den letzteren um reine Seinsstile handelt, jedenfalls werden sie
gleichartig als reiner Gegensatz aufgeführt. Nun ist aber m. E. der bezeichnete
Zeitraum in sich nicht ganz einheitlich. Zum mindesten beanspruchen die letzten
30 Jahre des 15. Jahrhunderts eine Sonderbehandlung. Schongauers Formverflech-
tung, Schongauers Raum ist eben doch weit von dem Multschers geschieden. Bei
Multscher haben wir wirklichen Raum, Tiefe und alles, was damit zusammenhängt,
BESPRECHUNGEN.
Hanna Stirnemann: Der Stilbegriff des „Spätgotischen" in
der altdeutschen Malerei. Studien zur deutschen Kunstgeschichte.
H. 268. Straßburg 1929. J. H. Ed. Heitz. Mit 5 Tafeln.
Eine kunstwissenschaftliche Doktorarbeit der Universität Halle, die über Stil-
begriffliches handelt, verspricht eine Abschlagszahlung auf die noch ausstehende
Zusammenfassung Frankischer Systematik. Sie ist um so willkommener, als sie
sich an einen Ausschnitt der Geschichte hält und so gleichsam die praktische An-
wendung des begrifflichen Instrumentariums verdeutlicht. Dieses Instrumentarium
freilich ist so außergewöhnlich kompliziert, daß es in seiner Gültigkeit nicht er-
wiesen, sondern nur vorausgesetzt werden kann. Ohne eine Kenntnis Frankischer
Terminologie, die bisher nur in dem winzigen Aufsätzchen „Stilgattungen und Stil-
arten" (Zeitschrift f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft, XIX. Bd.) vorliegt, wird
man dieser Studie nicht gerecht werden. Und ein großer Teil mündlicher Rede ent-
nommener Begriffe fällt für den Uneingeweihten überhaupt dahin. Das sind die
Eierschalen der Doktorarbeit. Denn ein Buch sollte natürlich ohne Vorstudien in
sich verständlich sein, auch wo fremde Ideen verarbeitet werden.
Frankl zerlegt die Stilmerkmale, die uns an einem Kunstwerk entgegentreten,
in drei Ebenen: figuraler (z. B. Romanik, Gotik), kompositiver (z. B. linear und
malerisch) und qualitativer Stil (z. B. unterreif, reif, überreif; eigentlich auch bei
Frankl kein Stil, sondern eine Norm; erscheint aber schon bei Wölfflin neben und
nicht außerhalb der Stilbetrachtung); der kompositive Stil zerfällt wieder in drei
Komponenten, deren jede antithetisch ist. Da nun die einzelnen Komponenten sich
verschieden begegnen können, gibt es theoretisch die mannigfaltigsten Mischungs-
möglichkeiten. Praktisch jedoch haben je drei der sechs Stile eine gewisse Affinität
zueinander, so daß sie sich für gewöhnlich zusammenordnen, wenn auch nicht immer.
Wir erhalten also wieder zwei antithetische „reine Stilgattungen": den Seins- und
den Werdensstil.
Bei Wölfflin gibt es fünf Begriffspaare, aber es würde wohl niemand auf den
Gedanken kommen, sie gegeneinander zu verschieben. Und dennoch treten sie bei
Frankl innerhalb der verschiedenen Komponenten auf: geschlossene Form und
offene Form fällt unter „kosmisch-chaotisch", linear und malerisch unter „total-par-
tiell". Die Trennung dieser beiden Komponenten und ihre gegenseitige Verschieb-
lichkeit ist ohne die noch ausstehende ausführliche Darlegung schwer begreiflich.
Anders dagegen steht es mit „struktiv und textil". Es deckt sich nicht, wie man
meinen könnte, mit Wölfflins einheitlicher Einheit und vielheitlicher Einheit. „Textil
sind diejenigen (Formen), die an einem struktiven Gerüst ihren Halt suchen, also
unselbständig sind." Aus der Ferne leuchtet hier der Gegensatz von Volumen und
Volumenlosigkeit auf, von Plastizität und bloßer Richtung. Struktur könnte mithin
sowohl linear wie malerisch sein, Textur wäre das bloß Ornamentale des Über-
gangsstils. Man würde dann freilich erwarten, daß der reine Werdensstil chaotisch,
partiell und struktiv wäre, nicht chaotisch, partiell und textil.
Aber halten wir uns an das Gegebene. Die Spätgotik ist gemäß St. chaotisch,
textil und partiell, also ein reiner Werdensstil. Bezogen auf die Wölfflinsche Ter-
minologie, ist sie demnach malerisch. Sie wird abgesetzt einerseits gegen die Gotik
(bis 1350), andererseits gegen die Renaissance (ab 1500). Es wird nicht ausgespro-
chen, ob es sich bei den letzteren um reine Seinsstile handelt, jedenfalls werden sie
gleichartig als reiner Gegensatz aufgeführt. Nun ist aber m. E. der bezeichnete
Zeitraum in sich nicht ganz einheitlich. Zum mindesten beanspruchen die letzten
30 Jahre des 15. Jahrhunderts eine Sonderbehandlung. Schongauers Formverflech-
tung, Schongauers Raum ist eben doch weit von dem Multschers geschieden. Bei
Multscher haben wir wirklichen Raum, Tiefe und alles, was damit zusammenhängt,