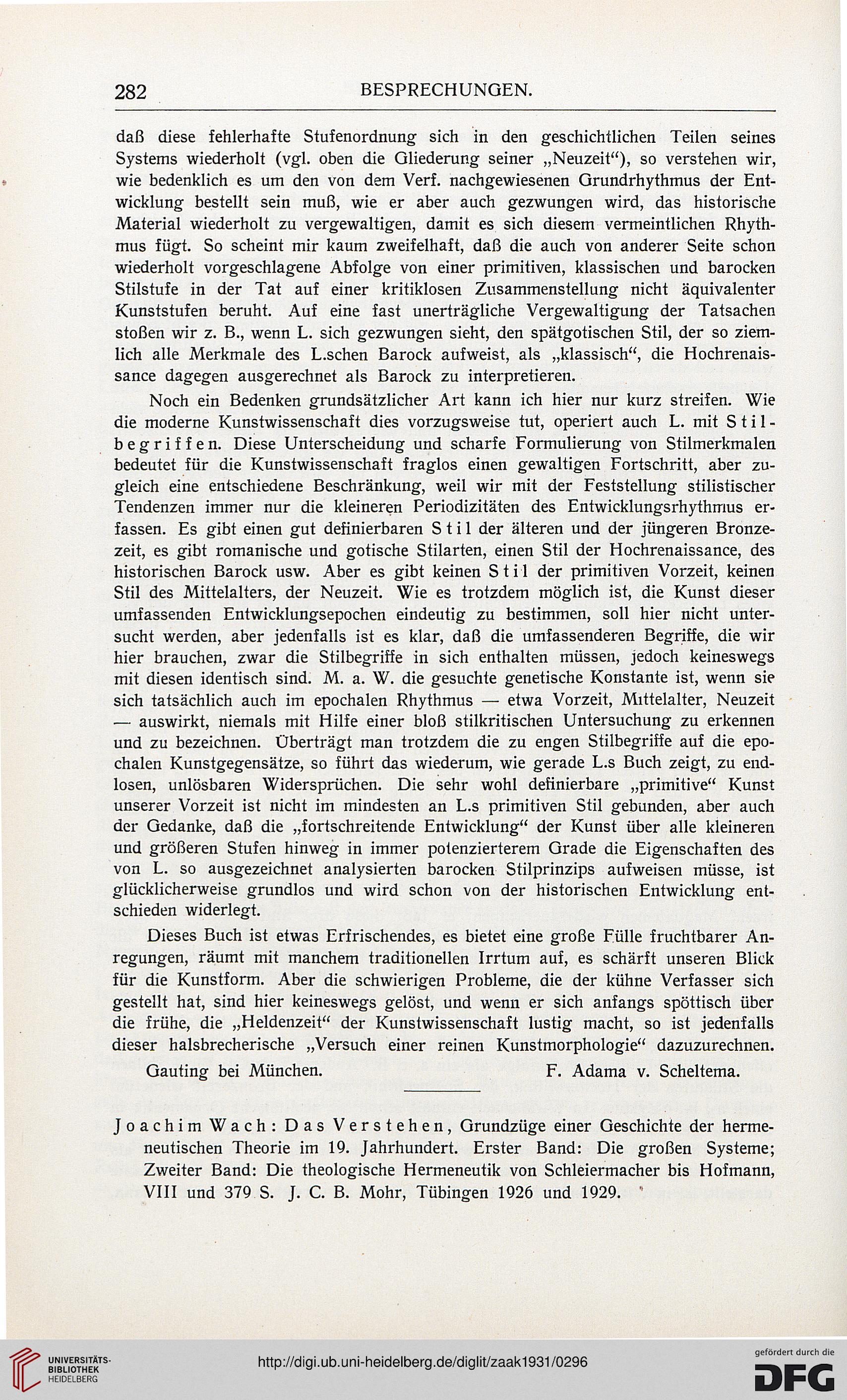282
BESPRECHUNGEN.
daß diese fehlerhafte Stufenordnung sich in den geschichtlichen Teilen seines
Systems wiederholt (vgl. oben die Gliederung seiner „Neuzeit"), so verstehen wir,
wie bedenklich es um den von dem Verf. nachgewiesenen Grundrhythmus der Ent-
wicklung bestellt sein muß, wie er aber auch gezwungen wird, das historische
Material wiederholt zu vergewaltigen, damit es sich diesem vermeintlichen Rhyth-
mus fügt. So scheint mir kaum zweifelhaft, daß die auch von anderer Seite schon
wiederholt vorgeschlagene Abfolge von einer primitiven, klassischen und barocken
Stilstufe in der Tat auf einer kritiklosen Zusammenstellung nicht äquivalenter
Kunststufen beruht. Auf eine fast unerträgliche Vergewaltigung der Tatsachen
stoßen wir z. B., wenn L. sich gezwungen sieht, den spätgotischen Stil, der so ziem-
lich alle Merkmale des L.sehen Barock aufweist, als „klassisch", die Hochrenais-
sance dagegen ausgerechnet als Barock zu interpretieren.
Noch ein Bedenken grundsätzlicher Art kann ich hier nur kurz streifen. Wie
die moderne Kunstwissenschaft dies vorzugsweise tut, operiert auch L. mit Stil-
begriffen. Diese Unterscheidung und scharfe Formulierung von Stilmerkmalen
bedeutet für die Kunstwissenschaft fraglos einen gewaltigen Fortschritt, aber zu-
gleich eine entschiedene Beschränkung, weil wir mit der Feststellung stilistischer
Tendenzen immer nur die kleineren Periodizitäten des Entwicklungsrhythmus er-
fassen. Es gibt einen gut definierbaren Stil der älteren und der jüngeren Bronze-
zeit, es gibt romanische und gotische Stilarten, einen Stil der Hochrenaissance, des
historischen Barock usw. Aber es gibt keinen Stil der primitiven Vorzeit, keinen
Stil des Mittelalters, der Neuzeit. Wie es trotzdem möglich ist, die Kunst dieser
umfassenden Entwicklungsepochen eindeutig zu bestimmen, soll hier nicht unter-
sucht werden, aber jedenfalls ist es klar, daß die umfassenderen Begriffe, die wir
hier brauchen, zwar die Stilbegriffe in sich enthalten müssen, jedoch keineswegs
mit diesen identisch sind. M. a. W. die gesuchte genetische Konstante ist, wenn sie
sich tatsächlich auch im epochalen Rhythmus — etwa Vorzeit, Mittelalter, Neuzeit
— auswirkt, niemals mit Hilfe einer bloß stilkritischen Untersuchung zu erkennen
und zu bezeichnen. Überträgt man trotzdem die zu engen Stilbegriffe auf die epo-
chalen Kunstgegensätze, so führt das wiederum, wie gerade L.s Buch zeigt, zu end-
losen, unlösbaren Widersprüchen. Die sehr wohl definierbare „primitive" Kunst
unserer Vorzeit ist nicht im mindesten an L.s primitiven Stil gebunden, aber auch
der Gedanke, daß die „fortschreitende Entwicklung" der Kunst über alle kleineren
und größeren Stufen hinweg in immer potenzierterem Grade die Eigenschaften des
von L. so ausgezeichnet analysierten barocken Stilprinzips aufweisen müsse, ist
glücklicherweise grundlos und wird schon von der historischen Entwicklung ent-
schieden widerlegt.
Dieses Buch ist etwas Erfrischendes, es bietet eine große Fülle fruchtbarer An-
regungen, räumt mit manchem traditionellen Irrtum auf, es schärft unseren Blick
für die Kunstform. Aber die schwierigen Probleme, die der kühne Verfasser sich
gestellt hat, sind hier keineswegs gelöst, und wenn er sich anfangs spöttisch über
die frühe, die „Heldenzeit" der Kunstwissenschaft lustig macht, so ist jedenfalls
dieser halsbrecherische „Versuch einer reinen Kunstmorphologie" dazuzurechnen.
Gauting bei München. F. Adama v. Scheltema.
Joachim Wach: Das Verstehen, Grundzüge einer Geschichte der herme-
neutischen Theorie im 19. Jahrhundert. Erster Band: Die großen Systeme;
Zweiter Band: Die theologische Hermeneutik von Schleiermacher bis Hofmann,
VIII und 379 S. J. C. B. Mohr, Tübingen 1926 und 1929. '
BESPRECHUNGEN.
daß diese fehlerhafte Stufenordnung sich in den geschichtlichen Teilen seines
Systems wiederholt (vgl. oben die Gliederung seiner „Neuzeit"), so verstehen wir,
wie bedenklich es um den von dem Verf. nachgewiesenen Grundrhythmus der Ent-
wicklung bestellt sein muß, wie er aber auch gezwungen wird, das historische
Material wiederholt zu vergewaltigen, damit es sich diesem vermeintlichen Rhyth-
mus fügt. So scheint mir kaum zweifelhaft, daß die auch von anderer Seite schon
wiederholt vorgeschlagene Abfolge von einer primitiven, klassischen und barocken
Stilstufe in der Tat auf einer kritiklosen Zusammenstellung nicht äquivalenter
Kunststufen beruht. Auf eine fast unerträgliche Vergewaltigung der Tatsachen
stoßen wir z. B., wenn L. sich gezwungen sieht, den spätgotischen Stil, der so ziem-
lich alle Merkmale des L.sehen Barock aufweist, als „klassisch", die Hochrenais-
sance dagegen ausgerechnet als Barock zu interpretieren.
Noch ein Bedenken grundsätzlicher Art kann ich hier nur kurz streifen. Wie
die moderne Kunstwissenschaft dies vorzugsweise tut, operiert auch L. mit Stil-
begriffen. Diese Unterscheidung und scharfe Formulierung von Stilmerkmalen
bedeutet für die Kunstwissenschaft fraglos einen gewaltigen Fortschritt, aber zu-
gleich eine entschiedene Beschränkung, weil wir mit der Feststellung stilistischer
Tendenzen immer nur die kleineren Periodizitäten des Entwicklungsrhythmus er-
fassen. Es gibt einen gut definierbaren Stil der älteren und der jüngeren Bronze-
zeit, es gibt romanische und gotische Stilarten, einen Stil der Hochrenaissance, des
historischen Barock usw. Aber es gibt keinen Stil der primitiven Vorzeit, keinen
Stil des Mittelalters, der Neuzeit. Wie es trotzdem möglich ist, die Kunst dieser
umfassenden Entwicklungsepochen eindeutig zu bestimmen, soll hier nicht unter-
sucht werden, aber jedenfalls ist es klar, daß die umfassenderen Begriffe, die wir
hier brauchen, zwar die Stilbegriffe in sich enthalten müssen, jedoch keineswegs
mit diesen identisch sind. M. a. W. die gesuchte genetische Konstante ist, wenn sie
sich tatsächlich auch im epochalen Rhythmus — etwa Vorzeit, Mittelalter, Neuzeit
— auswirkt, niemals mit Hilfe einer bloß stilkritischen Untersuchung zu erkennen
und zu bezeichnen. Überträgt man trotzdem die zu engen Stilbegriffe auf die epo-
chalen Kunstgegensätze, so führt das wiederum, wie gerade L.s Buch zeigt, zu end-
losen, unlösbaren Widersprüchen. Die sehr wohl definierbare „primitive" Kunst
unserer Vorzeit ist nicht im mindesten an L.s primitiven Stil gebunden, aber auch
der Gedanke, daß die „fortschreitende Entwicklung" der Kunst über alle kleineren
und größeren Stufen hinweg in immer potenzierterem Grade die Eigenschaften des
von L. so ausgezeichnet analysierten barocken Stilprinzips aufweisen müsse, ist
glücklicherweise grundlos und wird schon von der historischen Entwicklung ent-
schieden widerlegt.
Dieses Buch ist etwas Erfrischendes, es bietet eine große Fülle fruchtbarer An-
regungen, räumt mit manchem traditionellen Irrtum auf, es schärft unseren Blick
für die Kunstform. Aber die schwierigen Probleme, die der kühne Verfasser sich
gestellt hat, sind hier keineswegs gelöst, und wenn er sich anfangs spöttisch über
die frühe, die „Heldenzeit" der Kunstwissenschaft lustig macht, so ist jedenfalls
dieser halsbrecherische „Versuch einer reinen Kunstmorphologie" dazuzurechnen.
Gauting bei München. F. Adama v. Scheltema.
Joachim Wach: Das Verstehen, Grundzüge einer Geschichte der herme-
neutischen Theorie im 19. Jahrhundert. Erster Band: Die großen Systeme;
Zweiter Band: Die theologische Hermeneutik von Schleiermacher bis Hofmann,
VIII und 379 S. J. C. B. Mohr, Tübingen 1926 und 1929. '