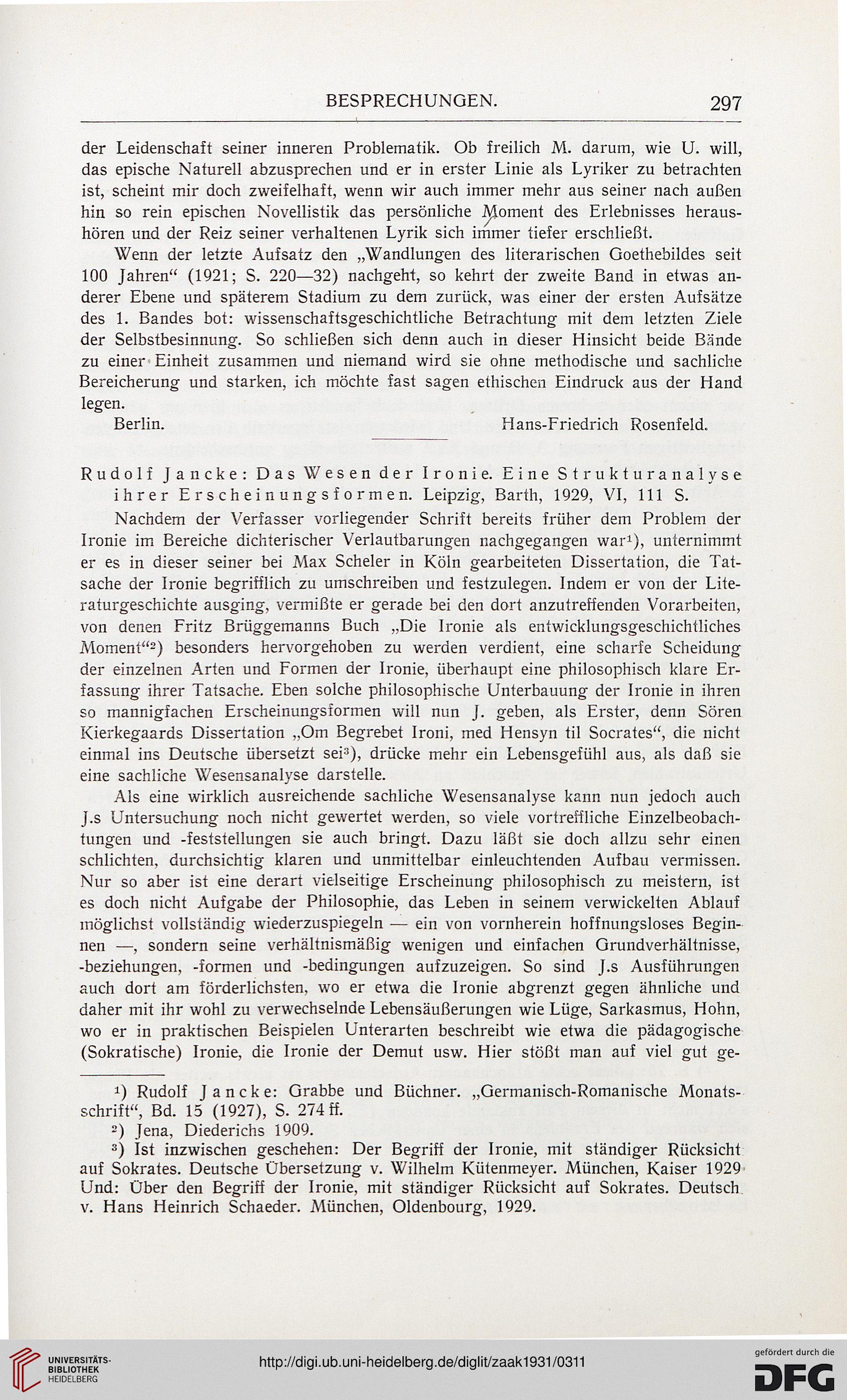BESPRECHUNGEN.
297
der Leidenschaft seiner inneren Problematik. Ob freilich M. darum, wie U. will,
das epische Naturell abzusprechen und er in erster Linie als Lyriker zu betrachten
ist, scheint mir doch zweifelhaft, wenn wir auch immer mehr aus seiner nach außen
hin so rein epischen Novellistik das persönliche Moment des Erlebnisses heraus-
hören und der Reiz seiner verhaltenen Lyrik sich immer tiefer erschließt.
Wenn der letzte Aufsatz den „Wandlungen des literarischen Goethebildes seit
100 Jahren" (1921; S. 220—32) nachgeht, so kehrt der zweite Band in etwas an-
derer Ebene und späterem Stadium zu dem zurück, was einer der ersten Aufsätze
des 1. Bandes bot: wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung mit dem letzten Ziele
der Selbstbesinnung. So schließen sich denn auch in dieser Hinsicht beide Bande
zu einer Einheit zusammen und niemand wird sie ohne methodische und sachliche
Bereicherung und starken, ich möchte fast sagen ethischen Eindruck aus der Hand
legen.
Berlin. Hans-Friedrich Rosenfeld.
Rudolf Jancke: Das Wesen der Ironie. Eine Strukturanalyse
ihrer Erscheinungsformen. Leipzig, Barth, 1929, VI, 111 S.
Nachdem der Verfasser vorliegender Schrift bereits früher dem Problem der
Ironie im Bereiche dichterischer Verlautbarungen nachgegangen war1), unternimmt
er es in dieser seiner bei Max Scheler in Köln gearbeiteten Dissertation, die Tat-
sache der Ironie begrifflich zu umschreiben und festzulegen. Indem er von der Lite-
raturgeschichte ausging, vermißte er gerade bei den dort anzutreffenden Vorarbeiten,
von denen Fritz Brüggemanns Buch „Die Ironie als entwicklungsgeschichtliches
Moment"2) besonders hervorgehoben zu werden verdient, eine scharfe Scheidung
der einzelnen Arten und Formen der Ironie, überhaupt eine philosophisch klare Er-
fassung ihrer Tatsache. Eben solche philosophische Unterbauung der Ironie in ihren
so mannigfachen Erscheinungsformen will nun J. geben, als Erster, denn Sören
Kierkegaards Dissertation „Om Begrebet Ironi, med Hensyn til Socrates", die nicht
einmal ins Deutsche übersetzt sei3), drücke mehr ein Lebensgefühl aus, als daß sie
eine sachliche Wesensanalyse darstelle.
Als eine wirklich ausreichende sachliche Wesensanalyse kann nun jedoch auch
J.s Untersuchung noch nicht gewertet werden, so viele vortreffliche Einzelbeobach-
tungen und -Feststellungen sie auch bringt. Dazu läßt sie doch allzu sehr einen
schlichten, durchsichtig klaren und unmittelbar einleuchtenden Aufbau vermissen.
Nur so aber ist eine derart vielseitige Erscheinung philosophisch zu meistern, ist
es doch nicht Aufgabe der Philosophie, das Leben in seinem verwickelten Ablauf
möglichst vollständig wiederzuspiegeln — ein von vornherein hoffnungsloses Begin-
nen —, sondern seine verhältnismäßig wenigen und einfachen Grundverhältnisse,
-beziehungen, -formen und -bedingungen aufzuzeigen. So sind J.s Ausführungen
auch dort am förderlichsten, wo er etwa die Ironie abgrenzt gegen ähnliche und
daher mit ihr wohl zu verwechselnde Lebensäußerungen wie Lüge, Sarkasmus, Hohn,
wo er in praktischen Beispielen Unterarten beschreibt wie etwa die pädagogische
(Sokratische) Ironie, die Ironie der Demut usw. Hier stößt man auf viel gut ge-
*) Rudolf Jancke: Grabbe und Büchner. „Germanisch-Romanische Monats-
schrift", Bd. 15 (1927), S. 274 ff.
-') Jena, Diederichs 1909.
3) Ist inzwischen geschehen: Der Begriff der Ironie, mit ständiger Rücksicht
auf Sokrates. Deutsche Obersetzung v. Wilhelm Kütenmeyer. München, Kaiser 1929
Und: Über den Begriff der Ironie, mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Deutsch
v. Hans Heinrich Schaeder. München, Oldenbourg, 1929.
297
der Leidenschaft seiner inneren Problematik. Ob freilich M. darum, wie U. will,
das epische Naturell abzusprechen und er in erster Linie als Lyriker zu betrachten
ist, scheint mir doch zweifelhaft, wenn wir auch immer mehr aus seiner nach außen
hin so rein epischen Novellistik das persönliche Moment des Erlebnisses heraus-
hören und der Reiz seiner verhaltenen Lyrik sich immer tiefer erschließt.
Wenn der letzte Aufsatz den „Wandlungen des literarischen Goethebildes seit
100 Jahren" (1921; S. 220—32) nachgeht, so kehrt der zweite Band in etwas an-
derer Ebene und späterem Stadium zu dem zurück, was einer der ersten Aufsätze
des 1. Bandes bot: wissenschaftsgeschichtliche Betrachtung mit dem letzten Ziele
der Selbstbesinnung. So schließen sich denn auch in dieser Hinsicht beide Bande
zu einer Einheit zusammen und niemand wird sie ohne methodische und sachliche
Bereicherung und starken, ich möchte fast sagen ethischen Eindruck aus der Hand
legen.
Berlin. Hans-Friedrich Rosenfeld.
Rudolf Jancke: Das Wesen der Ironie. Eine Strukturanalyse
ihrer Erscheinungsformen. Leipzig, Barth, 1929, VI, 111 S.
Nachdem der Verfasser vorliegender Schrift bereits früher dem Problem der
Ironie im Bereiche dichterischer Verlautbarungen nachgegangen war1), unternimmt
er es in dieser seiner bei Max Scheler in Köln gearbeiteten Dissertation, die Tat-
sache der Ironie begrifflich zu umschreiben und festzulegen. Indem er von der Lite-
raturgeschichte ausging, vermißte er gerade bei den dort anzutreffenden Vorarbeiten,
von denen Fritz Brüggemanns Buch „Die Ironie als entwicklungsgeschichtliches
Moment"2) besonders hervorgehoben zu werden verdient, eine scharfe Scheidung
der einzelnen Arten und Formen der Ironie, überhaupt eine philosophisch klare Er-
fassung ihrer Tatsache. Eben solche philosophische Unterbauung der Ironie in ihren
so mannigfachen Erscheinungsformen will nun J. geben, als Erster, denn Sören
Kierkegaards Dissertation „Om Begrebet Ironi, med Hensyn til Socrates", die nicht
einmal ins Deutsche übersetzt sei3), drücke mehr ein Lebensgefühl aus, als daß sie
eine sachliche Wesensanalyse darstelle.
Als eine wirklich ausreichende sachliche Wesensanalyse kann nun jedoch auch
J.s Untersuchung noch nicht gewertet werden, so viele vortreffliche Einzelbeobach-
tungen und -Feststellungen sie auch bringt. Dazu läßt sie doch allzu sehr einen
schlichten, durchsichtig klaren und unmittelbar einleuchtenden Aufbau vermissen.
Nur so aber ist eine derart vielseitige Erscheinung philosophisch zu meistern, ist
es doch nicht Aufgabe der Philosophie, das Leben in seinem verwickelten Ablauf
möglichst vollständig wiederzuspiegeln — ein von vornherein hoffnungsloses Begin-
nen —, sondern seine verhältnismäßig wenigen und einfachen Grundverhältnisse,
-beziehungen, -formen und -bedingungen aufzuzeigen. So sind J.s Ausführungen
auch dort am förderlichsten, wo er etwa die Ironie abgrenzt gegen ähnliche und
daher mit ihr wohl zu verwechselnde Lebensäußerungen wie Lüge, Sarkasmus, Hohn,
wo er in praktischen Beispielen Unterarten beschreibt wie etwa die pädagogische
(Sokratische) Ironie, die Ironie der Demut usw. Hier stößt man auf viel gut ge-
*) Rudolf Jancke: Grabbe und Büchner. „Germanisch-Romanische Monats-
schrift", Bd. 15 (1927), S. 274 ff.
-') Jena, Diederichs 1909.
3) Ist inzwischen geschehen: Der Begriff der Ironie, mit ständiger Rücksicht
auf Sokrates. Deutsche Obersetzung v. Wilhelm Kütenmeyer. München, Kaiser 1929
Und: Über den Begriff der Ironie, mit ständiger Rücksicht auf Sokrates. Deutsch
v. Hans Heinrich Schaeder. München, Oldenbourg, 1929.