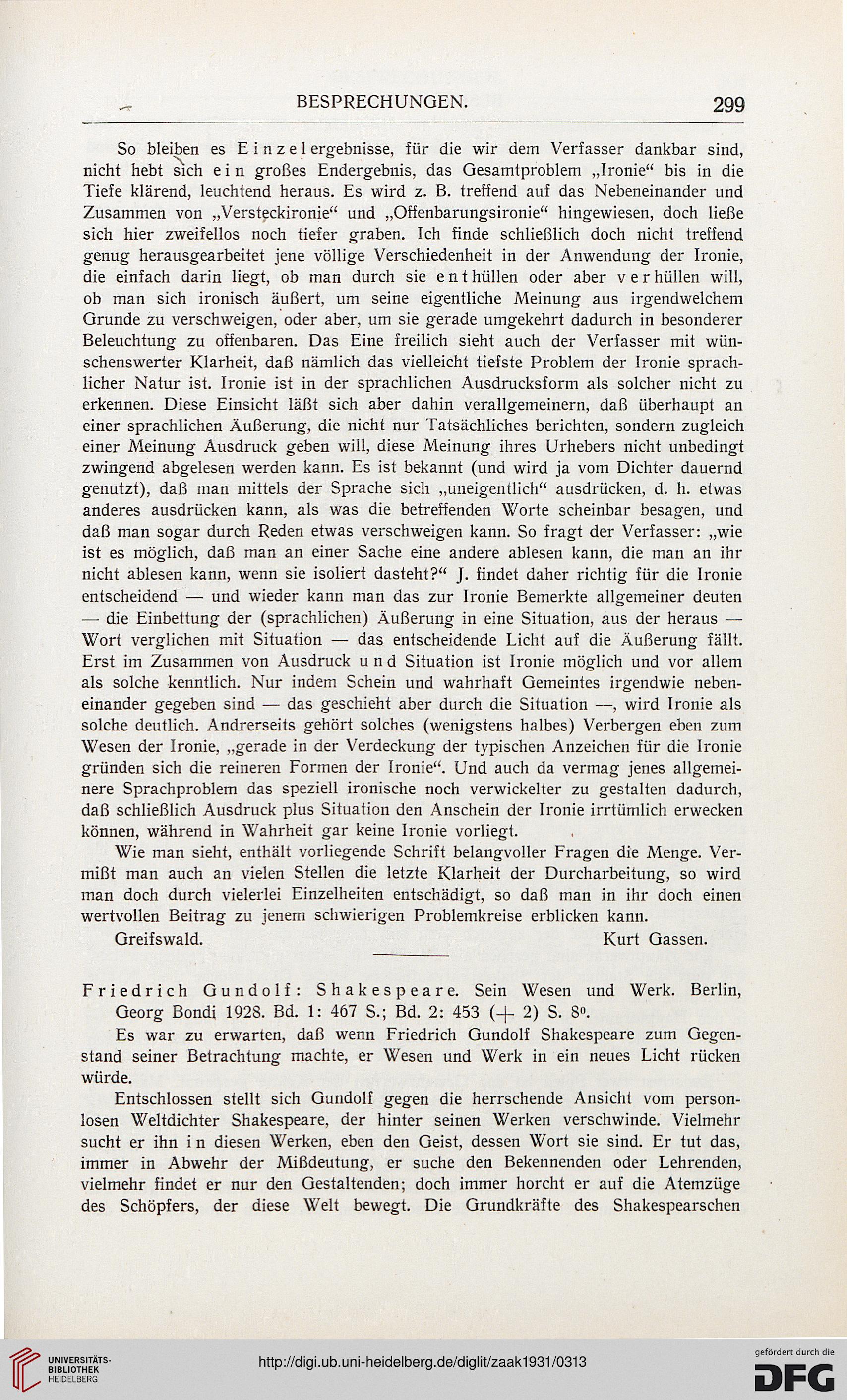BESPRECHUNGEN.
299
So bleiben es Einzel ergebnisse, für die wir dem Verfasser dankbar sind,
nicht hebt sich e i n großes Endergebnis, das Gesamtproblem „Ironie" bis in die
Tiefe klärend, leuchtend heraus. Es wird z. B. treffend auf das Nebeneinander und
Zusammen von „Versteckironie" und „Offenbarungsironie" hingewiesen, doch ließe
sich hier zweifellos noch tiefer graben. Ich finde schließlich doch nicht treffend
genug herausgearbeitet jene völlige Verschiedenheit in der Anwendung der Ironie,
die einfach darin liegt, ob man durch sie e n t hüllen oder aber v e r hüllen will,
ob man sich ironisch äußert, um seine eigentliche Meinung aus irgendwelchem
Grunde zu verschweigen, oder aber, um sie gerade umgekehrt dadurch in besonderer
Beleuchtung zu offenbaren. Das Eine freilich sieht auch der Verfasser mit wün-
schenswerter Klarheit, daß nämlich das vielleicht tiefste Problem der Ironie sprach-
licher Natur ist. Ironie ist in der sprachlichen Ausdrucksform als solcher nicht zu
erkennen. Diese Einsicht läßt sich aber dahin verallgemeinern, daß überhaupt an
einer sprachlichen Äußerung, die nicht nur Tatsächliches berichten, sondern zugleich
einer Meinung Ausdruck geben will, diese Meinung ihres Urhebers nicht unbedingt
zwingend abgelesen werden kann. Es ist bekannt (und wird ja vom Dichter dauernd
genutzt), daß man mittels der Sprache sich „uneigentlich" ausdrücken, d. h. etwas
anderes ausdrücken kann, als was die betreffenden Worte scheinbar besagen, und
daß man sogar durch Reden etwas verschweigen kann. So fragt der Verfasser: „wie
ist es möglich, daß man an einer Sache eine andere ablesen kann, die man an ihr
nicht ablesen kann, wenn sie isoliert dasteht?" J. findet daher richtig für die Ironie
entscheidend — und wieder kann man das zur Ironie Bemerkte allgemeiner deuten
— die Einbettung der (sprachlichen) Äußerung in eine Situation, aus der heraus —
Wort verglichen mit Situation — das entscheidende Licht auf die Äußerung fällt.
Erst im Zusammen von Ausdruck und Situation ist Ironie möglich und vor allem
als solche kenntlich. Nur indem Schein und wahrhaft Gemeintes irgendwie neben-
einander gegeben sind — das geschieht aber durch die Situation —, wird Ironie als
solche deutlich. Andrerseits gehört solches (wenigstens halbes) Verbergen eben zum
Wesen der Ironie, „gerade in der Verdeckung der typischen Anzeichen für die Ironie
gründen sich die reineren Formen der Ironie". Und auch da vermag jenes allgemei-
nere Sprachproblem das speziell ironische noch verwickelter zu gestalten dadurch,
daß schließlich Ausdruck plus Situation den Anschein der Ironie irrtümlich erwecken
können, während in Wahrheit gar keine Ironie vorliegt.
Wie man sieht, enthält vorliegende Schrift belangvoller Fragen die Menge. Ver-
mißt man auch an vielen Stellen die letzte Klarheit der Durcharbeitung, so wird
man doch durch vielerlei Einzelheiten entschädigt, so daß man in ihr doch einen
wertvollen Beitrag zu jenem schwierigen Problemkreise erblicken kann.
Greifswald. Kurt Gassen.
Friedrich Gundolf: Shakespeare. Sein Wesen und Werk. Berlin,
Georg Bondi 1928. Bd. 1: 467 S.; Bd. 2: 453 (+ 2) S. 8".
Es war zu erwarten, daß wenn Friedrich Gundolf Shakespeare zum Gegen-
stand seiner Betrachtung machte, er Wesen und Werk in ein neues Licht rücken
würde.
Entschlossen stellt sich Gundolf gegen die herrschende Ansicht vom person-
losen Weltdichter Shakespeare, der hinter seinen Werken verschwinde. Vielmehr
sucht er ihn i n diesen Werken, eben den Geist, dessen Wort sie sind. Er tut das,
immer in Abwehr der Mißdeutung, er suche den Bekennenden oder Lehrenden,
vielmehr findet er nur den Gestaltenden; doch immer horcht er auf die Atemzüge
des Schöpfers, der diese Welt bewegt. Die Grundkräfte des Shakespearschen
299
So bleiben es Einzel ergebnisse, für die wir dem Verfasser dankbar sind,
nicht hebt sich e i n großes Endergebnis, das Gesamtproblem „Ironie" bis in die
Tiefe klärend, leuchtend heraus. Es wird z. B. treffend auf das Nebeneinander und
Zusammen von „Versteckironie" und „Offenbarungsironie" hingewiesen, doch ließe
sich hier zweifellos noch tiefer graben. Ich finde schließlich doch nicht treffend
genug herausgearbeitet jene völlige Verschiedenheit in der Anwendung der Ironie,
die einfach darin liegt, ob man durch sie e n t hüllen oder aber v e r hüllen will,
ob man sich ironisch äußert, um seine eigentliche Meinung aus irgendwelchem
Grunde zu verschweigen, oder aber, um sie gerade umgekehrt dadurch in besonderer
Beleuchtung zu offenbaren. Das Eine freilich sieht auch der Verfasser mit wün-
schenswerter Klarheit, daß nämlich das vielleicht tiefste Problem der Ironie sprach-
licher Natur ist. Ironie ist in der sprachlichen Ausdrucksform als solcher nicht zu
erkennen. Diese Einsicht läßt sich aber dahin verallgemeinern, daß überhaupt an
einer sprachlichen Äußerung, die nicht nur Tatsächliches berichten, sondern zugleich
einer Meinung Ausdruck geben will, diese Meinung ihres Urhebers nicht unbedingt
zwingend abgelesen werden kann. Es ist bekannt (und wird ja vom Dichter dauernd
genutzt), daß man mittels der Sprache sich „uneigentlich" ausdrücken, d. h. etwas
anderes ausdrücken kann, als was die betreffenden Worte scheinbar besagen, und
daß man sogar durch Reden etwas verschweigen kann. So fragt der Verfasser: „wie
ist es möglich, daß man an einer Sache eine andere ablesen kann, die man an ihr
nicht ablesen kann, wenn sie isoliert dasteht?" J. findet daher richtig für die Ironie
entscheidend — und wieder kann man das zur Ironie Bemerkte allgemeiner deuten
— die Einbettung der (sprachlichen) Äußerung in eine Situation, aus der heraus —
Wort verglichen mit Situation — das entscheidende Licht auf die Äußerung fällt.
Erst im Zusammen von Ausdruck und Situation ist Ironie möglich und vor allem
als solche kenntlich. Nur indem Schein und wahrhaft Gemeintes irgendwie neben-
einander gegeben sind — das geschieht aber durch die Situation —, wird Ironie als
solche deutlich. Andrerseits gehört solches (wenigstens halbes) Verbergen eben zum
Wesen der Ironie, „gerade in der Verdeckung der typischen Anzeichen für die Ironie
gründen sich die reineren Formen der Ironie". Und auch da vermag jenes allgemei-
nere Sprachproblem das speziell ironische noch verwickelter zu gestalten dadurch,
daß schließlich Ausdruck plus Situation den Anschein der Ironie irrtümlich erwecken
können, während in Wahrheit gar keine Ironie vorliegt.
Wie man sieht, enthält vorliegende Schrift belangvoller Fragen die Menge. Ver-
mißt man auch an vielen Stellen die letzte Klarheit der Durcharbeitung, so wird
man doch durch vielerlei Einzelheiten entschädigt, so daß man in ihr doch einen
wertvollen Beitrag zu jenem schwierigen Problemkreise erblicken kann.
Greifswald. Kurt Gassen.
Friedrich Gundolf: Shakespeare. Sein Wesen und Werk. Berlin,
Georg Bondi 1928. Bd. 1: 467 S.; Bd. 2: 453 (+ 2) S. 8".
Es war zu erwarten, daß wenn Friedrich Gundolf Shakespeare zum Gegen-
stand seiner Betrachtung machte, er Wesen und Werk in ein neues Licht rücken
würde.
Entschlossen stellt sich Gundolf gegen die herrschende Ansicht vom person-
losen Weltdichter Shakespeare, der hinter seinen Werken verschwinde. Vielmehr
sucht er ihn i n diesen Werken, eben den Geist, dessen Wort sie sind. Er tut das,
immer in Abwehr der Mißdeutung, er suche den Bekennenden oder Lehrenden,
vielmehr findet er nur den Gestaltenden; doch immer horcht er auf die Atemzüge
des Schöpfers, der diese Welt bewegt. Die Grundkräfte des Shakespearschen