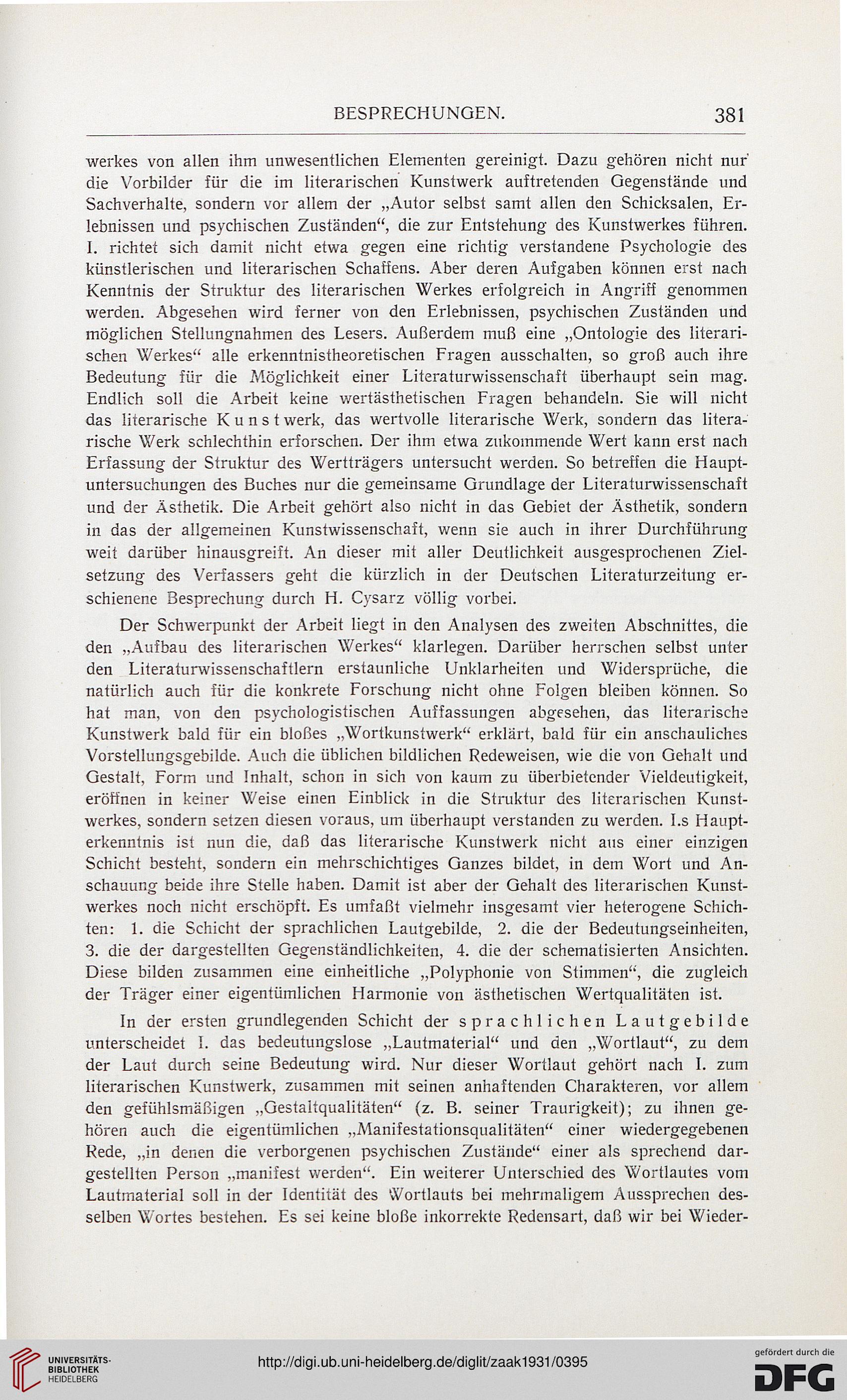BESPRECHUNGEN.
381
Werkes von allen ihm unwesentlichen Elementen gereinigt. Dazu gehören nicht nur'
die Vorbilder für die im literarischen Kunstwerk auftretenden Gegenstände und
Sachverhalte, sondern vor allem der „Autor selbst samt allen den Schicksalen, Er-
lebnissen und psychischen Zuständen", die zur Entstehung des Kunstwerkes führen.
I. richtet sich damit nicht etwa gegen eine richtig verstandene Psychologie des
künstlerischen und literarischen Schaffens. Aber deren Aufgaben können erst nach
Kenntnis der Struktur des literarischen Werkes erfolgreich in Angriff genommen
werden. Abgesehen wird ferner von den Erlebnissen, psychischen Zuständen und
möglichen Stellungnahmen des Lesers. Außerdem muß eine „Ontologie des literari-
schen Werkes" alle erkenntnistheoretischen Fragen ausschalten, so groß auch ihre
Bedeutung für die Möglichkeit einer Literaturwissenschaft überhaupt sein mag.
Endlich soll die Arbeit keine wertästhetischen Fragen behandeln. Sie will nicht
das literarische Kunst werk, das wertvolle literarische Werk, sondern das litera-
rische Werk schlechthin erforschen. Der ihm etwa zukommende Wert kann erst nach
Erfassung der Struktur des Wertträgers untersucht werden. So betreffen die Haupt-
untersuchungen des Buches nur die gemeinsame Grundlage der Literaturwissenschaft
und der Ästhetik. Die Arbeit gehört also nicht in das Gebiet der Ästhetik, sondern
in das der allgemeinen Kunstwissenschaft, wenn sie auch in ihrer Durchführung
weit darüber hinausgreift. An dieser mit aller Deutlichkeit ausgesprochenen Ziel-
setzung des Verfassers geht die kürzlich in der Deutschen Literaturzeitung er-
schienene Besprechung durch H. Cysarz völlig vorbei.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Analysen des zweiten Abschnittes, die
den „Aufbau des literarischen Werkes" klarlegen. Darüber herrschen selbst unter
den Literaturwissenschaftlern erstaunliche Unklarheiten und Widersprüche, die
natürlich auch für die konkrete Forschung nicht ohne Folgen bleiben können. So
hat man, von den psychologistischen Auffassungen abgesehen, das literarische
Kunstwerk bald für ein bloßes „Wortkunstwerk" erklärt, bald für ein anschauliches
Vorstellungsgebilde. Auch die üblichen bildlichen Redeweisen, wie die von Gehalt und
Gestalt, Form und Inhalt, schon in sich von kaum zu überbietender Vieldeutigkeit,
eröffnen in keiner Weise einen Einblick in die Struktur des literarischen Kunst-
werkes, sondern setzen diesen voraus, um überhaupt verstanden zu werden. I.s Haupt-
erkenntnis ist nun die, daß das literarische Kunstwerk nicht aus einer einzigen
Schicht besteht, sondern ein mehrschichtiges Ganzes bildet, in dem Wort und An-
schauung beide ihre Stelle haben. Damit ist aber der Gehalt des literarischen Kunst-
werkes noch nicht erschöpft. Es umfaßt vielmehr insgesamt vier heterogene Schich-
ten: 1. die Schicht der sprachlichen Lautgebilde, 2. die der Bedeutungseinheiten,
3. die der dargestellten Gegenständlichkeiten, 4. die der schematisierten Ansichten.
Diese bilden zusammen eine einheitliche „Polyphonie von Stimmen"', die zugleich
der Träger einer eigentümlichen Harmonie von ästhetischen Wertqualitäten ist.
In der ersten grundlegenden Schicht der sprachlichen Lautgebilde
unterscheidet 1. das bedeutungslose „Lautmaterial" und den „Wortlaut", zu dem
der Laut durch seine Bedeutung wird. Nur dieser Wortlaut gehört nach I. zum
literarischen Kunstwerk, zusammen mit seinen anhaftenden Charakteren, vor allem
den gefühlsmäßigen „Gestaltqualitäten" (z. B. seiner Traurigkeit); zu ihnen ge-
hören auch die eigentümlichen „Manifestationsqualitäten" einer wiedergegebenen
Rede, „in denen die verborgenen psychischen Zustände" einer als sprechend dar-
gestellten Person „manifest werden". Ein weiterer Unterschied des Wortlautes vom
Lautmaterial soll in der Identität des Wortlauts bei mehrmaligem Aussprechen des-
selben Wortes bestehen. Es sei keine bloße inkorrekte Redensart, daß wir bei Wieder-
381
Werkes von allen ihm unwesentlichen Elementen gereinigt. Dazu gehören nicht nur'
die Vorbilder für die im literarischen Kunstwerk auftretenden Gegenstände und
Sachverhalte, sondern vor allem der „Autor selbst samt allen den Schicksalen, Er-
lebnissen und psychischen Zuständen", die zur Entstehung des Kunstwerkes führen.
I. richtet sich damit nicht etwa gegen eine richtig verstandene Psychologie des
künstlerischen und literarischen Schaffens. Aber deren Aufgaben können erst nach
Kenntnis der Struktur des literarischen Werkes erfolgreich in Angriff genommen
werden. Abgesehen wird ferner von den Erlebnissen, psychischen Zuständen und
möglichen Stellungnahmen des Lesers. Außerdem muß eine „Ontologie des literari-
schen Werkes" alle erkenntnistheoretischen Fragen ausschalten, so groß auch ihre
Bedeutung für die Möglichkeit einer Literaturwissenschaft überhaupt sein mag.
Endlich soll die Arbeit keine wertästhetischen Fragen behandeln. Sie will nicht
das literarische Kunst werk, das wertvolle literarische Werk, sondern das litera-
rische Werk schlechthin erforschen. Der ihm etwa zukommende Wert kann erst nach
Erfassung der Struktur des Wertträgers untersucht werden. So betreffen die Haupt-
untersuchungen des Buches nur die gemeinsame Grundlage der Literaturwissenschaft
und der Ästhetik. Die Arbeit gehört also nicht in das Gebiet der Ästhetik, sondern
in das der allgemeinen Kunstwissenschaft, wenn sie auch in ihrer Durchführung
weit darüber hinausgreift. An dieser mit aller Deutlichkeit ausgesprochenen Ziel-
setzung des Verfassers geht die kürzlich in der Deutschen Literaturzeitung er-
schienene Besprechung durch H. Cysarz völlig vorbei.
Der Schwerpunkt der Arbeit liegt in den Analysen des zweiten Abschnittes, die
den „Aufbau des literarischen Werkes" klarlegen. Darüber herrschen selbst unter
den Literaturwissenschaftlern erstaunliche Unklarheiten und Widersprüche, die
natürlich auch für die konkrete Forschung nicht ohne Folgen bleiben können. So
hat man, von den psychologistischen Auffassungen abgesehen, das literarische
Kunstwerk bald für ein bloßes „Wortkunstwerk" erklärt, bald für ein anschauliches
Vorstellungsgebilde. Auch die üblichen bildlichen Redeweisen, wie die von Gehalt und
Gestalt, Form und Inhalt, schon in sich von kaum zu überbietender Vieldeutigkeit,
eröffnen in keiner Weise einen Einblick in die Struktur des literarischen Kunst-
werkes, sondern setzen diesen voraus, um überhaupt verstanden zu werden. I.s Haupt-
erkenntnis ist nun die, daß das literarische Kunstwerk nicht aus einer einzigen
Schicht besteht, sondern ein mehrschichtiges Ganzes bildet, in dem Wort und An-
schauung beide ihre Stelle haben. Damit ist aber der Gehalt des literarischen Kunst-
werkes noch nicht erschöpft. Es umfaßt vielmehr insgesamt vier heterogene Schich-
ten: 1. die Schicht der sprachlichen Lautgebilde, 2. die der Bedeutungseinheiten,
3. die der dargestellten Gegenständlichkeiten, 4. die der schematisierten Ansichten.
Diese bilden zusammen eine einheitliche „Polyphonie von Stimmen"', die zugleich
der Träger einer eigentümlichen Harmonie von ästhetischen Wertqualitäten ist.
In der ersten grundlegenden Schicht der sprachlichen Lautgebilde
unterscheidet 1. das bedeutungslose „Lautmaterial" und den „Wortlaut", zu dem
der Laut durch seine Bedeutung wird. Nur dieser Wortlaut gehört nach I. zum
literarischen Kunstwerk, zusammen mit seinen anhaftenden Charakteren, vor allem
den gefühlsmäßigen „Gestaltqualitäten" (z. B. seiner Traurigkeit); zu ihnen ge-
hören auch die eigentümlichen „Manifestationsqualitäten" einer wiedergegebenen
Rede, „in denen die verborgenen psychischen Zustände" einer als sprechend dar-
gestellten Person „manifest werden". Ein weiterer Unterschied des Wortlautes vom
Lautmaterial soll in der Identität des Wortlauts bei mehrmaligem Aussprechen des-
selben Wortes bestehen. Es sei keine bloße inkorrekte Redensart, daß wir bei Wieder-