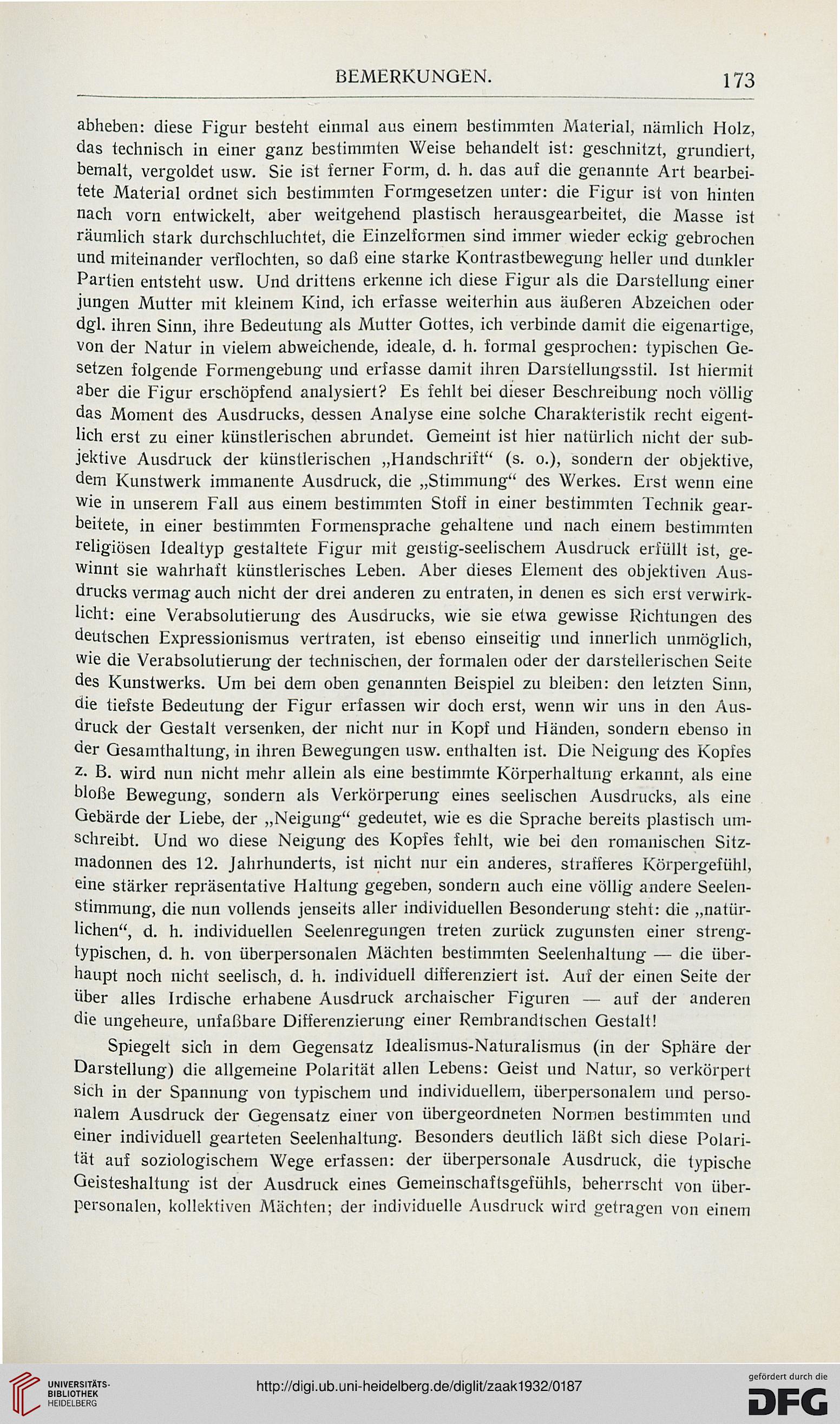BEMERKUNGEN.
173
abheben: diese Figur besteht einmal aus einem bestimmten Material, nämlich Holz,
das technisch in einer ganz bestimmten Weise behandelt ist: geschnitzt, grundiert,
bemalt, vergoldet usw. Sie ist ferner Form, d. h. das auf die genannte Art bearbei-
tete Material ordnet sich bestimmten Formgesetzen unter: die Figur ist von hinten
nach vorn entwickelt, aber weitgehend plastisch herausgearbeitet, die Masse ist
räumlich stark durchschluchtet, die Einzelformen sind immer wieder eckig gebrochen
und miteinander verflochten, so daß eine starke Kontrastbewegimg heller und dunkler
Partien entsteht usw. Und drittens erkenne ich diese Figur als die Darstellung einer
jungen Mutter mit kleinem Kind, ich erfasse weiterhin aus äußeren Abzeichen oder
dgl. ihren Sinn, ihre Bedeutung als Mutter Gottes, ich verbinde damit die eigenartige,
von der Natur in vielem abweichende, ideale, d. h. formal gesprochen: typischen Ge-
setzen folgende Formengebung und erfasse damit ihren Darstellungsstil. Ist hiermit
aber die Figur erschöpfend analysiert? Es fehlt bei dieser Beschreibung noch völlig
das Moment des Ausdrucks, dessen Analyse eine solche Charakteristik recht eigent-
lich erst zu einer künstlerischen abrundet. Gemeint ist hier natürlich nicht der sub-
jektive Ausdruck der künstlerischen „Handschrift" (s. o.), sondern der objektive,
dem Kunstwerk immanente Ausdruck, die „Stimmung" des Werkes. Erst wenn eine
wie in unserem Fall aus einem bestimmten Stoff in einer bestimmten Technik gear-
beitete, in einer bestimmten Formensprache gehaltene und nach einem bestimmten
religiösen Idealtyp gestaltete Figur mit geistig-seelischem Ausdruck erfüllt ist, ge-
winnt sie wahrhaft künstlerisches Leben. Aber dieses Element des objektiven Aus-
drucks vermag auch nicht der drei anderen zu entraten, in denen es sich erst verwirk-
licht: eine Verabsolutierung des Ausdrucks, wie sie etwa gewisse Richtungen des
deutschen Expressionismus vertraten, ist ebenso einseitig und innerlich unmöglich,
wie die Verabsolutierung der technischen, der formalen oder der darstellerischen Seite
des Kunstwerks. Um bei dem oben genannten Beispiel zu bleiben: den letzten Sinn,
die tiefste Bedeutung der Figur erfassen wir doch erst, wenn wir uns in den Aus-
druck der Gestalt versenken, der nicht nur in Kopf und Händen, sondern ebenso in
der Gesamthaltung, in ihren Bewegungen usw. enthalten ist. Die Neigung des Kopfes
z- B. wird nun nicht mehr allein als eine bestimmte Körperhaltung erkannt, als eine
bloße Bewegung, sondern als Verkörperung eines seelischen Ausdrucks, als eine
Gebärde der Liebe, der „Neigung" gedeutet, wie es die Sprache bereits plastisch um-
schreibt. Und wo diese Neigung des Kopfes fehlt, wie bei den romanischen Sitz-
madonnen des 12. Jahrhunderts, ist nicht nur ein anderes, strafferes Körpergefühl,
eine stärker repräsentative Haltung gegeben, sondern auch eine völlig andere Seelen-
stiminung, die nun vollends jenseits aller individuellen Besonderung steht: die „natür-
lichen", d. h. individuellen Seelenregungen treten zurück zugunsten einer streng-
typischen, d. h. von überpersonalen Mächten bestimmten Seelenhaltung — die über-
haupt noch nicht seelisch, d. h. individuell differenziert ist. Auf der einen Seite der
über alles Irdische erhabene Ausdruck archaischer Figuren — auf der anderen
die ungeheure, unfaßbare Differenzierung einer Rembrandtschen Gestalt!
Spiegelt sich in dem Gegensatz Idealismus-Naturalismus (in der Sphäre der
Darstellung) die allgemeine Polarität allen Lebens: Geist und Natur, so verkörpert
sich in der Spannung von typischem und individuellem, überpersonalem und perso-
nalem Ausdruck der Gegensatz einer von übergeordneten Normen bestimmten und
einer individuell gearteten Seelenhaltung. Besonders deutlich läßt sich diese Polari-
tät auf soziologischem Wege erfassen: der überpersonale Ausdruck, die typische
Geisteshaltung ist der Ausdruck eines Gemeinschaftsgefühls, beherrscht von über-
personalcn, kollektiven Mächten; der individuelle Ausdruck wird getragen von einem
173
abheben: diese Figur besteht einmal aus einem bestimmten Material, nämlich Holz,
das technisch in einer ganz bestimmten Weise behandelt ist: geschnitzt, grundiert,
bemalt, vergoldet usw. Sie ist ferner Form, d. h. das auf die genannte Art bearbei-
tete Material ordnet sich bestimmten Formgesetzen unter: die Figur ist von hinten
nach vorn entwickelt, aber weitgehend plastisch herausgearbeitet, die Masse ist
räumlich stark durchschluchtet, die Einzelformen sind immer wieder eckig gebrochen
und miteinander verflochten, so daß eine starke Kontrastbewegimg heller und dunkler
Partien entsteht usw. Und drittens erkenne ich diese Figur als die Darstellung einer
jungen Mutter mit kleinem Kind, ich erfasse weiterhin aus äußeren Abzeichen oder
dgl. ihren Sinn, ihre Bedeutung als Mutter Gottes, ich verbinde damit die eigenartige,
von der Natur in vielem abweichende, ideale, d. h. formal gesprochen: typischen Ge-
setzen folgende Formengebung und erfasse damit ihren Darstellungsstil. Ist hiermit
aber die Figur erschöpfend analysiert? Es fehlt bei dieser Beschreibung noch völlig
das Moment des Ausdrucks, dessen Analyse eine solche Charakteristik recht eigent-
lich erst zu einer künstlerischen abrundet. Gemeint ist hier natürlich nicht der sub-
jektive Ausdruck der künstlerischen „Handschrift" (s. o.), sondern der objektive,
dem Kunstwerk immanente Ausdruck, die „Stimmung" des Werkes. Erst wenn eine
wie in unserem Fall aus einem bestimmten Stoff in einer bestimmten Technik gear-
beitete, in einer bestimmten Formensprache gehaltene und nach einem bestimmten
religiösen Idealtyp gestaltete Figur mit geistig-seelischem Ausdruck erfüllt ist, ge-
winnt sie wahrhaft künstlerisches Leben. Aber dieses Element des objektiven Aus-
drucks vermag auch nicht der drei anderen zu entraten, in denen es sich erst verwirk-
licht: eine Verabsolutierung des Ausdrucks, wie sie etwa gewisse Richtungen des
deutschen Expressionismus vertraten, ist ebenso einseitig und innerlich unmöglich,
wie die Verabsolutierung der technischen, der formalen oder der darstellerischen Seite
des Kunstwerks. Um bei dem oben genannten Beispiel zu bleiben: den letzten Sinn,
die tiefste Bedeutung der Figur erfassen wir doch erst, wenn wir uns in den Aus-
druck der Gestalt versenken, der nicht nur in Kopf und Händen, sondern ebenso in
der Gesamthaltung, in ihren Bewegungen usw. enthalten ist. Die Neigung des Kopfes
z- B. wird nun nicht mehr allein als eine bestimmte Körperhaltung erkannt, als eine
bloße Bewegung, sondern als Verkörperung eines seelischen Ausdrucks, als eine
Gebärde der Liebe, der „Neigung" gedeutet, wie es die Sprache bereits plastisch um-
schreibt. Und wo diese Neigung des Kopfes fehlt, wie bei den romanischen Sitz-
madonnen des 12. Jahrhunderts, ist nicht nur ein anderes, strafferes Körpergefühl,
eine stärker repräsentative Haltung gegeben, sondern auch eine völlig andere Seelen-
stiminung, die nun vollends jenseits aller individuellen Besonderung steht: die „natür-
lichen", d. h. individuellen Seelenregungen treten zurück zugunsten einer streng-
typischen, d. h. von überpersonalen Mächten bestimmten Seelenhaltung — die über-
haupt noch nicht seelisch, d. h. individuell differenziert ist. Auf der einen Seite der
über alles Irdische erhabene Ausdruck archaischer Figuren — auf der anderen
die ungeheure, unfaßbare Differenzierung einer Rembrandtschen Gestalt!
Spiegelt sich in dem Gegensatz Idealismus-Naturalismus (in der Sphäre der
Darstellung) die allgemeine Polarität allen Lebens: Geist und Natur, so verkörpert
sich in der Spannung von typischem und individuellem, überpersonalem und perso-
nalem Ausdruck der Gegensatz einer von übergeordneten Normen bestimmten und
einer individuell gearteten Seelenhaltung. Besonders deutlich läßt sich diese Polari-
tät auf soziologischem Wege erfassen: der überpersonale Ausdruck, die typische
Geisteshaltung ist der Ausdruck eines Gemeinschaftsgefühls, beherrscht von über-
personalcn, kollektiven Mächten; der individuelle Ausdruck wird getragen von einem