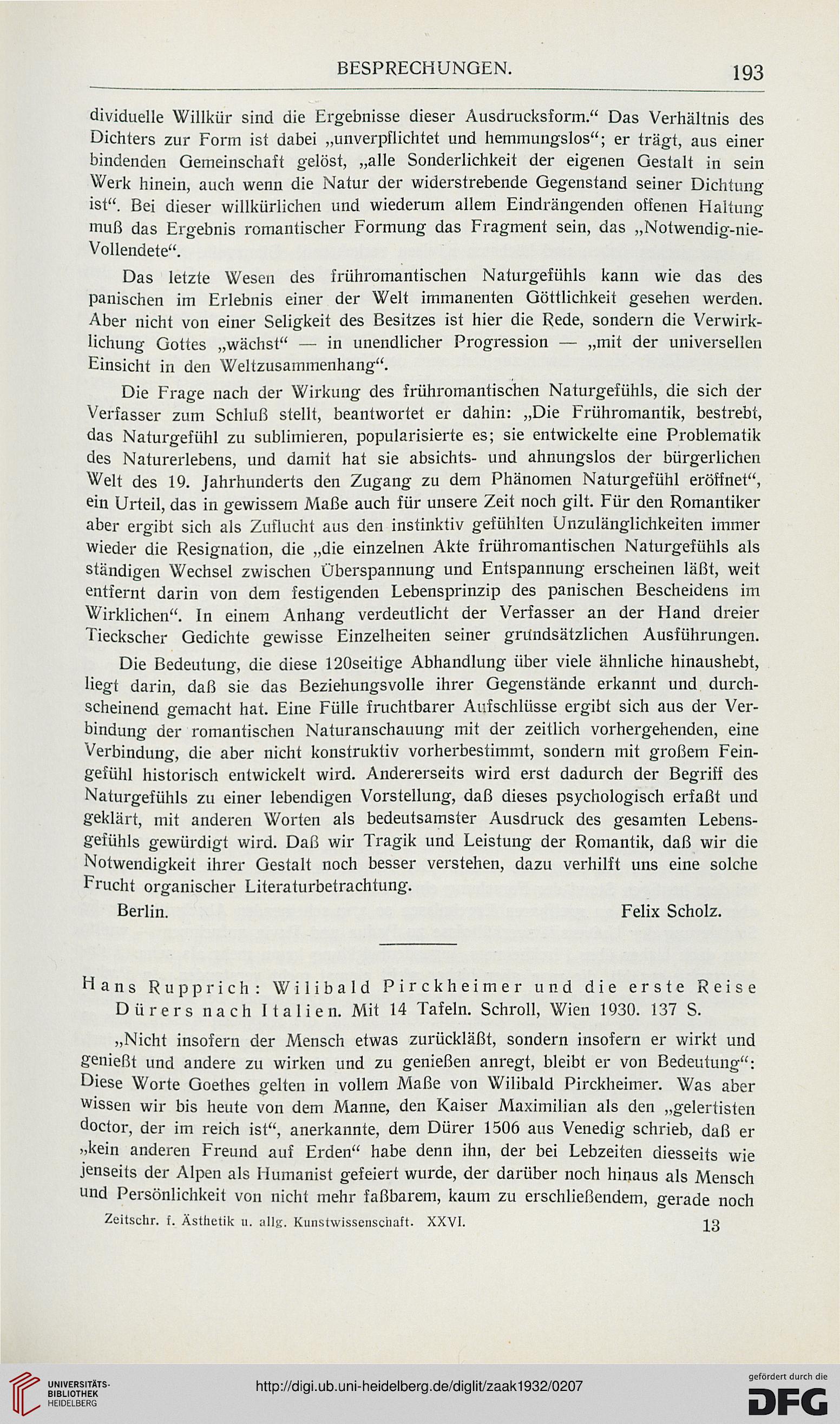BESPRECHUNGEN.
193
dividuelle Willkür sind die Ergebnisse dieser Ausdrucksform." Das Verhältnis des
Dichters zur Form ist dabei „unverpflichtet und hemmungslos"; er trägt, aus einer
bindenden Gemeinschaft gelöst, „alle Sonderlichkeit der eigenen Gestalt in sein
Werk hinein, auch wenn die Natur der widerstrebende Gegenstand seiner Dichtung
ist". Bei dieser willkürlichen und wiederum allem Eindrängenden offenen Haltung
muß das Ergebnis romantischer Formung das Fragment sein, das „Notwendig-nie-
Vollendete".
Das letzte Wesen des frühromantischen Naturgefühls kann wie das des
panischen im Erlebnis einer der Welt immanenten Göttlichkeit gesehen werden.
Aber nicht von einer Seligkeit des Besitzes ist hier die Rede, sondern die Verwirk-
lichung Gottes „wächst" — in unendlicher Progression — „mit der universellen
Einsicht in den Weltzusammenhang".
Die Frage nach der Wirkung des frühromantischen Naturgefühls, die sich der
Verfasser zum Schluß stellt, beantwortet er dahin: „Die Frühromantik, bestrebt,
das Naturgefühl zu sublimieren, popularisierte es; sie entwickelte eine Problematik
des Naturerlebens, und damit hat sie absichts- und ahnungslos der bürgerlichen
Welt des 19. Jahrhunderts den Zugang zu dem Phänomen Naturgefühl eröffnet",
ein Urteil, das in gewissem Maße auch für unsere Zeit noch gilt. Für den Romantiker
aber ergibt sich als Zuflucht aus den instinktiv gefühlten Unzulänglichkeiten immer
wieder die Resignation, die „die einzelnen Akte frühromantischen Naturgefühls als
ständigen Wechsel zwischen Überspannung und Entspannung erscheinen läßt, weit
entfernt darin von dem festigenden Lebensprinzip des panischen Bescheidens im
Wirklichen". In einem Anhang verdeutlicht der Verfasser an der Hand dreier
Tieckscher Gedichte gewisse Einzelheiten seiner grundsätzlichen Ausführungen.
Die Bedeutung, die diese 120seitige Abhandlung über viele ähnliche hinaushebt,
liegt darin, daß sie das Beziehungsvolle ihrer Gegenstände erkannt und durch-
scheinend gemacht hat. Eine Fülle fruchtbarer Aufschlüsse ergibt sich aus der Ver-
bindung der romantischen Naturanschauung mit der zeitlich vorhergehenden, eine
Verbindung, die aber nicht konstruktiv vorherbestimmt, sondern mit großem Fein-
gefühl historisch entwickelt wird. Andererseits wird erst dadurch der Begriff des
Naturgefühls zu einer lebendigen Vorstellung, daß dieses psychologisch erfaßt und
geklärt, mit anderen Worten als bedeutsamster Ausdruck des gesamten Lebens-
gefühls gewürdigt wird. Daß wir Tragik und Leistung der Romantik, daß wir die
Notwendigkeit ihrer Gestalt noch besser verstehen, dazu verhilft uns eine solche
Frucht organischer Literaturbetrachtung.
Berlin. Felix Scholz.
Hans Rupprich: Wilibald Pirckheimer und die erste Reise
Dürers nach Italien. Mit 14 Tafeln. Schroll, Wien 1930. 137 S.
„Nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und
genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung":
Diese Worte Goethes gelten in vollem Maße von Wilibald Pirckheimer. Was aber
wissen wir bis heute von dem Manne, den Kaiser Maximilian als den „gelertisten
doctor, der im reich ist", anerkannte, dem Dürer 1506 aus Venedig schrieb, daß er
»kein anderen Freund auf Erden" habe denn ihn, der bei Lebzeiten diesseits wie
jenseits der Alpen als Humanist gefeiert wurde, der darüber noch hinaus als Mensch
und Persönlichkeit von nicht mehr faßbarem, kaum zu erschließendem, gerade noch
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVI. iq
193
dividuelle Willkür sind die Ergebnisse dieser Ausdrucksform." Das Verhältnis des
Dichters zur Form ist dabei „unverpflichtet und hemmungslos"; er trägt, aus einer
bindenden Gemeinschaft gelöst, „alle Sonderlichkeit der eigenen Gestalt in sein
Werk hinein, auch wenn die Natur der widerstrebende Gegenstand seiner Dichtung
ist". Bei dieser willkürlichen und wiederum allem Eindrängenden offenen Haltung
muß das Ergebnis romantischer Formung das Fragment sein, das „Notwendig-nie-
Vollendete".
Das letzte Wesen des frühromantischen Naturgefühls kann wie das des
panischen im Erlebnis einer der Welt immanenten Göttlichkeit gesehen werden.
Aber nicht von einer Seligkeit des Besitzes ist hier die Rede, sondern die Verwirk-
lichung Gottes „wächst" — in unendlicher Progression — „mit der universellen
Einsicht in den Weltzusammenhang".
Die Frage nach der Wirkung des frühromantischen Naturgefühls, die sich der
Verfasser zum Schluß stellt, beantwortet er dahin: „Die Frühromantik, bestrebt,
das Naturgefühl zu sublimieren, popularisierte es; sie entwickelte eine Problematik
des Naturerlebens, und damit hat sie absichts- und ahnungslos der bürgerlichen
Welt des 19. Jahrhunderts den Zugang zu dem Phänomen Naturgefühl eröffnet",
ein Urteil, das in gewissem Maße auch für unsere Zeit noch gilt. Für den Romantiker
aber ergibt sich als Zuflucht aus den instinktiv gefühlten Unzulänglichkeiten immer
wieder die Resignation, die „die einzelnen Akte frühromantischen Naturgefühls als
ständigen Wechsel zwischen Überspannung und Entspannung erscheinen läßt, weit
entfernt darin von dem festigenden Lebensprinzip des panischen Bescheidens im
Wirklichen". In einem Anhang verdeutlicht der Verfasser an der Hand dreier
Tieckscher Gedichte gewisse Einzelheiten seiner grundsätzlichen Ausführungen.
Die Bedeutung, die diese 120seitige Abhandlung über viele ähnliche hinaushebt,
liegt darin, daß sie das Beziehungsvolle ihrer Gegenstände erkannt und durch-
scheinend gemacht hat. Eine Fülle fruchtbarer Aufschlüsse ergibt sich aus der Ver-
bindung der romantischen Naturanschauung mit der zeitlich vorhergehenden, eine
Verbindung, die aber nicht konstruktiv vorherbestimmt, sondern mit großem Fein-
gefühl historisch entwickelt wird. Andererseits wird erst dadurch der Begriff des
Naturgefühls zu einer lebendigen Vorstellung, daß dieses psychologisch erfaßt und
geklärt, mit anderen Worten als bedeutsamster Ausdruck des gesamten Lebens-
gefühls gewürdigt wird. Daß wir Tragik und Leistung der Romantik, daß wir die
Notwendigkeit ihrer Gestalt noch besser verstehen, dazu verhilft uns eine solche
Frucht organischer Literaturbetrachtung.
Berlin. Felix Scholz.
Hans Rupprich: Wilibald Pirckheimer und die erste Reise
Dürers nach Italien. Mit 14 Tafeln. Schroll, Wien 1930. 137 S.
„Nicht insofern der Mensch etwas zurückläßt, sondern insofern er wirkt und
genießt und andere zu wirken und zu genießen anregt, bleibt er von Bedeutung":
Diese Worte Goethes gelten in vollem Maße von Wilibald Pirckheimer. Was aber
wissen wir bis heute von dem Manne, den Kaiser Maximilian als den „gelertisten
doctor, der im reich ist", anerkannte, dem Dürer 1506 aus Venedig schrieb, daß er
»kein anderen Freund auf Erden" habe denn ihn, der bei Lebzeiten diesseits wie
jenseits der Alpen als Humanist gefeiert wurde, der darüber noch hinaus als Mensch
und Persönlichkeit von nicht mehr faßbarem, kaum zu erschließendem, gerade noch
Zeitschr. f. Ästhetik u. allg. Kunstwissenschaft. XXVI. iq