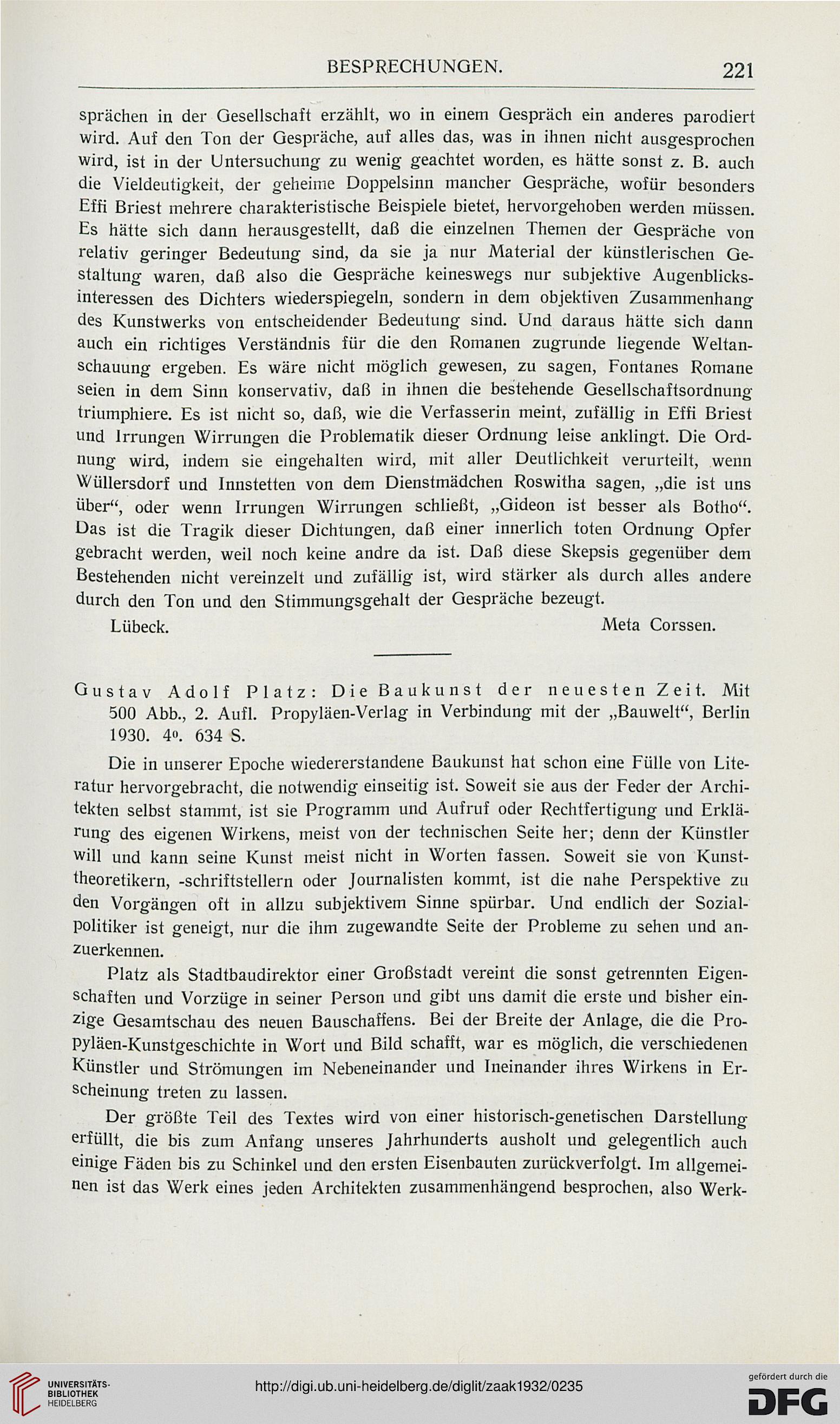BESPRECHUNGEN.
221
sprächen in der Gesellschaft erzählt, wo in einem Gespräch ein anderes parodiert
wird. Auf den Ton der Gespräche, auf alles das, was in ihnen nicht ausgesprochen
wird, ist in der Untersuchung zu wenig geachtet worden, es hätte sonst z. B. auch
die Vieldeutigkeit, der geheime Doppelsinn mancher Gespräche, wofür besonders
Effi Briest mehrere charakteristische Beispiele bietet, hervorgehoben werden müssen.
Es hätte sich dann herausgestellt, daß die einzelnen Themen der Gespräche von
relativ geringer Bedeutung sind, da sie ja nur Material der künstlerischen Ge-
staltung waren, daß also die Gespräche keineswegs nur subjektive Augenblicks-
interessen des Dichters wiederspiegeln, sondern in dem objektiven Zusammenhang
des Kunstwerks von entscheidender Bedeutung sind. Und daraus hätte sich dann
auch ein richtiges Verständnis für die den Romanen zugrunde liegende Weltan-
schauung ergeben. Es wäre nicht möglich gewesen, zu sagen, Fontanes Romane
seien in dem Sinn konservativ, daß in ihnen die bestehende Gesellschaftsordnung
triumphiere. Es ist nicht so, daß, wie die Verfasserin meint, zufällig in Effi Briest
und Irrungen Wirrungen die Problematik dieser Ordnung leise anklingt. Die Ord-
nung wird, indem sie eingehalten wird, mit aller Deutlichkeit verurteilt, wenn
VC Ullersdorf und Innstetten von dem Dienstmädchen Roswitha sagen, „die ist uns
über", oder wenn Irrungen Wirrungen schließt, „Gideon ist besser als Botho".
Das ist die Tragik dieser Dichtungen, daß einer innerlich toten Ordnung Opfer
gebracht werden, weil noch keine andre da ist. Daß diese Skepsis gegenüber dem
Bestehenden nicht vereinzelt und zufällig ist, wird stärker als durch alles andere
durch den Ton und den Stimmungsgehalt der Gespräche bezeugt.
Lübeck. Meta Corssen.
Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit. Mit
500 Abb., 2. Aufl. Propyläen-Verlag in Verbindung mit der „Bauwelt", Berlin
1Q30. 4». 634 S.
Die in unserer Epoche wiedererstandene Baukunst hat schon eine Fülle von Lite-
ratur hervorgebracht, die notwendig einseitig ist. Soweit sie aus der Feder der Archi-
tekten selbst stammt, ist sie Programm und Aufruf oder Rechtfertigung und Erklä-
rung des eigenen Wirkens, meist von der technischen Seite her; denn der Künstler
will und kann seine Kunst meist nicht in Worten fassen. Soweit sie von Kunst-
theoretikern, -Schriftstellern oder Journalisten kommt, ist die nahe Perspektive zu
den Vorgängen oft in allzu subjektivem Sinne spürbar. Und endlich der Sozial-
politiker ist geneigt, nur die ihm zugewandte Seite der Probleme zu sehen und an-
zuerkennen.
Platz als Stadtbaudirektor einer Großstadt vereint die sonst getrennten Eigen-
schaften und Vorzüge in seiner Person und gibt uns damit die erste und bisher ein-
zige Gesamtschau des neuen Bauschaffens. Bei der Breite der Anlage, die die Pro-
Pyläen-Kunstgeschichte in Wort und Bild schafft, war es möglich, die verschiedenen
Künstler und Strömungen im Nebeneinander und Ineinander ihres Wirkens in Er-
scheinung treten zu lassen.
Der größte Teil des Textes wird von einer historisch-genetischen Darstellung
erfüllt, die bis zum Anfang unseres Jahrhunderts ausholt und gelegentlich auch
einige Fäden bis zu Schinkel und den ersten Eisenbauten zurückverfolgt. Im allgemei-
nen ist das Werk eines jeden Architekten zusammenhängend besprochen, also Werk-
221
sprächen in der Gesellschaft erzählt, wo in einem Gespräch ein anderes parodiert
wird. Auf den Ton der Gespräche, auf alles das, was in ihnen nicht ausgesprochen
wird, ist in der Untersuchung zu wenig geachtet worden, es hätte sonst z. B. auch
die Vieldeutigkeit, der geheime Doppelsinn mancher Gespräche, wofür besonders
Effi Briest mehrere charakteristische Beispiele bietet, hervorgehoben werden müssen.
Es hätte sich dann herausgestellt, daß die einzelnen Themen der Gespräche von
relativ geringer Bedeutung sind, da sie ja nur Material der künstlerischen Ge-
staltung waren, daß also die Gespräche keineswegs nur subjektive Augenblicks-
interessen des Dichters wiederspiegeln, sondern in dem objektiven Zusammenhang
des Kunstwerks von entscheidender Bedeutung sind. Und daraus hätte sich dann
auch ein richtiges Verständnis für die den Romanen zugrunde liegende Weltan-
schauung ergeben. Es wäre nicht möglich gewesen, zu sagen, Fontanes Romane
seien in dem Sinn konservativ, daß in ihnen die bestehende Gesellschaftsordnung
triumphiere. Es ist nicht so, daß, wie die Verfasserin meint, zufällig in Effi Briest
und Irrungen Wirrungen die Problematik dieser Ordnung leise anklingt. Die Ord-
nung wird, indem sie eingehalten wird, mit aller Deutlichkeit verurteilt, wenn
VC Ullersdorf und Innstetten von dem Dienstmädchen Roswitha sagen, „die ist uns
über", oder wenn Irrungen Wirrungen schließt, „Gideon ist besser als Botho".
Das ist die Tragik dieser Dichtungen, daß einer innerlich toten Ordnung Opfer
gebracht werden, weil noch keine andre da ist. Daß diese Skepsis gegenüber dem
Bestehenden nicht vereinzelt und zufällig ist, wird stärker als durch alles andere
durch den Ton und den Stimmungsgehalt der Gespräche bezeugt.
Lübeck. Meta Corssen.
Gustav Adolf Platz: Die Baukunst der neuesten Zeit. Mit
500 Abb., 2. Aufl. Propyläen-Verlag in Verbindung mit der „Bauwelt", Berlin
1Q30. 4». 634 S.
Die in unserer Epoche wiedererstandene Baukunst hat schon eine Fülle von Lite-
ratur hervorgebracht, die notwendig einseitig ist. Soweit sie aus der Feder der Archi-
tekten selbst stammt, ist sie Programm und Aufruf oder Rechtfertigung und Erklä-
rung des eigenen Wirkens, meist von der technischen Seite her; denn der Künstler
will und kann seine Kunst meist nicht in Worten fassen. Soweit sie von Kunst-
theoretikern, -Schriftstellern oder Journalisten kommt, ist die nahe Perspektive zu
den Vorgängen oft in allzu subjektivem Sinne spürbar. Und endlich der Sozial-
politiker ist geneigt, nur die ihm zugewandte Seite der Probleme zu sehen und an-
zuerkennen.
Platz als Stadtbaudirektor einer Großstadt vereint die sonst getrennten Eigen-
schaften und Vorzüge in seiner Person und gibt uns damit die erste und bisher ein-
zige Gesamtschau des neuen Bauschaffens. Bei der Breite der Anlage, die die Pro-
Pyläen-Kunstgeschichte in Wort und Bild schafft, war es möglich, die verschiedenen
Künstler und Strömungen im Nebeneinander und Ineinander ihres Wirkens in Er-
scheinung treten zu lassen.
Der größte Teil des Textes wird von einer historisch-genetischen Darstellung
erfüllt, die bis zum Anfang unseres Jahrhunderts ausholt und gelegentlich auch
einige Fäden bis zu Schinkel und den ersten Eisenbauten zurückverfolgt. Im allgemei-
nen ist das Werk eines jeden Architekten zusammenhängend besprochen, also Werk-