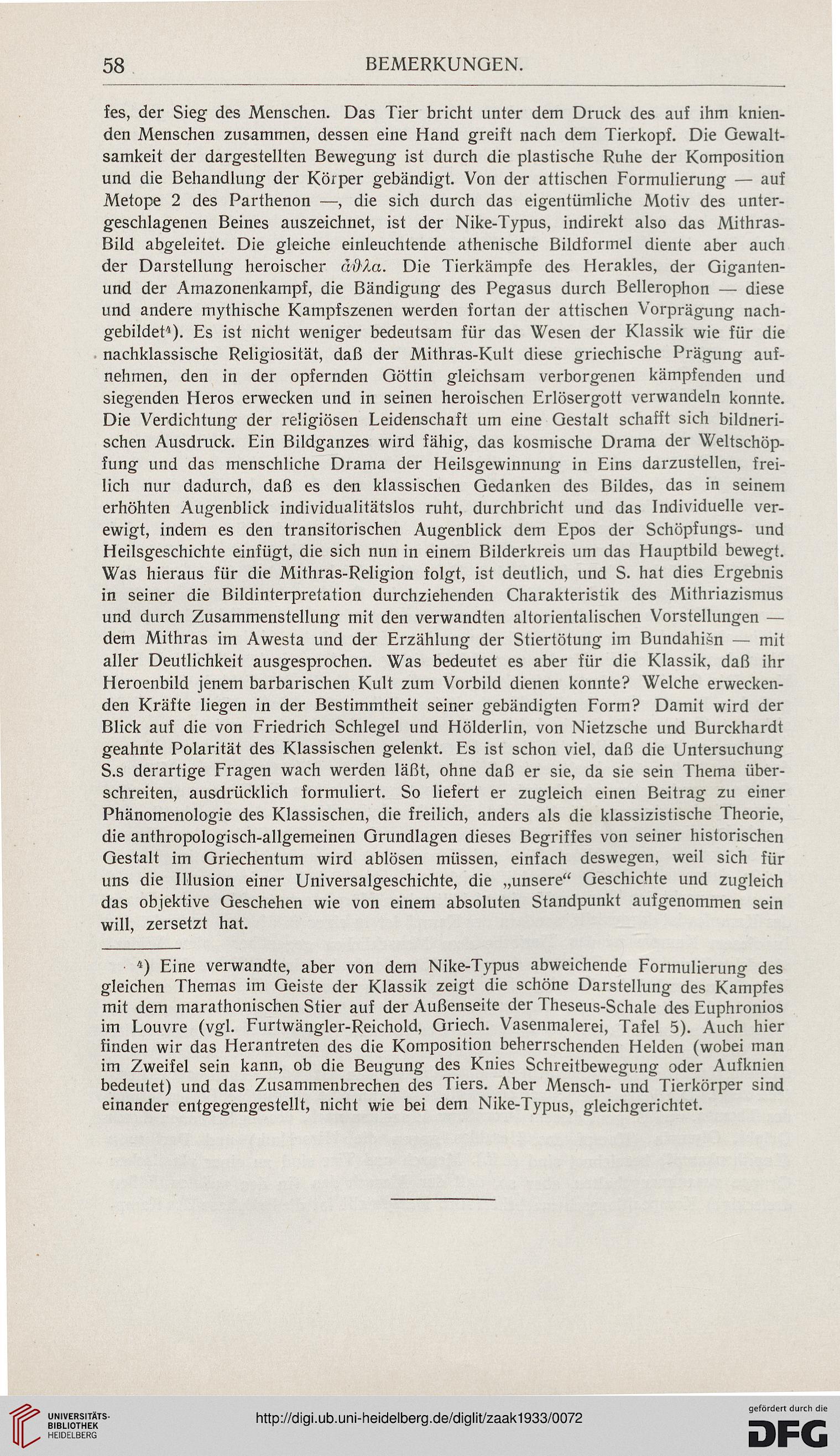58
BEMERKUNGEN.
fes, der Sieg des Menschen. Das Tier bricht unter dem Druck des auf ihm knien-
den Menschen zusammen, dessen eine Hand greift nach dem Tierkopf. Die Gewalt-
samkeit der dargestellten Bewegung ist durch die plastische Ruhe der Komposition
und die Behandlung der Körper gebändigt. Von der attischen Formulierung — auf
Metope 2 des Parthenon —, die sich durch das eigentümliche Motiv des unter-
geschlagenen Beines auszeichnet, ist der Nike-Typus, indirekt also das Mithras-
Bild abgeleitet. Die gleiche einleuchtende athenische Bildformel diente aber auch
der Darstellung heroischer äO-Xa. Die Tierkämpfe des Herakles, der Giganten-
und der Amazonenkampf, die Bändigung des Pegasus durch Bellerophon — diese
und andere mythische Kampfszenen werden fortan der attischen Vorprägung nach-
gebildet1). Es ist nicht weniger bedeutsam für das Wesen der Klassik wie für die
nachklassische Religiosität, daß der Mithras-Kult diese griechische Prägung auf-
nehmen, den in der opfernden Göttin gleichsam verborgenen kämpfenden und
siegenden Heros erwecken und in seinen heroischen Erlösergott verwandeln konnte.
Die Verdichtung der religiösen Leidenschaft um eine Gestalt schafft sich bildneri-
schen Ausdruck. Ein Bildganzes wird fähig, das kosmische Drama der Weltschöp-
fung und das menschliche Drama der Heilsgewinnung in Eins darzustellen, frei-
lich nur dadurch, daß es den klassischen Gedanken des Bildes, das in seinem
erhöhten Augenblick individualitätslos ruht, durchbricht und das Individuelle ver-
ewigt, indem es den transitorischen Augenblick dem Epos der Schöpfungs- und
Heilsgeschichte einfügt, die sich nun in einem Bilderkreis um das Hauptbild bewegt.
Was hieraus für die Mithras-Religion folgt, ist deutlich, und S. hat dies Ergebnis
in seiner die Bildinterpretation durchziehenden Charakteristik des Mithriazismus
und durch Zusammenstellung mit den verwandten altorientalischen Vorstellungen —
dem Mithras im Awesta und der Erzählung der Stiertötung im Bundahisn — mit
aller Deutlichkeit ausgesprochen. Was bedeutet es aber für die Klassik, daß ihr
Heroenbild jenem barbarischen Kult zum Vorbild dienen konnte? Welche erwecken-
den Kräfte liegen in der Bestimmtheit seiner gebändigten Form? Damit wird der
Blick auf die von Friedrich Schlegel und Hölderlin, von Nietzsche und Burckhardt
geahnte Polarität des Klassischen gelenkt. Es ist schon viel, daß die Untersuchung
S.s derartige Fragen wach werden läßt, ohne daß er sie, da sie sein Thema über-
schreiten, ausdrücklich formuliert. So liefert er zugleich einen Beitrag zu einer
Phänomenologie des Klassischen, die freilich, anders als die klassizistische Theorie,
die anthropologisch-allgemeinen Grundlagen dieses Begriffes von seiner historischen
Gestalt im Griechentum wird ablösen müssen, einfach deswegen, weil sich für
uns die Illusion einer Universalgeschichte, die „unsere" Geschichte und zugleich
das objektive Geschehen wie von einem absoluten Standpunkt aufgenommen sein
will, zersetzt hat.
4) Eine verwandte, aber von dem Nike-Typus abweichende Formulierung des
gleichen Themas im Geiste der Klassik zeigt die schöne Darstellung des Kampfes
mit dem marathonischen Stier auf der Außenseite der Theseus-Schale des Euphronios
im Louvre (vgl. Furtwängler-Reichold, Griech. Vasenmalerei, Tafel 5). Auch hier
finden wir das Herantreten des die Komposition beherrschenden Helden (wobei man
im Zweifel sein kann, ob die Beugung des Knies Schreitbewegung oder Aufknien
bedeutet) und das Zusammenbrechen des Tiers. Aber Mensch- und Tierkörper sind
einander entgegengestellt, nicht wie bei dem Nike-Typus, gleichgerichtet.
BEMERKUNGEN.
fes, der Sieg des Menschen. Das Tier bricht unter dem Druck des auf ihm knien-
den Menschen zusammen, dessen eine Hand greift nach dem Tierkopf. Die Gewalt-
samkeit der dargestellten Bewegung ist durch die plastische Ruhe der Komposition
und die Behandlung der Körper gebändigt. Von der attischen Formulierung — auf
Metope 2 des Parthenon —, die sich durch das eigentümliche Motiv des unter-
geschlagenen Beines auszeichnet, ist der Nike-Typus, indirekt also das Mithras-
Bild abgeleitet. Die gleiche einleuchtende athenische Bildformel diente aber auch
der Darstellung heroischer äO-Xa. Die Tierkämpfe des Herakles, der Giganten-
und der Amazonenkampf, die Bändigung des Pegasus durch Bellerophon — diese
und andere mythische Kampfszenen werden fortan der attischen Vorprägung nach-
gebildet1). Es ist nicht weniger bedeutsam für das Wesen der Klassik wie für die
nachklassische Religiosität, daß der Mithras-Kult diese griechische Prägung auf-
nehmen, den in der opfernden Göttin gleichsam verborgenen kämpfenden und
siegenden Heros erwecken und in seinen heroischen Erlösergott verwandeln konnte.
Die Verdichtung der religiösen Leidenschaft um eine Gestalt schafft sich bildneri-
schen Ausdruck. Ein Bildganzes wird fähig, das kosmische Drama der Weltschöp-
fung und das menschliche Drama der Heilsgewinnung in Eins darzustellen, frei-
lich nur dadurch, daß es den klassischen Gedanken des Bildes, das in seinem
erhöhten Augenblick individualitätslos ruht, durchbricht und das Individuelle ver-
ewigt, indem es den transitorischen Augenblick dem Epos der Schöpfungs- und
Heilsgeschichte einfügt, die sich nun in einem Bilderkreis um das Hauptbild bewegt.
Was hieraus für die Mithras-Religion folgt, ist deutlich, und S. hat dies Ergebnis
in seiner die Bildinterpretation durchziehenden Charakteristik des Mithriazismus
und durch Zusammenstellung mit den verwandten altorientalischen Vorstellungen —
dem Mithras im Awesta und der Erzählung der Stiertötung im Bundahisn — mit
aller Deutlichkeit ausgesprochen. Was bedeutet es aber für die Klassik, daß ihr
Heroenbild jenem barbarischen Kult zum Vorbild dienen konnte? Welche erwecken-
den Kräfte liegen in der Bestimmtheit seiner gebändigten Form? Damit wird der
Blick auf die von Friedrich Schlegel und Hölderlin, von Nietzsche und Burckhardt
geahnte Polarität des Klassischen gelenkt. Es ist schon viel, daß die Untersuchung
S.s derartige Fragen wach werden läßt, ohne daß er sie, da sie sein Thema über-
schreiten, ausdrücklich formuliert. So liefert er zugleich einen Beitrag zu einer
Phänomenologie des Klassischen, die freilich, anders als die klassizistische Theorie,
die anthropologisch-allgemeinen Grundlagen dieses Begriffes von seiner historischen
Gestalt im Griechentum wird ablösen müssen, einfach deswegen, weil sich für
uns die Illusion einer Universalgeschichte, die „unsere" Geschichte und zugleich
das objektive Geschehen wie von einem absoluten Standpunkt aufgenommen sein
will, zersetzt hat.
4) Eine verwandte, aber von dem Nike-Typus abweichende Formulierung des
gleichen Themas im Geiste der Klassik zeigt die schöne Darstellung des Kampfes
mit dem marathonischen Stier auf der Außenseite der Theseus-Schale des Euphronios
im Louvre (vgl. Furtwängler-Reichold, Griech. Vasenmalerei, Tafel 5). Auch hier
finden wir das Herantreten des die Komposition beherrschenden Helden (wobei man
im Zweifel sein kann, ob die Beugung des Knies Schreitbewegung oder Aufknien
bedeutet) und das Zusammenbrechen des Tiers. Aber Mensch- und Tierkörper sind
einander entgegengestellt, nicht wie bei dem Nike-Typus, gleichgerichtet.