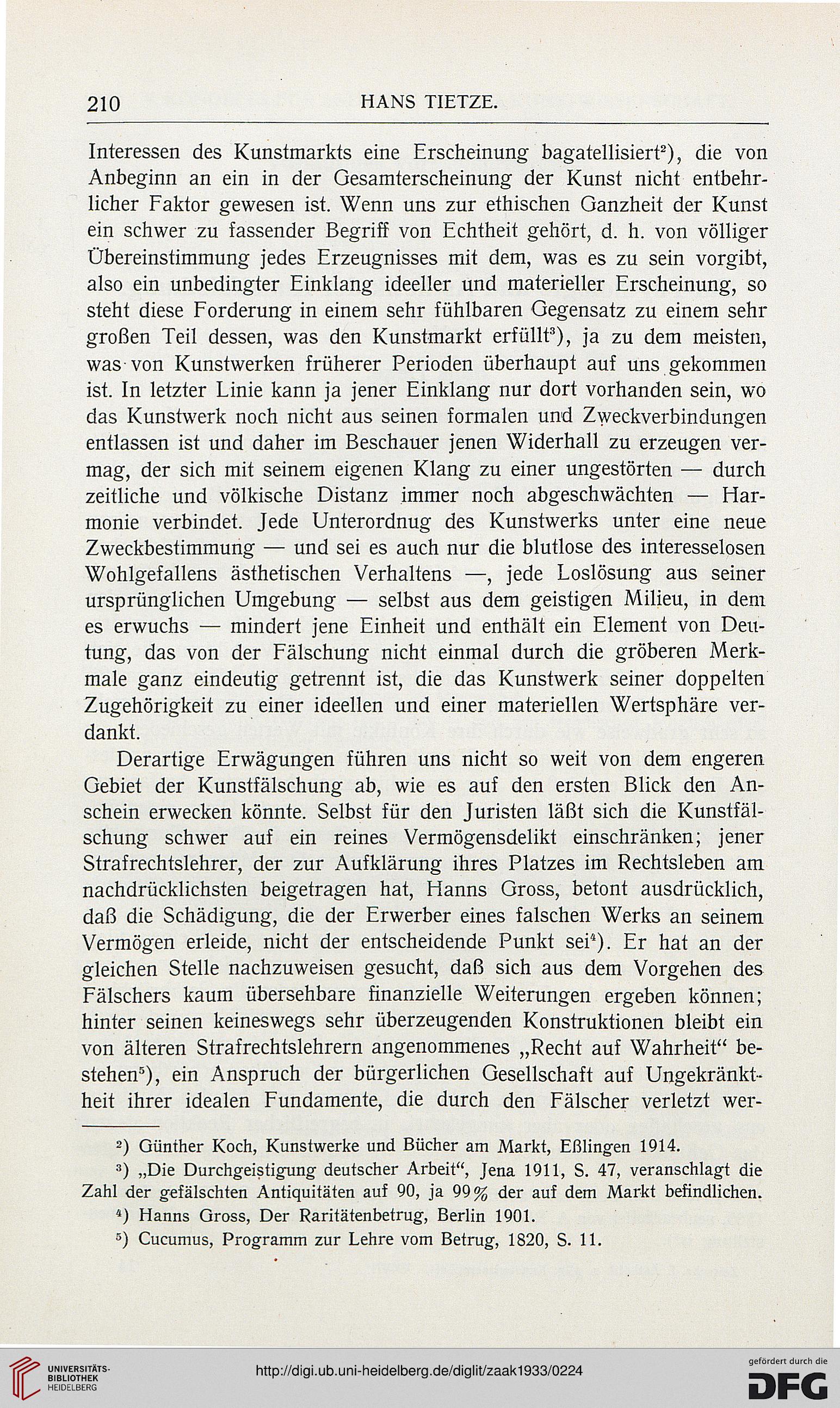210
HANS TIETZE.
Interessen des Kunstmarkts eine Erscheinung bagatellisiert2), die von
Anbeginn an ein in der Gesamterscheinung der Kunst nicht entbehr-
licher Faktor gewesen ist. Wenn uns zur ethischen Ganzheit der Kunst
ein schwer zu fassender Begriff von Echtheit gehört, d. h. von völliger
Übereinstimmung jedes Erzeugnisses mit dem, was es zu sein vorgibt,
also ein unbedingter Einklang ideeller und materieller Erscheinung, so
steht diese Forderung in einem sehr fühlbaren Gegensatz zu einem sehr
großen Teil dessen, was den Kunstmarkt erfüllt3), ja zu dem meisten,
was von Kunstwerken früherer Perioden überhaupt auf uns gekommen
ist. In letzter Linie kann ja jener Einklang nur dort vorhanden sein, wo
das Kunstwerk noch nicht aus seinen formalen und Zweckverbindungen
entlassen ist und daher im Beschauer jenen Widerhall zu erzeugen ver-
mag, der sich mit seinem eigenen Klang zu einer ungestörten — durch
zeitliche und völkische Distanz immer noch abgeschwächten — Har-
monie verbindet. Jede Unterordnug des Kunstwerks unter eine neue
Zweckbestimmung — und sei es auch nur die blutlose des interesselosen
Wohlgefallens ästhetischen Verhaltens —, jede Loslösung aus seiner
ursprünglichen Umgebung — selbst aus dem geistigen Milieu, in dem
es erwuchs — mindert jene Einheit und enthält ein Element von Deu-
tung, das von der Fälschung nicht einmal durch die gröberen Merk-
male ganz eindeutig getrennt ist, die das Kunstwerk seiner doppelten
Zugehörigkeit zu einer ideellen und einer materiellen Wertsphäre ver-
dankt.
Derartige Erwägungen führen uns nicht so weit von dem engeren
Gebiet der Kunstfälschung ab, wie es auf den ersten Blick den An-
schein erwecken könnte. Selbst für den Juristen läßt sich die Kunstfäl-
schung schwer auf ein reines Vermögensdelikt einschränken; jener
Strafrechtslehrer, der zur Aufklärung ihres Platzes im Rechtsleben am
nachdrücklichsten beigetragen hat, Hanns Gross, betont ausdrücklich,
daß die Schädigung, die der Erwerber eines falschen Werks an seinem
Vermögen erleide, nicht der entscheidende Punkt sei4). Er hat an der
gleichen Stelle nachzuweisen gesucht, daß sich aus dem Vorgehen des
Fälschers kaum übersehbare finanzielle Weiterungen ergeben können;
hinter seinen keineswegs sehr überzeugenden Konstruktionen bleibt ein
von älteren Strafrechtslehrern angenommenes „Recht auf Wahrheit" be-
stehen5), ein Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft auf Ungekränkt-
heit ihrer idealen Fundamente, die durch den Fälscher verletzt wer-
2) Günther Koch, Kunstwerke und Bücher am Markt, Eßlingen 1914.
3) „Die Durchgeistigung deutscher Arbeit", Jena 1911, S. 47, veranschlagt die
Zahl der gefälschten Antiquitäten auf 90, ja 99% der auf dem Markt befindlichen.
*) Hanns Gross, Der Raritätenbetrug, Berlin 1901.
5) Cucumus, Programm zur Lehre vom Betrug, 1820, S. 11.
HANS TIETZE.
Interessen des Kunstmarkts eine Erscheinung bagatellisiert2), die von
Anbeginn an ein in der Gesamterscheinung der Kunst nicht entbehr-
licher Faktor gewesen ist. Wenn uns zur ethischen Ganzheit der Kunst
ein schwer zu fassender Begriff von Echtheit gehört, d. h. von völliger
Übereinstimmung jedes Erzeugnisses mit dem, was es zu sein vorgibt,
also ein unbedingter Einklang ideeller und materieller Erscheinung, so
steht diese Forderung in einem sehr fühlbaren Gegensatz zu einem sehr
großen Teil dessen, was den Kunstmarkt erfüllt3), ja zu dem meisten,
was von Kunstwerken früherer Perioden überhaupt auf uns gekommen
ist. In letzter Linie kann ja jener Einklang nur dort vorhanden sein, wo
das Kunstwerk noch nicht aus seinen formalen und Zweckverbindungen
entlassen ist und daher im Beschauer jenen Widerhall zu erzeugen ver-
mag, der sich mit seinem eigenen Klang zu einer ungestörten — durch
zeitliche und völkische Distanz immer noch abgeschwächten — Har-
monie verbindet. Jede Unterordnug des Kunstwerks unter eine neue
Zweckbestimmung — und sei es auch nur die blutlose des interesselosen
Wohlgefallens ästhetischen Verhaltens —, jede Loslösung aus seiner
ursprünglichen Umgebung — selbst aus dem geistigen Milieu, in dem
es erwuchs — mindert jene Einheit und enthält ein Element von Deu-
tung, das von der Fälschung nicht einmal durch die gröberen Merk-
male ganz eindeutig getrennt ist, die das Kunstwerk seiner doppelten
Zugehörigkeit zu einer ideellen und einer materiellen Wertsphäre ver-
dankt.
Derartige Erwägungen führen uns nicht so weit von dem engeren
Gebiet der Kunstfälschung ab, wie es auf den ersten Blick den An-
schein erwecken könnte. Selbst für den Juristen läßt sich die Kunstfäl-
schung schwer auf ein reines Vermögensdelikt einschränken; jener
Strafrechtslehrer, der zur Aufklärung ihres Platzes im Rechtsleben am
nachdrücklichsten beigetragen hat, Hanns Gross, betont ausdrücklich,
daß die Schädigung, die der Erwerber eines falschen Werks an seinem
Vermögen erleide, nicht der entscheidende Punkt sei4). Er hat an der
gleichen Stelle nachzuweisen gesucht, daß sich aus dem Vorgehen des
Fälschers kaum übersehbare finanzielle Weiterungen ergeben können;
hinter seinen keineswegs sehr überzeugenden Konstruktionen bleibt ein
von älteren Strafrechtslehrern angenommenes „Recht auf Wahrheit" be-
stehen5), ein Anspruch der bürgerlichen Gesellschaft auf Ungekränkt-
heit ihrer idealen Fundamente, die durch den Fälscher verletzt wer-
2) Günther Koch, Kunstwerke und Bücher am Markt, Eßlingen 1914.
3) „Die Durchgeistigung deutscher Arbeit", Jena 1911, S. 47, veranschlagt die
Zahl der gefälschten Antiquitäten auf 90, ja 99% der auf dem Markt befindlichen.
*) Hanns Gross, Der Raritätenbetrug, Berlin 1901.
5) Cucumus, Programm zur Lehre vom Betrug, 1820, S. 11.